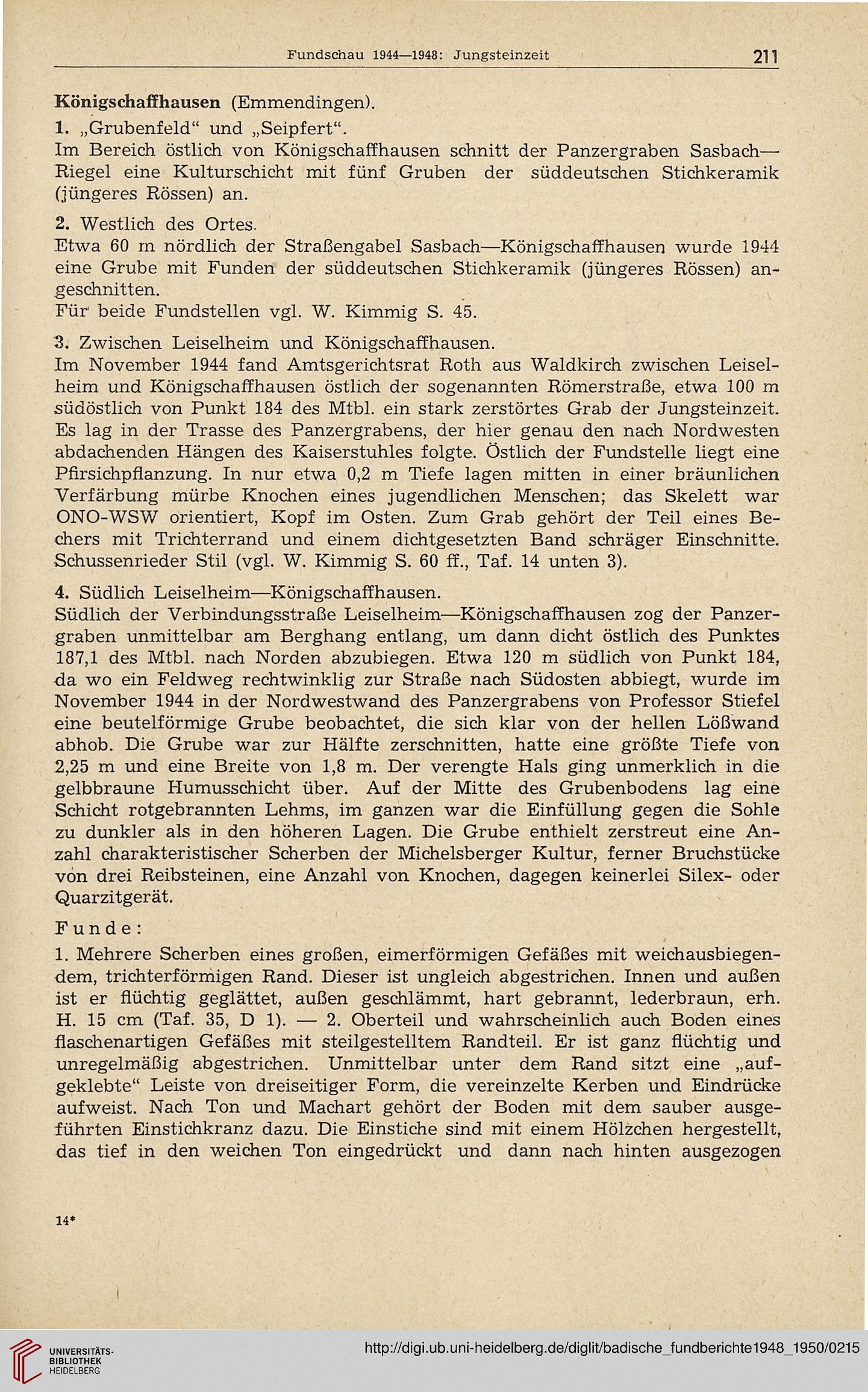Fundschau 1944—1948: Jungsteinzeit
211
Königschafihausen (Emmendingen).
1. „Grubenfeld“ und „Seipfert“.
Im Bereich östlich von Königschaffhausen schnitt der Panzergraben Sasbach—
Riegel eine Kulturschicht mit fünf Gruben der süddeutschen Stichkeramik
(jüngeres Rössen) an.
2. Westlich des Ortes.
Etwa 60 m nördlich der Straßengabel Sasbach—Königschaff hausen wurde 1944
eine Grube mit Funden der süddeutschen Stichkeramik (jüngeres Rössen) an-
geschnitten.
Für beide Fundstellen vgl. W. Kimmig S. 45.
3. Zwischen Leiselheim und Königschaffhausen.
Im November 1944 fand Amtsgerichtsrat Roth aus Waldkirch zwischen Leisel-
heim und Königschaffhausen östlich der sogenannten Römerstraße, etwa 100 m
südöstlich von Punkt 184 des Mtbl. ein stark zerstörtes Grab der Jungsteinzeit.
Es lag in der Trasse des Panzergrabens, der hier genau den nach Nordwesten
abdachenden Hängen des Kaiserstuhles folgte. Östlich der Fundstelle liegt eine
Pfirsichpflanzung. In nur etwa 0,2 m Tiefe lagen mitten in einer bräunlichen
Verfärbung mürbe Knochen eines jugendlichen Menschen; das Skelett war
ONO-WSW orientiert, Kopf im Osten. Zum Grab gehört der Teil eines Be-
chers mit Trichterrand und einem dichtgesetzten Band schräger Einschnitte.
Schussenrieder Stil (vgl. W. Kimmig S. 60 ff., Taf. 14 unten 3).
4. Südlich Leiselheim—Königschaffhausen.
Südlich der Verbindungsstraße Leiselheim—-Königschaffhausen zog der Panzer-
graben unmittelbar am Berghang entlang, um dann dicht östlich des Punktes
187,1 des Mtbl. nach Norden abzubiegen. Etwa 120 m südlich von Punkt 184,
da wo ein Feldweg rechtwinklig zur Straße nach Südosten abbiegt, wurde im
November 1944 in der Nordwestwand des Panzergrabens von Professor Stiefel
eine beutelförmige Grube beobachtet, die sich klar von der hellen Lößwand
abhob. Die Grube war zur Hälfte zerschnitten, hatte eine größte Tiefe von
2,25 m und eine Breite von 1,8 m. Der verengte Hals ging unmerklich in die
gelbbraune Humusschicht über. Auf der Mitte des Grubenbodens lag eine
Schicht rotgebrannten Lehms, im ganzen war die Einfüllung gegen die Sohle
zu dunkler als in den höheren Lagen. Die Grube enthielt zerstreut eine An-
zahl charakteristischer Scherben der Michelsberger Kultur, ferner Bruchstücke
von drei Reibsteinen, eine Anzahl von Knochen, dagegen keinerlei Silex- oder
Quarzitgerät.
Funde:
1. Mehrere Scherben eines großen, eimerförmigen Gefäßes mit weichausbiegen-
dem, trichterförmigen Rand. Dieser ist ungleich abgestrichen. Innen und außen
ist er flüchtig geglättet, außen geschlämmt, hart gebrannt, lederbraun, erh.
H. 15 cm (Taf. 35, D 1). — 2. Oberteil und wahrscheinlich auch Boden eines
flaschenartigen Gefäßes mit steilgestelltem Randteil. Er ist ganz flüchtig und
unregelmäßig abgestrichen. Unmittelbar unter dem Rand sitzt eine „auf-
geklebte“ Leiste von dreiseitiger Form, die vereinzelte Kerben und Eindrücke
aufweist. Nach Ton und Machart gehört der Boden mit dem sauber ausge-
führten Einstichkranz dazu. Die Einstiche sind mit einem Hölzchen hergestellt,
das tief in den weichen Ton eingedrückt und dann nach hinten ausgezogen
14*
211
Königschafihausen (Emmendingen).
1. „Grubenfeld“ und „Seipfert“.
Im Bereich östlich von Königschaffhausen schnitt der Panzergraben Sasbach—
Riegel eine Kulturschicht mit fünf Gruben der süddeutschen Stichkeramik
(jüngeres Rössen) an.
2. Westlich des Ortes.
Etwa 60 m nördlich der Straßengabel Sasbach—Königschaff hausen wurde 1944
eine Grube mit Funden der süddeutschen Stichkeramik (jüngeres Rössen) an-
geschnitten.
Für beide Fundstellen vgl. W. Kimmig S. 45.
3. Zwischen Leiselheim und Königschaffhausen.
Im November 1944 fand Amtsgerichtsrat Roth aus Waldkirch zwischen Leisel-
heim und Königschaffhausen östlich der sogenannten Römerstraße, etwa 100 m
südöstlich von Punkt 184 des Mtbl. ein stark zerstörtes Grab der Jungsteinzeit.
Es lag in der Trasse des Panzergrabens, der hier genau den nach Nordwesten
abdachenden Hängen des Kaiserstuhles folgte. Östlich der Fundstelle liegt eine
Pfirsichpflanzung. In nur etwa 0,2 m Tiefe lagen mitten in einer bräunlichen
Verfärbung mürbe Knochen eines jugendlichen Menschen; das Skelett war
ONO-WSW orientiert, Kopf im Osten. Zum Grab gehört der Teil eines Be-
chers mit Trichterrand und einem dichtgesetzten Band schräger Einschnitte.
Schussenrieder Stil (vgl. W. Kimmig S. 60 ff., Taf. 14 unten 3).
4. Südlich Leiselheim—Königschaffhausen.
Südlich der Verbindungsstraße Leiselheim—-Königschaffhausen zog der Panzer-
graben unmittelbar am Berghang entlang, um dann dicht östlich des Punktes
187,1 des Mtbl. nach Norden abzubiegen. Etwa 120 m südlich von Punkt 184,
da wo ein Feldweg rechtwinklig zur Straße nach Südosten abbiegt, wurde im
November 1944 in der Nordwestwand des Panzergrabens von Professor Stiefel
eine beutelförmige Grube beobachtet, die sich klar von der hellen Lößwand
abhob. Die Grube war zur Hälfte zerschnitten, hatte eine größte Tiefe von
2,25 m und eine Breite von 1,8 m. Der verengte Hals ging unmerklich in die
gelbbraune Humusschicht über. Auf der Mitte des Grubenbodens lag eine
Schicht rotgebrannten Lehms, im ganzen war die Einfüllung gegen die Sohle
zu dunkler als in den höheren Lagen. Die Grube enthielt zerstreut eine An-
zahl charakteristischer Scherben der Michelsberger Kultur, ferner Bruchstücke
von drei Reibsteinen, eine Anzahl von Knochen, dagegen keinerlei Silex- oder
Quarzitgerät.
Funde:
1. Mehrere Scherben eines großen, eimerförmigen Gefäßes mit weichausbiegen-
dem, trichterförmigen Rand. Dieser ist ungleich abgestrichen. Innen und außen
ist er flüchtig geglättet, außen geschlämmt, hart gebrannt, lederbraun, erh.
H. 15 cm (Taf. 35, D 1). — 2. Oberteil und wahrscheinlich auch Boden eines
flaschenartigen Gefäßes mit steilgestelltem Randteil. Er ist ganz flüchtig und
unregelmäßig abgestrichen. Unmittelbar unter dem Rand sitzt eine „auf-
geklebte“ Leiste von dreiseitiger Form, die vereinzelte Kerben und Eindrücke
aufweist. Nach Ton und Machart gehört der Boden mit dem sauber ausge-
führten Einstichkranz dazu. Die Einstiche sind mit einem Hölzchen hergestellt,
das tief in den weichen Ton eingedrückt und dann nach hinten ausgezogen
14*