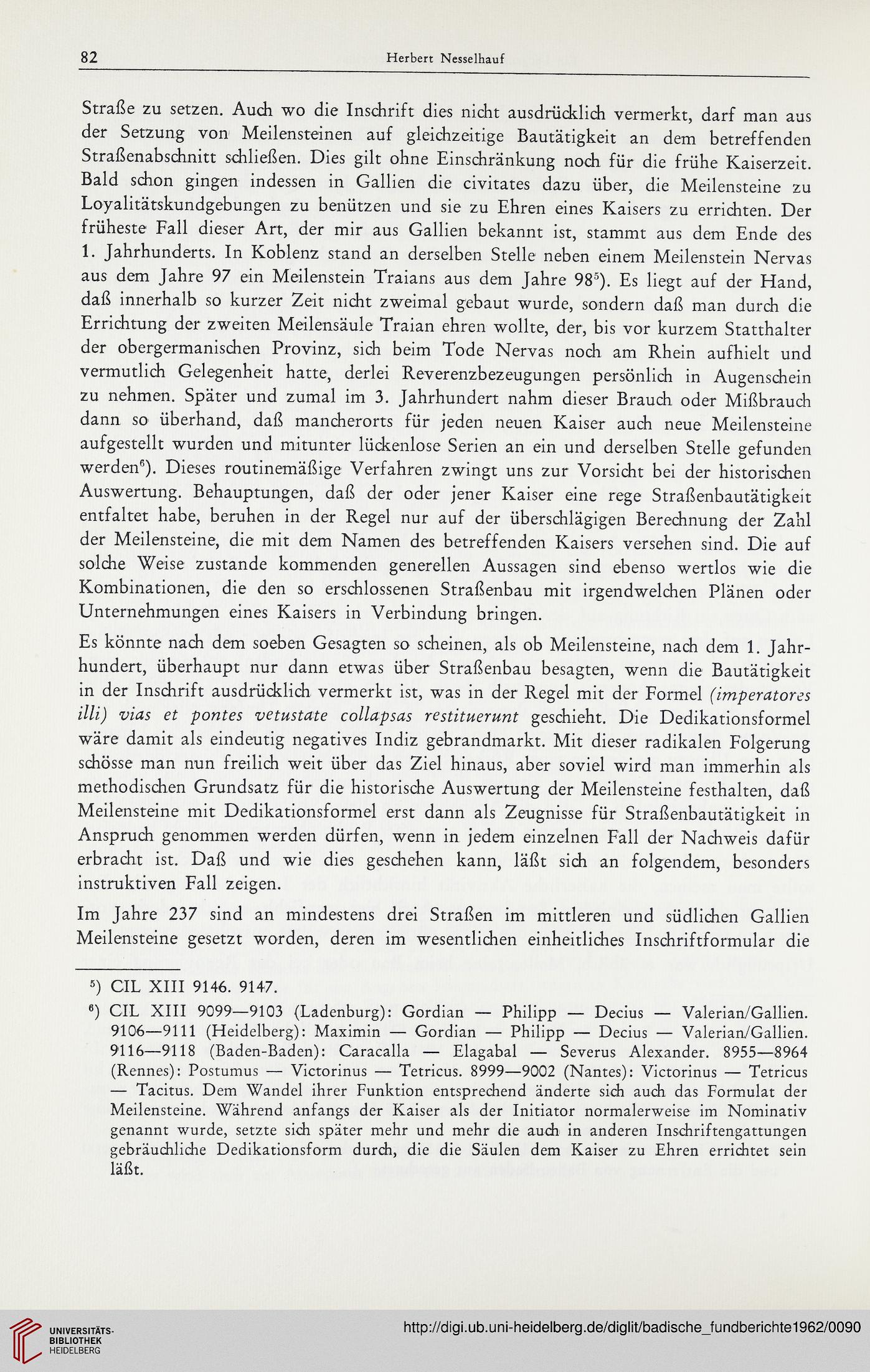82
Herbert Nesselhauf
Straße zu setzen. Auch wo die Inschrift dies nicht ausdrücklich vermerkt, darf man aus
der Setzung von Meilensteinen auf gleichzeitige Bautätigkeit an dem betreffenden
Straßenabschnitt schließen. Dies gilt ohne Einschränkung noch für die frühe Kaiserzeit.
Bald schon gingen indessen in Gallien die civitates dazu über, die Meilensteine zu
Loyalitätskundgebungen zu benützen und sie zu Ehren eines Kaisers zu errichten. Der
früheste Fall dieser Art, der mir aus Gallien bekannt ist, stammt aus dem Ende des
1. Jahrhunderts. In Koblenz stand an derselben Stelle neben einem Meilenstein Nervas
aus dem Jahre 97 ein Meilenstein Traians aus dem Jahre 985). Es liegt auf der Hand,
daß innerhalb so kurzer Zeit nicht zweimal gebaut wurde, sondern daß man durch die
Errichtung der zweiten Meilensäule Traian ehren wollte, der, bis vor kurzem Statthalter
der obergermanischen Provinz, sich beim Tode Nervas noch am Rhein aufhielt und
vermutlich Gelegenheit hatte, derlei Reverenzbezeugungen persönlich in Augenschein
zu nehmen. Später und zumal im 3. Jahrhundert nahm dieser Brauch oder Mißbrauch
dann so überhand, daß mancherorts für jeden neuen Kaiser auch neue Meilensteine
aufgestellt wurden und mitunter lückenlose Serien an ein und derselben Stelle gefunden
werden6). Dieses routinemäßige Verfahren zwingt uns zur Vorsicht bei der historischen
Auswertung. Behauptungen, daß der oder jener Kaiser eine rege Straßenbautätigkeit
entfaltet habe, beruhen in der Regel nur auf der überschlägigen Berechnung der Zahl
der Meilensteine, die mit dem Namen des betreffenden Kaisers versehen sind. Die auf
solche Weise zustande kommenden generellen Aussagen sind ebenso wertlos wie die
Kombinationen, die den so erschlossenen Straßenbau mit irgendwelchen Plänen oder
Unternehmungen eines Kaisers in Verbindung bringen.
Es könnte nach dem soeben Gesagten so scheinen, als ob Meilensteine, nach dem 1. Jahr-
hundert, überhaupt nur dann etwas über Straßenbau besagten, wenn die Bautätigkeit
in der Inschrift ausdrücklich vermerkt ist, was in der Regel mit der Formel (imperatores
illi) vias et pontes vetustate collapsas restituerunt geschieht. Die Dedikationsformel
wäre damit als eindeutig negatives Indiz gebrandmarkt. Mit dieser radikalen Folgerung
schösse man nun freilich weit über das Ziel hinaus, aber soviel wird man immerhin als
methodischen Grundsatz für die historische Auswertung der Meilensteine festhalten, daß
Meilensteine mit Dedikationsformel erst dann als Zeugnisse für Straßenbautätigkeit in
Anspruch genommen werden dürfen, wenn in jedem einzelnen Fall der Nachweis dafür
erbracht ist. Daß und wie dies geschehen kann, läßt sich an folgendem, besonders
instruktiven Fall zeigen.
Im Jahre 237 sind an mindestens drei Straßen im mittleren und südlichen Gallien
Meilensteine gesetzt worden, deren im wesentlichen einheitliches Inschriftformular die
5) CIL XIII 9146. 9147.
6) CIL XIII 9099—9103 (Ladenburg): Gordian — Philipp — Decius — Valerian/Gallien.
9106—9111 (Heidelberg): Maximin — Gordian — Philipp — Decius — Valerian/Gallien.
9116—9118 (Baden-Baden): Caracalla — Elagabal — Severus Alexander. 8955—8964
(Rennes): Postumus — Victorinus — Tetricus. 8999—9002 (Nantes): Victorinus — Tetricus
— Tacitus. Dem Wandel ihrer Funktion entsprechend änderte sich auch das Formulat der
Meilensteine. Während anfangs der Kaiser als der Initiator normalerweise im Nominativ
genannt wurde, setzte sich später mehr und mehr die auch in anderen Inschriftengattungen
gebräuchliche Dedikationsform durch, die die Säulen dem Kaiser zu Ehren errichtet sein
läßt.
Herbert Nesselhauf
Straße zu setzen. Auch wo die Inschrift dies nicht ausdrücklich vermerkt, darf man aus
der Setzung von Meilensteinen auf gleichzeitige Bautätigkeit an dem betreffenden
Straßenabschnitt schließen. Dies gilt ohne Einschränkung noch für die frühe Kaiserzeit.
Bald schon gingen indessen in Gallien die civitates dazu über, die Meilensteine zu
Loyalitätskundgebungen zu benützen und sie zu Ehren eines Kaisers zu errichten. Der
früheste Fall dieser Art, der mir aus Gallien bekannt ist, stammt aus dem Ende des
1. Jahrhunderts. In Koblenz stand an derselben Stelle neben einem Meilenstein Nervas
aus dem Jahre 97 ein Meilenstein Traians aus dem Jahre 985). Es liegt auf der Hand,
daß innerhalb so kurzer Zeit nicht zweimal gebaut wurde, sondern daß man durch die
Errichtung der zweiten Meilensäule Traian ehren wollte, der, bis vor kurzem Statthalter
der obergermanischen Provinz, sich beim Tode Nervas noch am Rhein aufhielt und
vermutlich Gelegenheit hatte, derlei Reverenzbezeugungen persönlich in Augenschein
zu nehmen. Später und zumal im 3. Jahrhundert nahm dieser Brauch oder Mißbrauch
dann so überhand, daß mancherorts für jeden neuen Kaiser auch neue Meilensteine
aufgestellt wurden und mitunter lückenlose Serien an ein und derselben Stelle gefunden
werden6). Dieses routinemäßige Verfahren zwingt uns zur Vorsicht bei der historischen
Auswertung. Behauptungen, daß der oder jener Kaiser eine rege Straßenbautätigkeit
entfaltet habe, beruhen in der Regel nur auf der überschlägigen Berechnung der Zahl
der Meilensteine, die mit dem Namen des betreffenden Kaisers versehen sind. Die auf
solche Weise zustande kommenden generellen Aussagen sind ebenso wertlos wie die
Kombinationen, die den so erschlossenen Straßenbau mit irgendwelchen Plänen oder
Unternehmungen eines Kaisers in Verbindung bringen.
Es könnte nach dem soeben Gesagten so scheinen, als ob Meilensteine, nach dem 1. Jahr-
hundert, überhaupt nur dann etwas über Straßenbau besagten, wenn die Bautätigkeit
in der Inschrift ausdrücklich vermerkt ist, was in der Regel mit der Formel (imperatores
illi) vias et pontes vetustate collapsas restituerunt geschieht. Die Dedikationsformel
wäre damit als eindeutig negatives Indiz gebrandmarkt. Mit dieser radikalen Folgerung
schösse man nun freilich weit über das Ziel hinaus, aber soviel wird man immerhin als
methodischen Grundsatz für die historische Auswertung der Meilensteine festhalten, daß
Meilensteine mit Dedikationsformel erst dann als Zeugnisse für Straßenbautätigkeit in
Anspruch genommen werden dürfen, wenn in jedem einzelnen Fall der Nachweis dafür
erbracht ist. Daß und wie dies geschehen kann, läßt sich an folgendem, besonders
instruktiven Fall zeigen.
Im Jahre 237 sind an mindestens drei Straßen im mittleren und südlichen Gallien
Meilensteine gesetzt worden, deren im wesentlichen einheitliches Inschriftformular die
5) CIL XIII 9146. 9147.
6) CIL XIII 9099—9103 (Ladenburg): Gordian — Philipp — Decius — Valerian/Gallien.
9106—9111 (Heidelberg): Maximin — Gordian — Philipp — Decius — Valerian/Gallien.
9116—9118 (Baden-Baden): Caracalla — Elagabal — Severus Alexander. 8955—8964
(Rennes): Postumus — Victorinus — Tetricus. 8999—9002 (Nantes): Victorinus — Tetricus
— Tacitus. Dem Wandel ihrer Funktion entsprechend änderte sich auch das Formulat der
Meilensteine. Während anfangs der Kaiser als der Initiator normalerweise im Nominativ
genannt wurde, setzte sich später mehr und mehr die auch in anderen Inschriftengattungen
gebräuchliche Dedikationsform durch, die die Säulen dem Kaiser zu Ehren errichtet sein
läßt.