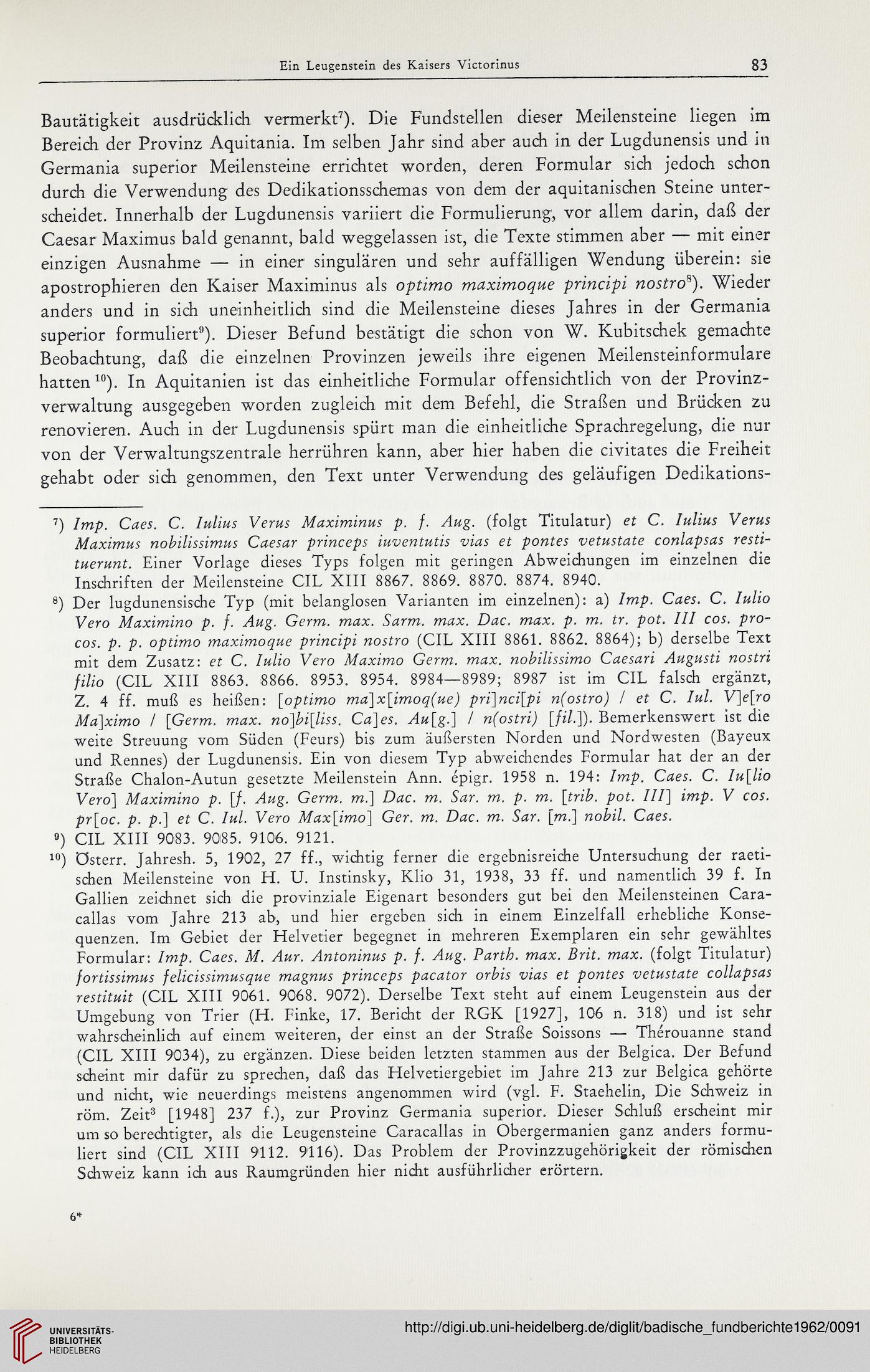Ein Leugenstein des Kaisers Victorinus
83
Bautätigkeit ausdrücklich vermerkt7). Die Fundstellen dieser Meilensteine liegen im
Bereich der Provinz Aquitania. Im selben Jahr sind aber auch in der Lugdunensis und in
Germania superior Meilensteine errichtet worden, deren Formular sich jedoch schon
durch die Verwendung des Dedikationsschemas von dem der aquitanischen Steine unter-
scheidet. Innerhalb der Lugdunensis variiert die Formulierung, vor allem darin, daß der
Caesar Maximus bald genannt, bald weggelassen ist, die Texte stimmen aber — mit einer
einzigen Ausnahme — in einer singulären und sehr auffälligen Wendung überein: sie
apostrophieren den Kaiser Maximinus als optimo maximoque principi nostro8'). Wieder
anders und in sich uneinheitlich sind die Meilensteine dieses Jahres in der Germania
superior formuliert9). Dieser Befund bestätigt die schon von W. Kubitschek gemachte
Beobachtung, daß die einzelnen Provinzen jeweils ihre eigenen Meilensteinformulare
hatten10). In Aquitanien ist das einheitliche Formular offensichtlich von der Provinz-
verwaltung ausgegeben worden zugleich mit dem Befehl, die Straßen und Brücken zu
renovieren. Auch in der Lugdunensis spürt man die einheitliche Sprachregelung, die nur
von der Verwaltungszentrale herrühren kann, aber hier haben die civitates die Freiheit
gehabt oder sich genommen, den Text unter Verwendung des geläufigen Dedikations-
7) Imp. Caes. C. Iulius Verus Maximinus p. f. Aug. (folgt Titulatur) et C. Iulius Verns
Maximus nobilissimus Caesar princeps iuventutis vias et pontes vetustate conlapsas resti-
tuerunt. Einer Vorlage dieses Typs folgen mit geringen Abweichungen im einzelnen die
Inschriften der Meilensteine CIL XIII 8867. 8869. 8870. 8874. 8940.
8) Der lugdunensische Typ (mit belanglosen Varianten im einzelnen): a) Imp. Caes. C. Iulio
Vero Maximino p. f. Aug. Germ. max. Sarm. max. Dac. max. p. m. tr. pot. III cos. pro-
cos. p. p. optimo maximoque principi nostro (CIL XIII 8861. 8862. 8864); b) derselbe Text
mit dem Zusatz: et C. Iulio Vero Maximo Germ. max. nobilissimo Caesari Augusti nostri
filio (CIL XIII 8863. 8866. 8953. 8954. 8984—8989; 8987 ist im CIL falsch ergänzt,
Z. 4 ff. muß es heißen: [optimo ma]x[imoq(ue) pri}nci[pi n(ostro) / et C. Iul. V]e[ro
Ma}ximo / [Germ. max. no}bi[liss. Ca}es. Au[g.J / n(ostri) [/?/.]). Bemerkenswert ist die
weite Streuung vom Süden (Feurs) bis zum äußersten Norden und Nordwesten (Bayeux
und Rennes) der Lugdunensis. Ein von diesem Typ abweichendes Formular hat der an der
Straße Chalon-Autun gesetzte Meilenstein Ann. epigr. 1958 n. 194: Imp. Caes. C. Iu[lio
Vero} Maximino p. [f. Aug. Germ. m.} Dac. m. Sar. m. p. m. [trib. pot. III} imp. V cos.
pr[oc. p. p.} et C. Iul. Vero Max[imo} Ger. m. Dac. m. Sar. [m.J nobil. Caes.
9) CIL XIII 9083. 9085. 9106. 9121.
10) österr. Jahresh. 5, 1902, 27 ff., wichtig ferner die ergebnisreiche Untersuchung der raeti-
schen Meilensteine von H. U. Instinsky, Klio 31, 1938, 33 ff. und namentlich 39 f. In
Gallien zeichnet sich die provinziale Eigenart besonders gut bei den Meilensteinen Cara-
callas vom Jahre 213 ab, und hier ergeben sich in einem Einzelfall erhebliche Konse-
quenzen. Im Gebiet der Helvetier begegnet in mehreren Exemplaren ein sehr gewähltes
Formular: Imp. Caes. M. Aur. Antoninus p. /. Aug. Parth. max. Brit. max. (folgt Titulatur)
fortissimus felicissimusque magnus princeps pacator orbis vias et pontes vetustate collapsas
restituit (CIL XIII 9061. 9068. 9072). Derselbe Text steht auf einem Leugenstein aus der
Umgebung von Trier (H. Finke, 17. Bericht der RGK [1927], 106 n. 318) und ist sehr
wahrscheinlich auf einem weiteren, der einst an der Straße Soissons — Therouanne stand
(CIL XIII 9034), zu ergänzen. Diese beiden letzten stammen aus der Belgica. Der Befund
scheint mir dafür zu sprechen, daß das Helvetiergebiet im Jahre 213 zur Belgica gehörte
und nicht, wie neuerdings meistens angenommen wird (vgl. F. Staehelin, Die Schweiz in
röm. Zeit3 [1948] 237 f.), zur Provinz Germania superior. Dieser Schluß erscheint mir
um so berechtigter, als die Leugensteine Caracallas in Obergermanien ganz anders formu-
liert sind (CIL XIII 9112. 9116). Das Problem der Provinzzugehörigkeit der römischen
Schweiz kann ich aus Raumgründen hier nicht ausführlicher erörtern.
6*
83
Bautätigkeit ausdrücklich vermerkt7). Die Fundstellen dieser Meilensteine liegen im
Bereich der Provinz Aquitania. Im selben Jahr sind aber auch in der Lugdunensis und in
Germania superior Meilensteine errichtet worden, deren Formular sich jedoch schon
durch die Verwendung des Dedikationsschemas von dem der aquitanischen Steine unter-
scheidet. Innerhalb der Lugdunensis variiert die Formulierung, vor allem darin, daß der
Caesar Maximus bald genannt, bald weggelassen ist, die Texte stimmen aber — mit einer
einzigen Ausnahme — in einer singulären und sehr auffälligen Wendung überein: sie
apostrophieren den Kaiser Maximinus als optimo maximoque principi nostro8'). Wieder
anders und in sich uneinheitlich sind die Meilensteine dieses Jahres in der Germania
superior formuliert9). Dieser Befund bestätigt die schon von W. Kubitschek gemachte
Beobachtung, daß die einzelnen Provinzen jeweils ihre eigenen Meilensteinformulare
hatten10). In Aquitanien ist das einheitliche Formular offensichtlich von der Provinz-
verwaltung ausgegeben worden zugleich mit dem Befehl, die Straßen und Brücken zu
renovieren. Auch in der Lugdunensis spürt man die einheitliche Sprachregelung, die nur
von der Verwaltungszentrale herrühren kann, aber hier haben die civitates die Freiheit
gehabt oder sich genommen, den Text unter Verwendung des geläufigen Dedikations-
7) Imp. Caes. C. Iulius Verus Maximinus p. f. Aug. (folgt Titulatur) et C. Iulius Verns
Maximus nobilissimus Caesar princeps iuventutis vias et pontes vetustate conlapsas resti-
tuerunt. Einer Vorlage dieses Typs folgen mit geringen Abweichungen im einzelnen die
Inschriften der Meilensteine CIL XIII 8867. 8869. 8870. 8874. 8940.
8) Der lugdunensische Typ (mit belanglosen Varianten im einzelnen): a) Imp. Caes. C. Iulio
Vero Maximino p. f. Aug. Germ. max. Sarm. max. Dac. max. p. m. tr. pot. III cos. pro-
cos. p. p. optimo maximoque principi nostro (CIL XIII 8861. 8862. 8864); b) derselbe Text
mit dem Zusatz: et C. Iulio Vero Maximo Germ. max. nobilissimo Caesari Augusti nostri
filio (CIL XIII 8863. 8866. 8953. 8954. 8984—8989; 8987 ist im CIL falsch ergänzt,
Z. 4 ff. muß es heißen: [optimo ma]x[imoq(ue) pri}nci[pi n(ostro) / et C. Iul. V]e[ro
Ma}ximo / [Germ. max. no}bi[liss. Ca}es. Au[g.J / n(ostri) [/?/.]). Bemerkenswert ist die
weite Streuung vom Süden (Feurs) bis zum äußersten Norden und Nordwesten (Bayeux
und Rennes) der Lugdunensis. Ein von diesem Typ abweichendes Formular hat der an der
Straße Chalon-Autun gesetzte Meilenstein Ann. epigr. 1958 n. 194: Imp. Caes. C. Iu[lio
Vero} Maximino p. [f. Aug. Germ. m.} Dac. m. Sar. m. p. m. [trib. pot. III} imp. V cos.
pr[oc. p. p.} et C. Iul. Vero Max[imo} Ger. m. Dac. m. Sar. [m.J nobil. Caes.
9) CIL XIII 9083. 9085. 9106. 9121.
10) österr. Jahresh. 5, 1902, 27 ff., wichtig ferner die ergebnisreiche Untersuchung der raeti-
schen Meilensteine von H. U. Instinsky, Klio 31, 1938, 33 ff. und namentlich 39 f. In
Gallien zeichnet sich die provinziale Eigenart besonders gut bei den Meilensteinen Cara-
callas vom Jahre 213 ab, und hier ergeben sich in einem Einzelfall erhebliche Konse-
quenzen. Im Gebiet der Helvetier begegnet in mehreren Exemplaren ein sehr gewähltes
Formular: Imp. Caes. M. Aur. Antoninus p. /. Aug. Parth. max. Brit. max. (folgt Titulatur)
fortissimus felicissimusque magnus princeps pacator orbis vias et pontes vetustate collapsas
restituit (CIL XIII 9061. 9068. 9072). Derselbe Text steht auf einem Leugenstein aus der
Umgebung von Trier (H. Finke, 17. Bericht der RGK [1927], 106 n. 318) und ist sehr
wahrscheinlich auf einem weiteren, der einst an der Straße Soissons — Therouanne stand
(CIL XIII 9034), zu ergänzen. Diese beiden letzten stammen aus der Belgica. Der Befund
scheint mir dafür zu sprechen, daß das Helvetiergebiet im Jahre 213 zur Belgica gehörte
und nicht, wie neuerdings meistens angenommen wird (vgl. F. Staehelin, Die Schweiz in
röm. Zeit3 [1948] 237 f.), zur Provinz Germania superior. Dieser Schluß erscheint mir
um so berechtigter, als die Leugensteine Caracallas in Obergermanien ganz anders formu-
liert sind (CIL XIII 9112. 9116). Das Problem der Provinzzugehörigkeit der römischen
Schweiz kann ich aus Raumgründen hier nicht ausführlicher erörtern.
6*