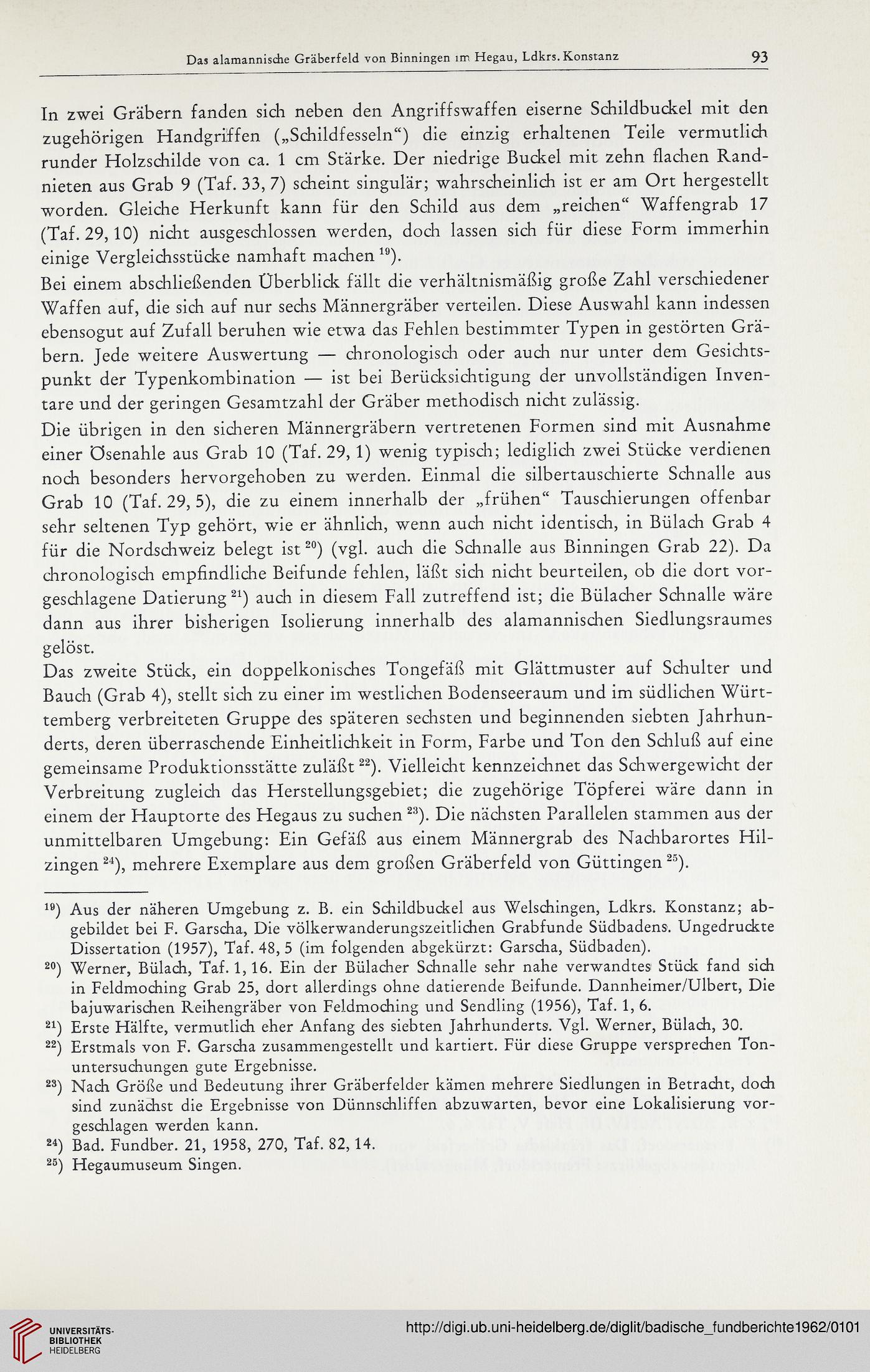Das alamannische Gräberfeld von Binningen im Hegau, Ldkrs. Konstanz
93
In zwei Gräbern fanden sich neben den Angriffswaffen eiserne Schildbuckel mit den
zugehörigen Handgriffen („Schildfesseln“) die einzig erhaltenen Teile vermutlich
runder Holzschilde von ca. 1 cm Stärke. Der niedrige Buckel mit zehn flachen Rand-
nieten aus Grab 9 (Taf. 33, 7) scheint singulär; wahrscheinlich ist er am Ort hergestellt
worden. Gleiche Herkunft kann für den Schild aus dem „reichen“ Waffengrab 17
(Taf. 29,10) nicht ausgeschlossen werden, doch lassen sich für diese Form immerhin
einige Vergleichsstücke namhaft machen 19).
Bei einem abschließenden Überblick fällt die verhältnismäßig große Zahl verschiedener
Waffen auf, die sich auf nur sechs Männergräber verteilen. Diese Auswahl kann indessen
ebensogut auf Zufall beruhen wie etwa das Fehlen bestimmter Typen in gestörten Grä-
bern. Jede weitere Auswertung — chronologisch oder auch nur unter dem Gesichts-
punkt der Typenkombination — ist bei Berücksichtigung der unvollständigen Inven-
tare und der geringen Gesamtzahl der Gräber methodisch nicht zulässig.
Die übrigen in den sicheren Männergräbern vertretenen Formen sind mit Ausnahme
einer ösenahle aus Grab 10 (Taf. 29,1) wenig typisch; lediglich zwei Stücke verdienen
noch besonders hervorgehoben zu werden. Einmal die silbertauschierte Schnalle aus
Grab 10 (Taf. 29, 5), die zu einem innerhalb der „frühen“ Tauschierungen offenbar
sehr seltenen Typ gehört, wie er ähnlich, wenn auch nicht identisch, in Bülach Grab 4
für die Nordschweiz belegt ist20) (vgl. auch die Schnalle aus Binningen Grab 22). Da
chronologisch empfindliche Beifunde fehlen, läßt sich nicht beurteilen, ob die dort vor-
geschlagene Datierung21) auch in diesem Fall zutreffend ist; die Bülacher Schnalle wäre
dann aus ihrer bisherigen Isolierung innerhalb des alamannischen Siedlungsraumes
gelöst.
Das zweite Stück, ein doppelkonisches Tongefäß mit Glättmuster auf Schulter und
Bauch (Grab 4), stellt sich zu einer im westlichen Bodenseeraum und im südlichen Würt-
temberg verbreiteten Gruppe des späteren sechsten und beginnenden siebten Jahrhun-
derts, deren überraschende Einheitlichkeit in Form, Farbe und Ton den Schluß auf eine
gemeinsame Produktionsstätte zuläßt22). Vielleicht kennzeichnet das Schwergewicht der
Verbreitung zugleich das Herstellungsgebiet; die zugehörige Töpferei wäre dann in
einem der Hauptorte des Hegaus zu suchen 23). Die nächsten Parallelen stammen aus der
unmittelbaren Umgebung: Ein Gefäß aus einem Männergrab des Nachbarortes Hil-
zingen 24), mehrere Exemplare aus dem großen Gräberfeld von Güttingen 25).
1B) Aus der näheren Umgebung z. B. ein Schildbuckel aus Welschingen, Ldkrs. Konstanz; ab-
gebildet bei F. Garscha, Die völkerwanderungszeitlichen Grabfunde Südbadens. Ungedruckte
Dissertation (1957), Taf. 48, 5 (im folgenden abgekürzt: Garscha, Südbaden).
20) Werner, Bülach, Taf. 1, 16. Ein der Bülacher Schnalle sehr nahe verwandtes Stück fand sich
in Feldmoching Grab 25, dort allerdings ohne datierende Beifunde. Dannheimer/Ulbert, Die
bajuwarischen Reihengräber von Feldmoching und Sendling (1956), Taf. 1, 6.
21) Erste Hälfte, vermutlich eher Anfang des siebten Jahrhunderts. Vgl. Werner, Bülach, 30.
22) Erstmals von F. Garscha zusammengestellt und kartiert. Für diese Gruppe versprechen Ton-
untersuchungen gute Ergebnisse.
23) Nach Größe und Bedeutung ihrer Gräberfelder kämen mehrere Siedlungen in Betracht, doch
sind zunächst die Ergebnisse von Dünnschliffen abzuwarten, bevor eine Lokalisierung vor-
geschlagen werden kann.
24) Bad. Fundber. 21, 1958, 270, Taf. 82,14.
25) Hegaumuseum Singen.
93
In zwei Gräbern fanden sich neben den Angriffswaffen eiserne Schildbuckel mit den
zugehörigen Handgriffen („Schildfesseln“) die einzig erhaltenen Teile vermutlich
runder Holzschilde von ca. 1 cm Stärke. Der niedrige Buckel mit zehn flachen Rand-
nieten aus Grab 9 (Taf. 33, 7) scheint singulär; wahrscheinlich ist er am Ort hergestellt
worden. Gleiche Herkunft kann für den Schild aus dem „reichen“ Waffengrab 17
(Taf. 29,10) nicht ausgeschlossen werden, doch lassen sich für diese Form immerhin
einige Vergleichsstücke namhaft machen 19).
Bei einem abschließenden Überblick fällt die verhältnismäßig große Zahl verschiedener
Waffen auf, die sich auf nur sechs Männergräber verteilen. Diese Auswahl kann indessen
ebensogut auf Zufall beruhen wie etwa das Fehlen bestimmter Typen in gestörten Grä-
bern. Jede weitere Auswertung — chronologisch oder auch nur unter dem Gesichts-
punkt der Typenkombination — ist bei Berücksichtigung der unvollständigen Inven-
tare und der geringen Gesamtzahl der Gräber methodisch nicht zulässig.
Die übrigen in den sicheren Männergräbern vertretenen Formen sind mit Ausnahme
einer ösenahle aus Grab 10 (Taf. 29,1) wenig typisch; lediglich zwei Stücke verdienen
noch besonders hervorgehoben zu werden. Einmal die silbertauschierte Schnalle aus
Grab 10 (Taf. 29, 5), die zu einem innerhalb der „frühen“ Tauschierungen offenbar
sehr seltenen Typ gehört, wie er ähnlich, wenn auch nicht identisch, in Bülach Grab 4
für die Nordschweiz belegt ist20) (vgl. auch die Schnalle aus Binningen Grab 22). Da
chronologisch empfindliche Beifunde fehlen, läßt sich nicht beurteilen, ob die dort vor-
geschlagene Datierung21) auch in diesem Fall zutreffend ist; die Bülacher Schnalle wäre
dann aus ihrer bisherigen Isolierung innerhalb des alamannischen Siedlungsraumes
gelöst.
Das zweite Stück, ein doppelkonisches Tongefäß mit Glättmuster auf Schulter und
Bauch (Grab 4), stellt sich zu einer im westlichen Bodenseeraum und im südlichen Würt-
temberg verbreiteten Gruppe des späteren sechsten und beginnenden siebten Jahrhun-
derts, deren überraschende Einheitlichkeit in Form, Farbe und Ton den Schluß auf eine
gemeinsame Produktionsstätte zuläßt22). Vielleicht kennzeichnet das Schwergewicht der
Verbreitung zugleich das Herstellungsgebiet; die zugehörige Töpferei wäre dann in
einem der Hauptorte des Hegaus zu suchen 23). Die nächsten Parallelen stammen aus der
unmittelbaren Umgebung: Ein Gefäß aus einem Männergrab des Nachbarortes Hil-
zingen 24), mehrere Exemplare aus dem großen Gräberfeld von Güttingen 25).
1B) Aus der näheren Umgebung z. B. ein Schildbuckel aus Welschingen, Ldkrs. Konstanz; ab-
gebildet bei F. Garscha, Die völkerwanderungszeitlichen Grabfunde Südbadens. Ungedruckte
Dissertation (1957), Taf. 48, 5 (im folgenden abgekürzt: Garscha, Südbaden).
20) Werner, Bülach, Taf. 1, 16. Ein der Bülacher Schnalle sehr nahe verwandtes Stück fand sich
in Feldmoching Grab 25, dort allerdings ohne datierende Beifunde. Dannheimer/Ulbert, Die
bajuwarischen Reihengräber von Feldmoching und Sendling (1956), Taf. 1, 6.
21) Erste Hälfte, vermutlich eher Anfang des siebten Jahrhunderts. Vgl. Werner, Bülach, 30.
22) Erstmals von F. Garscha zusammengestellt und kartiert. Für diese Gruppe versprechen Ton-
untersuchungen gute Ergebnisse.
23) Nach Größe und Bedeutung ihrer Gräberfelder kämen mehrere Siedlungen in Betracht, doch
sind zunächst die Ergebnisse von Dünnschliffen abzuwarten, bevor eine Lokalisierung vor-
geschlagen werden kann.
24) Bad. Fundber. 21, 1958, 270, Taf. 82,14.
25) Hegaumuseum Singen.