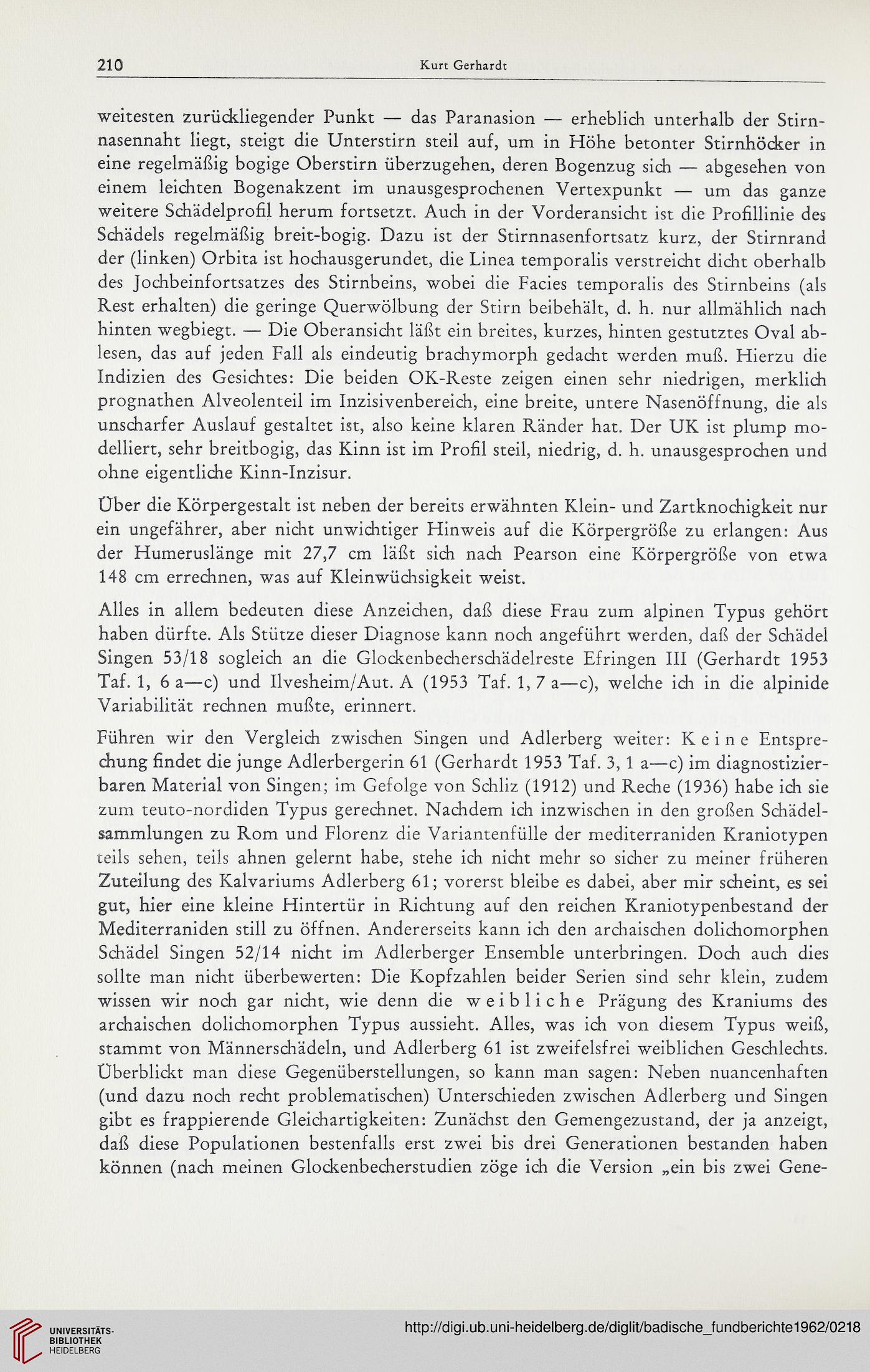210
Kurt Gerhardt
weitesten zurückliegender Punkt — das Paranasion — erheblich unterhalb der Stirn-
nasennaht liegt, steigt die Unterstirn steil auf, um in Höhe betonter Stirnhöcker in
eine regelmäßig bogige Oberstirn überzugehen, deren Bogenzug sich — abgesehen von
einem leichten Bogenakzent im unausgesprochenen Vertexpunkt — um das ganze
weitere Schädelprofil herum fortsetzt. Auch in der Vorderansicht ist die Profillinie des
Schädels regelmäßig breit-bogig. Dazu ist der Stirnnasenfortsatz kurz, der Stirnrand
der (linken) Orbita ist hochausgerundet, die Linea temporalis verstreicht dicht oberhalb
des Jochbeinfortsatzes des Stirnbeins, wobei die Facies temporalis des Stirnbeins (als
Rest erhalten) die geringe Querwölbung der Stirn beibehält, d. h. nur allmählich nach
hinten wegbiegt. — Die Oberansicht läßt ein breites, kurzes, hinten gestutztes Oval ab-
lesen, das auf jeden Fall als eindeutig brachymorph gedacht werden muß. Hierzu die
Indizien des Gesichtes: Die beiden OK-Reste zeigen einen sehr niedrigen, merklich
prognathen Alveolenteil im Inzisivenbereich, eine breite, untere Nasenöffnung, die als
unscharfer Auslauf gestaltet ist, also keine klaren Ränder hat. Der UK ist plump mo-
delliert, sehr breitbogig, das Kinn ist im Profil steil, niedrig, d. h. unausgesprochen und
ohne eigentliche Kinn-Inzisur.
Über die Körpergestalt ist neben der bereits erwähnten Klein- und Zartknochigkeit nur
ein ungefährer, aber nicht unwichtiger Hinweis auf die Körpergröße zu erlangen: Aus
der Humeruslänge mit 27,7 cm läßt sich nach Pearson eine Körpergröße von etwa
148 cm errechnen, was auf Kleinwüchsigkeit weist.
Alles in allem bedeuten diese Anzeichen, daß diese Frau zum alpinen Typus gehört
haben dürfte. Als Stütze dieser Diagnose kann noch angeführt werden, daß der Schädel
Singen 53/18 sogleich an die Glockenbecherschädelreste Efringen III (Gerhardt 1953
Taf. 1, 6 a—c) und Ilvesheim/Aut. A (1953 Taf. 1, 7 a—c), welche ich in die alpinide
Variabilität rechnen mußte, erinnert.
Führen wir den Vergleich zwischen Singen und Adlerberg weiter: Keine Entspre-
chung findet die junge Adlerbergerin 61 (Gerhardt 1953 Taf. 3, 1 a—c) im diagnostizier-
baren Material von Singen; im Gefolge von Schliz (1912) und Reche (1936) habe ich sie
zum teuto-nordiden Typus gerechnet. Nachdem ich inzwischen in den großen Schädel-
sammlungen zu Rom und Florenz die Variantenfülle der mediterraniden Kraniotypen
teils sehen, teils ahnen gelernt habe, stehe ich nicht mehr so sicher zu meiner früheren
Zuteilung des Kalvariums Adlerberg 61; vorerst bleibe es dabei, aber mir scheint, es sei
gut, hier eine kleine Hintertür in Richtung auf den reichen Kraniotypenbestand der
Mediterraniden still zu öffnen. Andererseits kann ich den archaischen dolichomorphen
Schädel Singen 52/14 nicht im Adlerberger Ensemble unterbringen. Doch auch dies
sollte man nicht überbewerten: Die Kopfzahlen beider Serien sind sehr klein, zudem
wissen wir noch gar nicht, wie denn die weibliche Prägung des Kraniums des
archaischen dolichomorphen Typus aussieht. Alles, was ich von diesem Typus weiß,
stammt von Männerschädeln, und Adlerberg 61 ist zweifelsfrei weiblichen Geschlechts.
Überblickt man diese Gegenüberstellungen, so kann man sagen: Neben nuancenhaften
(und dazu noch recht problematischen) Unterschieden zwischen Adlerberg und Singen
gibt es frappierende Gleichartigkeiten: Zunächst den Gemengezustand, der ja anzeigt,
daß diese Populationen bestenfalls erst zwei bis drei Generationen bestanden haben
können (nach meinen Glockenbecherstudien zöge ich die Version „ein bis zwei Gene-
Kurt Gerhardt
weitesten zurückliegender Punkt — das Paranasion — erheblich unterhalb der Stirn-
nasennaht liegt, steigt die Unterstirn steil auf, um in Höhe betonter Stirnhöcker in
eine regelmäßig bogige Oberstirn überzugehen, deren Bogenzug sich — abgesehen von
einem leichten Bogenakzent im unausgesprochenen Vertexpunkt — um das ganze
weitere Schädelprofil herum fortsetzt. Auch in der Vorderansicht ist die Profillinie des
Schädels regelmäßig breit-bogig. Dazu ist der Stirnnasenfortsatz kurz, der Stirnrand
der (linken) Orbita ist hochausgerundet, die Linea temporalis verstreicht dicht oberhalb
des Jochbeinfortsatzes des Stirnbeins, wobei die Facies temporalis des Stirnbeins (als
Rest erhalten) die geringe Querwölbung der Stirn beibehält, d. h. nur allmählich nach
hinten wegbiegt. — Die Oberansicht läßt ein breites, kurzes, hinten gestutztes Oval ab-
lesen, das auf jeden Fall als eindeutig brachymorph gedacht werden muß. Hierzu die
Indizien des Gesichtes: Die beiden OK-Reste zeigen einen sehr niedrigen, merklich
prognathen Alveolenteil im Inzisivenbereich, eine breite, untere Nasenöffnung, die als
unscharfer Auslauf gestaltet ist, also keine klaren Ränder hat. Der UK ist plump mo-
delliert, sehr breitbogig, das Kinn ist im Profil steil, niedrig, d. h. unausgesprochen und
ohne eigentliche Kinn-Inzisur.
Über die Körpergestalt ist neben der bereits erwähnten Klein- und Zartknochigkeit nur
ein ungefährer, aber nicht unwichtiger Hinweis auf die Körpergröße zu erlangen: Aus
der Humeruslänge mit 27,7 cm läßt sich nach Pearson eine Körpergröße von etwa
148 cm errechnen, was auf Kleinwüchsigkeit weist.
Alles in allem bedeuten diese Anzeichen, daß diese Frau zum alpinen Typus gehört
haben dürfte. Als Stütze dieser Diagnose kann noch angeführt werden, daß der Schädel
Singen 53/18 sogleich an die Glockenbecherschädelreste Efringen III (Gerhardt 1953
Taf. 1, 6 a—c) und Ilvesheim/Aut. A (1953 Taf. 1, 7 a—c), welche ich in die alpinide
Variabilität rechnen mußte, erinnert.
Führen wir den Vergleich zwischen Singen und Adlerberg weiter: Keine Entspre-
chung findet die junge Adlerbergerin 61 (Gerhardt 1953 Taf. 3, 1 a—c) im diagnostizier-
baren Material von Singen; im Gefolge von Schliz (1912) und Reche (1936) habe ich sie
zum teuto-nordiden Typus gerechnet. Nachdem ich inzwischen in den großen Schädel-
sammlungen zu Rom und Florenz die Variantenfülle der mediterraniden Kraniotypen
teils sehen, teils ahnen gelernt habe, stehe ich nicht mehr so sicher zu meiner früheren
Zuteilung des Kalvariums Adlerberg 61; vorerst bleibe es dabei, aber mir scheint, es sei
gut, hier eine kleine Hintertür in Richtung auf den reichen Kraniotypenbestand der
Mediterraniden still zu öffnen. Andererseits kann ich den archaischen dolichomorphen
Schädel Singen 52/14 nicht im Adlerberger Ensemble unterbringen. Doch auch dies
sollte man nicht überbewerten: Die Kopfzahlen beider Serien sind sehr klein, zudem
wissen wir noch gar nicht, wie denn die weibliche Prägung des Kraniums des
archaischen dolichomorphen Typus aussieht. Alles, was ich von diesem Typus weiß,
stammt von Männerschädeln, und Adlerberg 61 ist zweifelsfrei weiblichen Geschlechts.
Überblickt man diese Gegenüberstellungen, so kann man sagen: Neben nuancenhaften
(und dazu noch recht problematischen) Unterschieden zwischen Adlerberg und Singen
gibt es frappierende Gleichartigkeiten: Zunächst den Gemengezustand, der ja anzeigt,
daß diese Populationen bestenfalls erst zwei bis drei Generationen bestanden haben
können (nach meinen Glockenbecherstudien zöge ich die Version „ein bis zwei Gene-