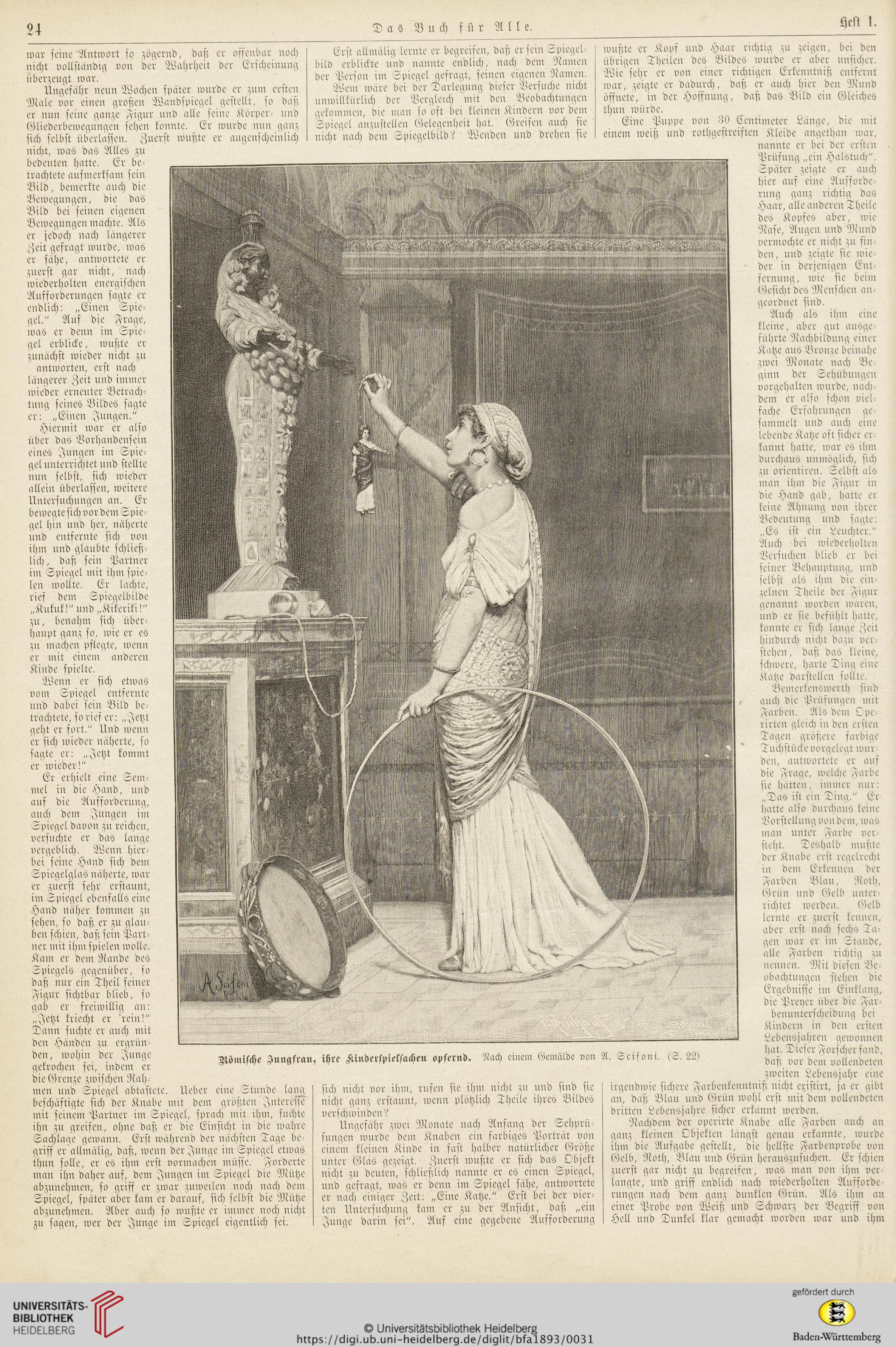Das Buch für Alle.
LM 1.
war seine Antwort so zögernd, daß er offenbar noch
nicht vollständig von der Wahrheit der Erscheinung
überzeugt war.
Ungefähr neun Wochen später wurde er zum ersten
Male vor einen großen Wandspiegel gestellt, so daß
er nun seine ganze Figur uud alle seine Körper- und
Gliederbcwegungen sehen konnte. Er wurde nun ganz
sich selbst überlassen. Zuerst wußte er augenscheinlich
nicht, was das Alles zu
bedeuten hatte. Er be¬
trachtete aufmerksam sein
Bild, bemerkte auch die
Bewegungen, die das
Bild bei seinen eigenen
Bewegungen machte. Als
er jedoch nach längerer
Zeit gefragt wurde, was
er sähe, antwortete er
zuerst gar nicht, nach
wiederholten energischen
Aufforderungen sagte er
endlich: „Einen Spie¬
gel." Auf die Frage,
was er denn im Spie¬
gel erblicke, wußte er
zunächst wieder nicht zu
antworten, erst nach
längerer Zeit und immer
wieder erneuter Betrach¬
tung seines Bildes sagte
er: „Einen Jungen."
Hiermit war er also
üöer das Vorhandensein
eines Jungen im Spie¬
gelunterrichtet und stellte
nun selbst, sich wieder
allen: überlassen, weitere
Untersuchungen an. Er
bewegte sich vordem Spie¬
gel hin und her, näherte
und entfernte sich von
ihm und glaubte schlie߬
lich , daß sein Partner
im Spiegel mit ihm spie¬
len wollte. Er lachte,
rief dein Spiegelbilde
„Kukuk!" und „Kikeriki!"
zu, benahm sich über¬
haupt ganz so, wie er es
zu machen pflegte, wenn
er mit einem anderen
Kinde spielte.
Wenn er sich etwas
vom Spiegel entfernte
und dabei sein Bild be¬
trachtete, soriefer: „Jetzt
geht er fort." Und wenn
er sich wieder näherte, so
sagte er: „Jetzt kommt
er wieder!"
Er erhielt eine Sem¬
mel in die Hand, und
auf die Aufforderung,
auch dem Jungen im
Spiegel davon zu reichen,
versuchte er das lange
vergeblich. Wenn hier¬
bei seine Hand sich dem
Spiegelglas näherte, war
er zuerst sehr erstaunt,
im spiegel ebenfalls eine
Hand näher kommen zu
sehen, so daß er zu glau¬
ben schien, daß sein Part-
ner nut ihm spielen wolle.
Kam er dem Rande des
Spiegels gegenüber, so
daß nur ein Theil seiner
Figur sichtbar blieb, so
gab er freiwillig an:
„Jetzt kriecht er 'rein!"
Tann suchte er auch mit
den Händen zu ergrün¬
den, wohin der Junge
gekrochen sei, indem er
die Grenze zivischeu Rah-
men und Spiegel abtastete. Ueber eine Stunde lang
beschäftigte sich der Knabe mit dem größten Interesse
mit seinem Partner im Spiegel, sprach mit ihm, suchte
ihn zu greifen, ohne daß er die Einsicht in die wahre
Sachlage gewann. Erst während der nächsten Tage be-
griff er allmülig, daß, wenn der Junge im Spiegel etwas
thun solle, er es ihm erst vormachen müsse. Forderte
man ihn daher auf, dem Jungen im Spiegel die Mütze
abzunehmen, so griff er zwar zuweilen noch nach dem
Spiegel, später aber kam er darauf, sich selbst die Mütze
abzunehmen. Aber auch so wußte er immer noch nicht
zu sagen, wer der Junge im Spiegel eigentlich sei.
Erst allmälig lernte er begreifen, daß er sein Spiegel-
bild erblickte und nannte endlich, nach dem Namen
der Person im Spiegel gefragt, seinen eigenen Namen.
Wem wäre bei der Darlegung dieser Versuche nicht
unwillkürlich der Vergleich mit den Beobachtungen
gekommen, die inan so oft bei kleinen Kindern vor dem
Spiegel anzustellen Gelegenheit hat. Greifen auch sie
nicht nach dem Spiegelbild? Wenden und drehen sie
sich nicht vor ihm, rufen sie ihm nicht zu und sind sie
nicht ganz erstaunt, wenn plötzlich Theile ihres Bildes
verschwinden?
Ungefähr zwei Monate nach Anfang der Sehprü-
fungen wurde dem Knaben ein farbiges Porträt von
einem kleinen Kinde in fast halber natürlicher Größe
unter Glas gezeigt. Zuerst wußte er sich das Objekt
nicht zu deuten, schließlich nannte er es einen Spiegel,
und gefragt, was er denn im Spiegel sähe, antwortete
er nach einiger Zeit: „Eine Katze." Erst bei der vier-
ten Untersuchung kam er zu der Ansicht, daß „ein
Junge darin sei". Auf eine gegebene Aufforderung
mußte er Kopf und Haar richtig zu zeigen, bei den
übrigen Theilen des Bildes wurde er aber unsicher.
Wie sehr er von einer richtigen Erkenntnis; entfernt
war, zeigte er dadurch, daß er auch Hier den Mund
öffnete, in der Hoffnung, daß das Bild ein Gleiches
thun würde.
Eine Puppe von 30 Centimeter Länge, die mit
einem weiß und rothgestreiften Kleide angethan war,
nannte er bei der ersten
Prüfung „ein Halstuch".
Später zeigte er auch
hier auf eine Aufforde-
rung ganz richtig das
Haar, alle anderen Theile
des Kopfes aber, wie
Nase, Augen und Mund
vermochte er nicht zu fin-
den, und zeigte sie wie-
der in derjenigen Ent-
fernung, nüe sie beim
Gesicht des Menschen an-
geordnet sind.
Auch als ihm eine
kleine, aber gut ausge-
führte Nachbildung einer
Katze aus Bronze beinahe
zwei Monate nach Be-
ginn der Sehübungen
vorgehalten wurde, nach-
dem er also schon viel-
fache Erfahrungen ge-
sammelt und auch eine
lebende Katze oft sicher er-
kannt hatte, war es ihm
durchaus unmöglich, sich
zu orieutiren. Selbst als
man ihm die Figur in
die Hand gab, hatte er
keine Ahnung von ihrer
Bedeutung und sagte:
„Es ist ein Leuchter."
Auch bei wiederholten
Versuchen blieb er bei
seiner Behauptung, und
selbst als ihm die ein-
zelnen Theile der Figur
genannt worden waren,
und er sie befühlt hatte,
konnte er sich lange Zeit
hindurch nicht dazu ver-
stehen, daß das kleine,
schwere, harte Ding eine
Katze darstellen sollte.
Bemerkenswerth sind
auch die Prüfungen mit
Farben. Als dem Ope-
rirten gleich in den ersten
Tagen größere farbige
Tuchstücke vorgelegt wur-
den, antwortete er auf
die Frage, welche Farbe
sie hatten, immer nur:
„Das ist ein Ding." Er
hatte also durchaus keine
Vorstellung von dem, was
man unter Farbe ver-
steht. Deshalb mußte
der Knabe erst regelrecht
in dem Erkennen der
Farben Blau, Roth,
Grün und Gelb unter-
richtet werden. Gelb
lernte er zuerst kennen,
aber erst nach sechs Ta-
gen war er im Stande,
alle Farben richtig zu
nennen. Mit diesen Be-
obachtungen stehen die
Ergebnisse ini Einklang,
die Preyer über die Far-
benunterscheidung bei
Kindern in den ersten
Lebensjahren gewonnen
hat. Dieser Forscher fand,
daß vor dem vollendeten
zweiten Lebensjahr eine
irgendwie sichere Farbenkenntniß nicht existirt, ja er gibt
an, daß Blau und Grün wohl erst mit dem vollendeten
dritten Lebensjahre sicher erkannt werden.
Nachdem der operirte Knabe alle Farben auch an
ganz kleinen Objekten längst genau erkannte, wurde
ihm die Aufgabe gestellt, die hellste Farbenprobe von
Gelb, Roth, Blau und Grün herauszusuchen. Er schien
zuerst gar nicht zu begreifen, was man von ihm ver-
langte, und griff endlich nach wiederholten Aufforde-
rungen nach dem ganz dunklen Grün. Als ihm an
einer Probe von Weiß und Schwarz der Begriff von
Hell und Dunkel klar gemacht worden war und ihm
Römische Jungfrau, ihre Kinderspicksachen opfernd. Nach einem Gemälde von A. Seifoni. (S. 22)
LM 1.
war seine Antwort so zögernd, daß er offenbar noch
nicht vollständig von der Wahrheit der Erscheinung
überzeugt war.
Ungefähr neun Wochen später wurde er zum ersten
Male vor einen großen Wandspiegel gestellt, so daß
er nun seine ganze Figur uud alle seine Körper- und
Gliederbcwegungen sehen konnte. Er wurde nun ganz
sich selbst überlassen. Zuerst wußte er augenscheinlich
nicht, was das Alles zu
bedeuten hatte. Er be¬
trachtete aufmerksam sein
Bild, bemerkte auch die
Bewegungen, die das
Bild bei seinen eigenen
Bewegungen machte. Als
er jedoch nach längerer
Zeit gefragt wurde, was
er sähe, antwortete er
zuerst gar nicht, nach
wiederholten energischen
Aufforderungen sagte er
endlich: „Einen Spie¬
gel." Auf die Frage,
was er denn im Spie¬
gel erblicke, wußte er
zunächst wieder nicht zu
antworten, erst nach
längerer Zeit und immer
wieder erneuter Betrach¬
tung seines Bildes sagte
er: „Einen Jungen."
Hiermit war er also
üöer das Vorhandensein
eines Jungen im Spie¬
gelunterrichtet und stellte
nun selbst, sich wieder
allen: überlassen, weitere
Untersuchungen an. Er
bewegte sich vordem Spie¬
gel hin und her, näherte
und entfernte sich von
ihm und glaubte schlie߬
lich , daß sein Partner
im Spiegel mit ihm spie¬
len wollte. Er lachte,
rief dein Spiegelbilde
„Kukuk!" und „Kikeriki!"
zu, benahm sich über¬
haupt ganz so, wie er es
zu machen pflegte, wenn
er mit einem anderen
Kinde spielte.
Wenn er sich etwas
vom Spiegel entfernte
und dabei sein Bild be¬
trachtete, soriefer: „Jetzt
geht er fort." Und wenn
er sich wieder näherte, so
sagte er: „Jetzt kommt
er wieder!"
Er erhielt eine Sem¬
mel in die Hand, und
auf die Aufforderung,
auch dem Jungen im
Spiegel davon zu reichen,
versuchte er das lange
vergeblich. Wenn hier¬
bei seine Hand sich dem
Spiegelglas näherte, war
er zuerst sehr erstaunt,
im spiegel ebenfalls eine
Hand näher kommen zu
sehen, so daß er zu glau¬
ben schien, daß sein Part-
ner nut ihm spielen wolle.
Kam er dem Rande des
Spiegels gegenüber, so
daß nur ein Theil seiner
Figur sichtbar blieb, so
gab er freiwillig an:
„Jetzt kriecht er 'rein!"
Tann suchte er auch mit
den Händen zu ergrün¬
den, wohin der Junge
gekrochen sei, indem er
die Grenze zivischeu Rah-
men und Spiegel abtastete. Ueber eine Stunde lang
beschäftigte sich der Knabe mit dem größten Interesse
mit seinem Partner im Spiegel, sprach mit ihm, suchte
ihn zu greifen, ohne daß er die Einsicht in die wahre
Sachlage gewann. Erst während der nächsten Tage be-
griff er allmülig, daß, wenn der Junge im Spiegel etwas
thun solle, er es ihm erst vormachen müsse. Forderte
man ihn daher auf, dem Jungen im Spiegel die Mütze
abzunehmen, so griff er zwar zuweilen noch nach dem
Spiegel, später aber kam er darauf, sich selbst die Mütze
abzunehmen. Aber auch so wußte er immer noch nicht
zu sagen, wer der Junge im Spiegel eigentlich sei.
Erst allmälig lernte er begreifen, daß er sein Spiegel-
bild erblickte und nannte endlich, nach dem Namen
der Person im Spiegel gefragt, seinen eigenen Namen.
Wem wäre bei der Darlegung dieser Versuche nicht
unwillkürlich der Vergleich mit den Beobachtungen
gekommen, die inan so oft bei kleinen Kindern vor dem
Spiegel anzustellen Gelegenheit hat. Greifen auch sie
nicht nach dem Spiegelbild? Wenden und drehen sie
sich nicht vor ihm, rufen sie ihm nicht zu und sind sie
nicht ganz erstaunt, wenn plötzlich Theile ihres Bildes
verschwinden?
Ungefähr zwei Monate nach Anfang der Sehprü-
fungen wurde dem Knaben ein farbiges Porträt von
einem kleinen Kinde in fast halber natürlicher Größe
unter Glas gezeigt. Zuerst wußte er sich das Objekt
nicht zu deuten, schließlich nannte er es einen Spiegel,
und gefragt, was er denn im Spiegel sähe, antwortete
er nach einiger Zeit: „Eine Katze." Erst bei der vier-
ten Untersuchung kam er zu der Ansicht, daß „ein
Junge darin sei". Auf eine gegebene Aufforderung
mußte er Kopf und Haar richtig zu zeigen, bei den
übrigen Theilen des Bildes wurde er aber unsicher.
Wie sehr er von einer richtigen Erkenntnis; entfernt
war, zeigte er dadurch, daß er auch Hier den Mund
öffnete, in der Hoffnung, daß das Bild ein Gleiches
thun würde.
Eine Puppe von 30 Centimeter Länge, die mit
einem weiß und rothgestreiften Kleide angethan war,
nannte er bei der ersten
Prüfung „ein Halstuch".
Später zeigte er auch
hier auf eine Aufforde-
rung ganz richtig das
Haar, alle anderen Theile
des Kopfes aber, wie
Nase, Augen und Mund
vermochte er nicht zu fin-
den, und zeigte sie wie-
der in derjenigen Ent-
fernung, nüe sie beim
Gesicht des Menschen an-
geordnet sind.
Auch als ihm eine
kleine, aber gut ausge-
führte Nachbildung einer
Katze aus Bronze beinahe
zwei Monate nach Be-
ginn der Sehübungen
vorgehalten wurde, nach-
dem er also schon viel-
fache Erfahrungen ge-
sammelt und auch eine
lebende Katze oft sicher er-
kannt hatte, war es ihm
durchaus unmöglich, sich
zu orieutiren. Selbst als
man ihm die Figur in
die Hand gab, hatte er
keine Ahnung von ihrer
Bedeutung und sagte:
„Es ist ein Leuchter."
Auch bei wiederholten
Versuchen blieb er bei
seiner Behauptung, und
selbst als ihm die ein-
zelnen Theile der Figur
genannt worden waren,
und er sie befühlt hatte,
konnte er sich lange Zeit
hindurch nicht dazu ver-
stehen, daß das kleine,
schwere, harte Ding eine
Katze darstellen sollte.
Bemerkenswerth sind
auch die Prüfungen mit
Farben. Als dem Ope-
rirten gleich in den ersten
Tagen größere farbige
Tuchstücke vorgelegt wur-
den, antwortete er auf
die Frage, welche Farbe
sie hatten, immer nur:
„Das ist ein Ding." Er
hatte also durchaus keine
Vorstellung von dem, was
man unter Farbe ver-
steht. Deshalb mußte
der Knabe erst regelrecht
in dem Erkennen der
Farben Blau, Roth,
Grün und Gelb unter-
richtet werden. Gelb
lernte er zuerst kennen,
aber erst nach sechs Ta-
gen war er im Stande,
alle Farben richtig zu
nennen. Mit diesen Be-
obachtungen stehen die
Ergebnisse ini Einklang,
die Preyer über die Far-
benunterscheidung bei
Kindern in den ersten
Lebensjahren gewonnen
hat. Dieser Forscher fand,
daß vor dem vollendeten
zweiten Lebensjahr eine
irgendwie sichere Farbenkenntniß nicht existirt, ja er gibt
an, daß Blau und Grün wohl erst mit dem vollendeten
dritten Lebensjahre sicher erkannt werden.
Nachdem der operirte Knabe alle Farben auch an
ganz kleinen Objekten längst genau erkannte, wurde
ihm die Aufgabe gestellt, die hellste Farbenprobe von
Gelb, Roth, Blau und Grün herauszusuchen. Er schien
zuerst gar nicht zu begreifen, was man von ihm ver-
langte, und griff endlich nach wiederholten Aufforde-
rungen nach dem ganz dunklen Grün. Als ihm an
einer Probe von Weiß und Schwarz der Begriff von
Hell und Dunkel klar gemacht worden war und ihm
Römische Jungfrau, ihre Kinderspicksachen opfernd. Nach einem Gemälde von A. Seifoni. (S. 22)