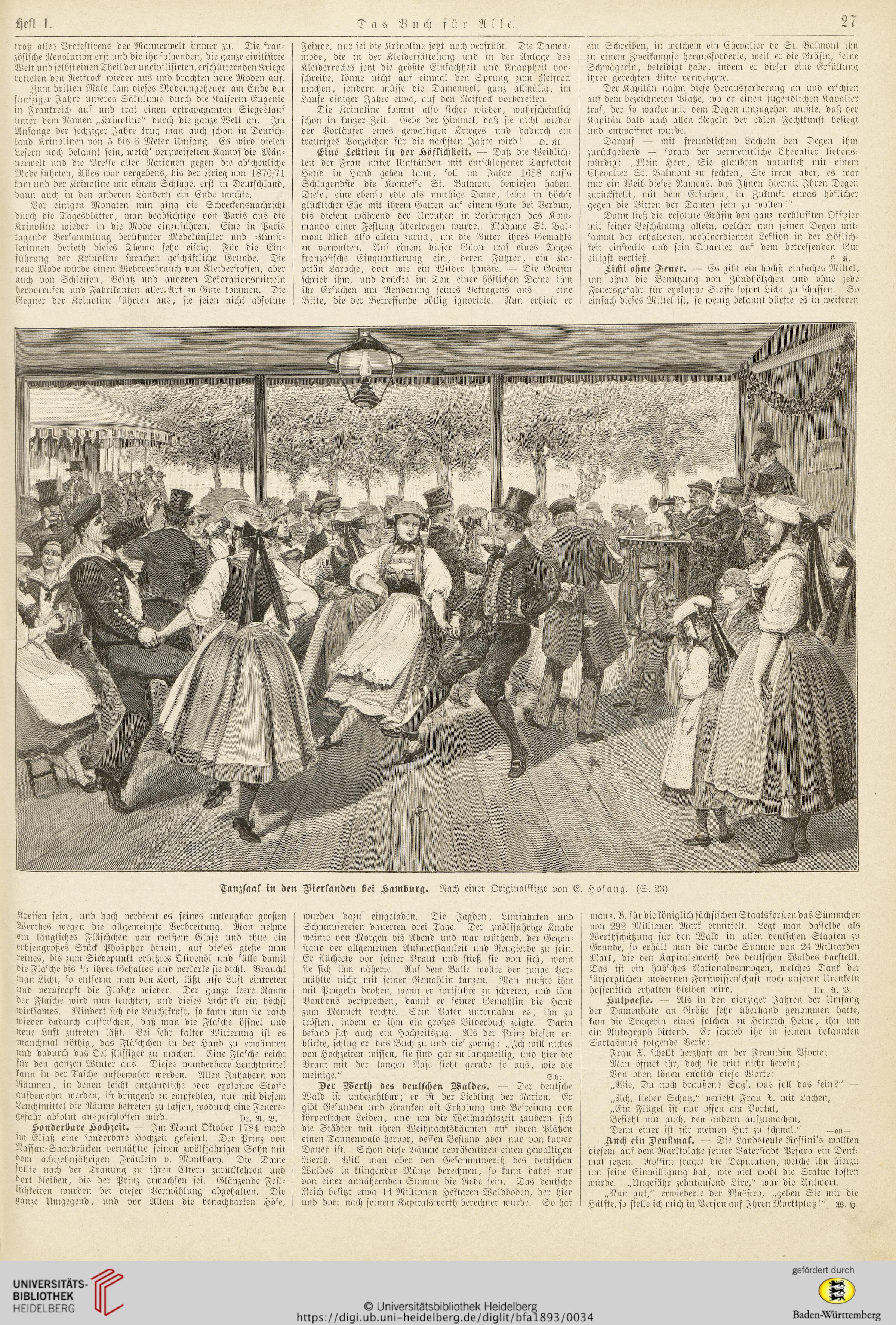Ljrst !.
Das B ii ch s ii r A l l e.
trotz alles Protestirens der Männerwelt iminer zu. Die fran-
zösische Revolution erst und die ihr folgenden, die ganze civilisirte
Welt und selbst einen Theil der nncivilisirten, erschütternden Kriege
rotteten den Reifrock wieder aus und brachten neue Moden auf.
Zum dritten Male kam dieses Modeungeheuer am Ende der
fünfziger Jahre unseres Säkulums durch die Kaiserin Eugenie
in Frankreich auf und trat einen extravaganten Siegeslauf
unter dem Namen „Krinoline" durch die ganze Welt an. Im
Anfänge der sechziger Jahre trug inan auch schon in Deutsch-
land Krinolinen von 5 bis 6 Meter Umfang. Es wird vielen
Lesern noch bekannt sein, welch' verzweifelten Kampf die Män-
nerwelt und die Presse aller Nationen gegen die abscheuliche
Mode führten, Alles war vergebens, bis der Krieg von 1870/71
kam und der Krinoline mit einem Schlage, erst in Deutschland,
dann auch in den anderen Ländern ein Ende machte.
Vor einigen Monaten nun ging die Schreckensnachricht
durch die Tagesblätter, man beabsichtige von Paris aus die
Krinoline wieder in die Mode cinzuführen. Eine in Paris
tagende Versammlung berühmter Modekünstler und -Kunst
lerinnen berieth dieses Thema sehr eifrig. Für die Ein-
führung der Krinoline sprachen geschäftliche Gründe. Die
neue Mode würde einen Mehrverbrauch von Kleiderstoffen, aber
auch von Schleifen, Besatz und anderen Dekorationsmitteln
Hervorrufen und Fabrikanten aller. Art zu Gute kommen. Die
Gegner der Krinoline führten aus, sie seien nicht absolute
Feinde, nur sei die Krinoline jetzt noch verfrüht. Die Damen-
mode, die in der Kleiderfältelung und in der Anlage des
Kleiderrockes jetzt die größte Einfachheit und Knappheit vor-
schreibe, könne nicht auf einmal den Sprung zum Reifrock
machen, sondern müsse die Damenwelt ganz allmälig, im
Laufe einiger Jahre etwa, auf den Reifrock vorbereiten.
Die Krinoline kommt also sicher wieder, wahrscheinlich
schon in kurzer Zeit. Gebe der Himmel, daß sie nicht wieder
der Vorläufer eines gewaltigen Krieges und dadurch ein
trauriges Vorzeichen für die nächsten Jahre wird! O. Kl
Eine Lektion in der Köfkichkeit. — Daß die Weiblich
keit der Frau unter Umständen mit entschlossener Tapferkeit
Hand in Hand gehen kann, soll im Jahre 1688 nuf's
Schlagendste die Komtesse St. Valmont bewiesen haben.
Diese, eine ebenso edle als muthige Dame, lebte in höchst
glücklicher Ehe mit ihrem Gatten auf einem Gute bei Verdun,
bis diesem während der Unruhen in Lothringen das Kom-
mando einer Festung übertragen wurde. Madame St. Bal
inont blieb also allein zurück, um die Guter ihres Gemahls
zu verwalten. Auf einem dieser Güter traf eines Tages
französische Einquartierung ein, deren Führer, ein Ka-
pitän Laroche, dort wie ein Wilder hauste. Dis Gräfin
schrieb ihm, und drückte im Ton einer höflichen Dame ihm
ihr Ersuchen um Aenderung seines Betragens aus — eine
Bitte, die der Betreffende völlig ignorirte. Nun erhielt er
ein Schreiben, in welchem ein Chevalier de St. Valmont ihn
zu einem Zweikampfe herausforderte, iveil er die Gräfin, seine
Schwägerin, beleidigt habe, indem er dieser eine Erfüllung
ihrer gerechten Bitte verweigere.
Der Kapitän nahm diese Herausforderung an und erschien
auf dem bezeichneten Platze, wo er einen jugendlichen Kavalier
traf, der so wacker mit dem Degen umzugehen wußte, daß der
Kapitän bald nach allen Regeln der edlen Fechtkunst besiegt
und entwaffnet wurde.
Darauf — mit freundlichem Lächeln den Degen ihm
zurückgebend — sprach der vermeintliche Chevalier liebens-
würdig- „Mein Herr, Sie glaubten natürlich mit einem
Chevalier St. Balmont zu fechten, Sie irren aber, es war-
um- ein Weib dieses Namens, das Ihnen hiermit Ihren Degen
zurückstellt, mit dem Ersuchen, in Zukunft etwas höflicher
gegen die Bitten der Damen sein zu wollen!"
Dann ließ die resolute Gräfin den ganz verblüfften Offizier
init seiner Beschämung allein, welcher nun seinen Degen mit-
sammt der erhaltenen, wohlverdienten Lektion in der Höflich
keit einsteckte und sein Quartier auf dem betreffenden Gut
eiligst verließ. K. R.
Licht ohne Aeuer. — Es gibt ein höchst einfaches Mittel,
uni ohne die Benutzung von Zündhölzchen und ohne jede
FeuerSgefahr für explosive Stoffe sofort Licht zu schaffen. So
einfach dieses Mittel ist, so wenig bekannt dürfte es in weiteren
Kreisen sein, und doch verdient es seines unleugbar großen
Werthss wegen die allgemeinste Verbreitung. Man nehme
ein längliches Fläschchen von weißem Glase und thue ein
erbsengroßes Stück Phosphor hinein, auf dieses gieße man
reines, bis zum Siedepunkt erhitztes Olivenöl und fülle damit
die Flasche bis '/z ihres Gehaltes und verkorke sie dicht. Braucht
inan Licht, so entfernt man den Kork, läßt also Luft eintreten
und verpfropft die Flasche wieder. Der ganze leere Raum
der Flasche wird nun leuchten, und dieses Licht ist ein höchst
wirksames. Mindert sich die Leuchtkraft, so kann man sie rasch
wieder dadurch auffrischen, daß man die Flasche öffnet und
neue Luft zutreten läßt. Bei sehr kalter Witterung ist es
manchmal nöthig, das Fläschchen in der Hand zu erwärmen
und dadurch das Oel flüssiger zu machen. Eine Flasche reicht
für den ganzen Winter aus. Dieses wunderbare Leuchtmittel
kann in der Tasche aufbewahrt werden. Allen Inhabern von
Räumen, in denen leicht entzündliche oder explosive Stoffe
aufbewahrt werden, ist dringend zu empfehlen, nur mit diesem
Leuchtmittel die Räume betreten zu lassen, wodurch eins Feuers-
gefahr absolut ausgeschlossen wird. vr. A B.
Sonderbare L>ochzeit. - Im Monat Oktober 1784 ward
iin Elsaß eine sonderbare Hochzeit gefeiert. Der Prinz von
Nassau-Saarbrücken vermählte seinen zwölfjährigen Sohn mit
s>em achtzehnjährigen Fräulein v. Montbary. Die Dame
sollte nach der Trauung zu ihren Eltern zurückkehren und
dort bleiben, bis der Prinz erwachsen sei. Glänzende Fest-
iichkeiten wurden bei dieser Vermählung nbgehalten. Die
ganze Umgegend, und vor Allem die benachbarten Höfe,
wurden dazu eingsladen. Die Jagden, Luftfahrten und
Schmausereien dauerten drei Tage. Der zwölfjährige Knabe
weinte non Morgen bis Abend und war wüthend, der Gegen-
stand der allgemeinen Aufmerksamkeit und Neugierde zu sein.
Er flüchtete vor seiner Braut und stieß sie von sich, wenn
sie sich ihm näherte. Auf dem Balle wollte der junge Ver-
mählte nicht mit seiner Gemahlin tanzen. Man mußte ihm
mit Prügeln drohen, wenn er fortführe zu schreien, und ihm
Bonbons versprechen, damit er seiner Gemahlin die Hand
zum Menuett reichte. Sein Vater unternahm es, ihn zu
trösten, indem er ihm ein großes Bilderbuch zeigte. Darin
befand sich auch ein Hochzeitszug. Als der Prinz diesen er-
blickte, schlug er das Buch zu und rief zornig: „Ich will nichts
von Hochzeiten wissen, sie sind gar zu langweilig, und hier die
Braut mit der langen Nase sieht gerade so aus, wie die
meinige." Schr.
Der Werth des deutschen Waldes. — Der deutsche
Wald ist unbezahlbar: er ist der Liebling der Nation. Er
gibt Gesunden und Kranken ost Erholung und Befreiung von
körperlichen Leiden, und um die Weihnachtszeit zaubern sich
die Städter mit ihren Weihnachtsbäumen auf ihreir Plätzen
einen Tannenwald hervor, dessen Bestand aber nur von kurzer
Dauer ist. Schon diese Bäume repräsentiren einen gewaltigen
Werth. Will man aber den Gesammtwerth des deutschen
Waldes in klingender Münze berechnen, so kann dabei nur
von einer annähernden Summe die Rede sein. Das deutsche
Reich besitzt etwa 14 Millionen Hektaren Waldboden, der hier
und dort nach seinem Kapitalswerth berechnet wurde. So hat
mauz. B. für die königlich sächsischen Staatsforsten das Sümmchen
von 292 Millionen Mark ermittelt. Legt man dasselbe als
Werthschätzung für den Wald in allen deutschen Staaten zu
Grunde, so erhält man die runde Summe von 24 Milliarden
Mark, die den Kapitalswerth des deutschen Waldes darstellt.
Das ist ein hübsches Nationalvermögen, welches Dank der
fürsorglichen modernen Forstwissenschaft noch unseren Urenkeln
hoffentlich erhalten bleiben wird. in-. A. B.
Kuiplicsie. — Als in den vierziger Jahren der Umfang
der Damenhüte an Größe sehr überhand genommen hatte,
kam die Trägerin eines solchen zu Heinrich Heine, ihn um
ein Autograph bittend. Er schrieb ihr in seinem bekannten
Sarkasmus folgende Verse:
Frau L. schellt herzhaft an der Freundin Pforte;
Man öffnet ihr, doch sie tritt nicht herein;
Von oben tönen endlich diese Worte:
„Wie, Du noch draußen? Sag', was soll das sein?" -
„Ach, lieber Schatz," versetzt Frau .L. nut Lachen,
„Ein Flügel ist nur offen am Portal,
Befiehl nur auch, den andern aufzumachen,
Denn einer ist für meinen Hut zu schmal." —dn—
Auch ein Aeukmak. — Die Landsleute Rossini's wollten
diesem auf dem Marktplatze seiner Vaterstadt Pesaro ein Denk-
mal setzen. Rossini fragte dis Deputation, welche ihn hierzu
um seine Einwilligung bat, wie viel wohl die Statue kosten
würde. „Ungefähr zehntausend Lire," war die Antwort.
„Nun gut," crwiederte der Maestro, „geben Sie mir die
Hälfte, so stelle ich mich in Person auf Ihren Marktplatz!" WH.
Das B ii ch s ii r A l l e.
trotz alles Protestirens der Männerwelt iminer zu. Die fran-
zösische Revolution erst und die ihr folgenden, die ganze civilisirte
Welt und selbst einen Theil der nncivilisirten, erschütternden Kriege
rotteten den Reifrock wieder aus und brachten neue Moden auf.
Zum dritten Male kam dieses Modeungeheuer am Ende der
fünfziger Jahre unseres Säkulums durch die Kaiserin Eugenie
in Frankreich auf und trat einen extravaganten Siegeslauf
unter dem Namen „Krinoline" durch die ganze Welt an. Im
Anfänge der sechziger Jahre trug inan auch schon in Deutsch-
land Krinolinen von 5 bis 6 Meter Umfang. Es wird vielen
Lesern noch bekannt sein, welch' verzweifelten Kampf die Män-
nerwelt und die Presse aller Nationen gegen die abscheuliche
Mode führten, Alles war vergebens, bis der Krieg von 1870/71
kam und der Krinoline mit einem Schlage, erst in Deutschland,
dann auch in den anderen Ländern ein Ende machte.
Vor einigen Monaten nun ging die Schreckensnachricht
durch die Tagesblätter, man beabsichtige von Paris aus die
Krinoline wieder in die Mode cinzuführen. Eine in Paris
tagende Versammlung berühmter Modekünstler und -Kunst
lerinnen berieth dieses Thema sehr eifrig. Für die Ein-
führung der Krinoline sprachen geschäftliche Gründe. Die
neue Mode würde einen Mehrverbrauch von Kleiderstoffen, aber
auch von Schleifen, Besatz und anderen Dekorationsmitteln
Hervorrufen und Fabrikanten aller. Art zu Gute kommen. Die
Gegner der Krinoline führten aus, sie seien nicht absolute
Feinde, nur sei die Krinoline jetzt noch verfrüht. Die Damen-
mode, die in der Kleiderfältelung und in der Anlage des
Kleiderrockes jetzt die größte Einfachheit und Knappheit vor-
schreibe, könne nicht auf einmal den Sprung zum Reifrock
machen, sondern müsse die Damenwelt ganz allmälig, im
Laufe einiger Jahre etwa, auf den Reifrock vorbereiten.
Die Krinoline kommt also sicher wieder, wahrscheinlich
schon in kurzer Zeit. Gebe der Himmel, daß sie nicht wieder
der Vorläufer eines gewaltigen Krieges und dadurch ein
trauriges Vorzeichen für die nächsten Jahre wird! O. Kl
Eine Lektion in der Köfkichkeit. — Daß die Weiblich
keit der Frau unter Umständen mit entschlossener Tapferkeit
Hand in Hand gehen kann, soll im Jahre 1688 nuf's
Schlagendste die Komtesse St. Valmont bewiesen haben.
Diese, eine ebenso edle als muthige Dame, lebte in höchst
glücklicher Ehe mit ihrem Gatten auf einem Gute bei Verdun,
bis diesem während der Unruhen in Lothringen das Kom-
mando einer Festung übertragen wurde. Madame St. Bal
inont blieb also allein zurück, um die Guter ihres Gemahls
zu verwalten. Auf einem dieser Güter traf eines Tages
französische Einquartierung ein, deren Führer, ein Ka-
pitän Laroche, dort wie ein Wilder hauste. Dis Gräfin
schrieb ihm, und drückte im Ton einer höflichen Dame ihm
ihr Ersuchen um Aenderung seines Betragens aus — eine
Bitte, die der Betreffende völlig ignorirte. Nun erhielt er
ein Schreiben, in welchem ein Chevalier de St. Valmont ihn
zu einem Zweikampfe herausforderte, iveil er die Gräfin, seine
Schwägerin, beleidigt habe, indem er dieser eine Erfüllung
ihrer gerechten Bitte verweigere.
Der Kapitän nahm diese Herausforderung an und erschien
auf dem bezeichneten Platze, wo er einen jugendlichen Kavalier
traf, der so wacker mit dem Degen umzugehen wußte, daß der
Kapitän bald nach allen Regeln der edlen Fechtkunst besiegt
und entwaffnet wurde.
Darauf — mit freundlichem Lächeln den Degen ihm
zurückgebend — sprach der vermeintliche Chevalier liebens-
würdig- „Mein Herr, Sie glaubten natürlich mit einem
Chevalier St. Balmont zu fechten, Sie irren aber, es war-
um- ein Weib dieses Namens, das Ihnen hiermit Ihren Degen
zurückstellt, mit dem Ersuchen, in Zukunft etwas höflicher
gegen die Bitten der Damen sein zu wollen!"
Dann ließ die resolute Gräfin den ganz verblüfften Offizier
init seiner Beschämung allein, welcher nun seinen Degen mit-
sammt der erhaltenen, wohlverdienten Lektion in der Höflich
keit einsteckte und sein Quartier auf dem betreffenden Gut
eiligst verließ. K. R.
Licht ohne Aeuer. — Es gibt ein höchst einfaches Mittel,
uni ohne die Benutzung von Zündhölzchen und ohne jede
FeuerSgefahr für explosive Stoffe sofort Licht zu schaffen. So
einfach dieses Mittel ist, so wenig bekannt dürfte es in weiteren
Kreisen sein, und doch verdient es seines unleugbar großen
Werthss wegen die allgemeinste Verbreitung. Man nehme
ein längliches Fläschchen von weißem Glase und thue ein
erbsengroßes Stück Phosphor hinein, auf dieses gieße man
reines, bis zum Siedepunkt erhitztes Olivenöl und fülle damit
die Flasche bis '/z ihres Gehaltes und verkorke sie dicht. Braucht
inan Licht, so entfernt man den Kork, läßt also Luft eintreten
und verpfropft die Flasche wieder. Der ganze leere Raum
der Flasche wird nun leuchten, und dieses Licht ist ein höchst
wirksames. Mindert sich die Leuchtkraft, so kann man sie rasch
wieder dadurch auffrischen, daß man die Flasche öffnet und
neue Luft zutreten läßt. Bei sehr kalter Witterung ist es
manchmal nöthig, das Fläschchen in der Hand zu erwärmen
und dadurch das Oel flüssiger zu machen. Eine Flasche reicht
für den ganzen Winter aus. Dieses wunderbare Leuchtmittel
kann in der Tasche aufbewahrt werden. Allen Inhabern von
Räumen, in denen leicht entzündliche oder explosive Stoffe
aufbewahrt werden, ist dringend zu empfehlen, nur mit diesem
Leuchtmittel die Räume betreten zu lassen, wodurch eins Feuers-
gefahr absolut ausgeschlossen wird. vr. A B.
Sonderbare L>ochzeit. - Im Monat Oktober 1784 ward
iin Elsaß eine sonderbare Hochzeit gefeiert. Der Prinz von
Nassau-Saarbrücken vermählte seinen zwölfjährigen Sohn mit
s>em achtzehnjährigen Fräulein v. Montbary. Die Dame
sollte nach der Trauung zu ihren Eltern zurückkehren und
dort bleiben, bis der Prinz erwachsen sei. Glänzende Fest-
iichkeiten wurden bei dieser Vermählung nbgehalten. Die
ganze Umgegend, und vor Allem die benachbarten Höfe,
wurden dazu eingsladen. Die Jagden, Luftfahrten und
Schmausereien dauerten drei Tage. Der zwölfjährige Knabe
weinte non Morgen bis Abend und war wüthend, der Gegen-
stand der allgemeinen Aufmerksamkeit und Neugierde zu sein.
Er flüchtete vor seiner Braut und stieß sie von sich, wenn
sie sich ihm näherte. Auf dem Balle wollte der junge Ver-
mählte nicht mit seiner Gemahlin tanzen. Man mußte ihm
mit Prügeln drohen, wenn er fortführe zu schreien, und ihm
Bonbons versprechen, damit er seiner Gemahlin die Hand
zum Menuett reichte. Sein Vater unternahm es, ihn zu
trösten, indem er ihm ein großes Bilderbuch zeigte. Darin
befand sich auch ein Hochzeitszug. Als der Prinz diesen er-
blickte, schlug er das Buch zu und rief zornig: „Ich will nichts
von Hochzeiten wissen, sie sind gar zu langweilig, und hier die
Braut mit der langen Nase sieht gerade so aus, wie die
meinige." Schr.
Der Werth des deutschen Waldes. — Der deutsche
Wald ist unbezahlbar: er ist der Liebling der Nation. Er
gibt Gesunden und Kranken ost Erholung und Befreiung von
körperlichen Leiden, und um die Weihnachtszeit zaubern sich
die Städter mit ihren Weihnachtsbäumen auf ihreir Plätzen
einen Tannenwald hervor, dessen Bestand aber nur von kurzer
Dauer ist. Schon diese Bäume repräsentiren einen gewaltigen
Werth. Will man aber den Gesammtwerth des deutschen
Waldes in klingender Münze berechnen, so kann dabei nur
von einer annähernden Summe die Rede sein. Das deutsche
Reich besitzt etwa 14 Millionen Hektaren Waldboden, der hier
und dort nach seinem Kapitalswerth berechnet wurde. So hat
mauz. B. für die königlich sächsischen Staatsforsten das Sümmchen
von 292 Millionen Mark ermittelt. Legt man dasselbe als
Werthschätzung für den Wald in allen deutschen Staaten zu
Grunde, so erhält man die runde Summe von 24 Milliarden
Mark, die den Kapitalswerth des deutschen Waldes darstellt.
Das ist ein hübsches Nationalvermögen, welches Dank der
fürsorglichen modernen Forstwissenschaft noch unseren Urenkeln
hoffentlich erhalten bleiben wird. in-. A. B.
Kuiplicsie. — Als in den vierziger Jahren der Umfang
der Damenhüte an Größe sehr überhand genommen hatte,
kam die Trägerin eines solchen zu Heinrich Heine, ihn um
ein Autograph bittend. Er schrieb ihr in seinem bekannten
Sarkasmus folgende Verse:
Frau L. schellt herzhaft an der Freundin Pforte;
Man öffnet ihr, doch sie tritt nicht herein;
Von oben tönen endlich diese Worte:
„Wie, Du noch draußen? Sag', was soll das sein?" -
„Ach, lieber Schatz," versetzt Frau .L. nut Lachen,
„Ein Flügel ist nur offen am Portal,
Befiehl nur auch, den andern aufzumachen,
Denn einer ist für meinen Hut zu schmal." —dn—
Auch ein Aeukmak. — Die Landsleute Rossini's wollten
diesem auf dem Marktplatze seiner Vaterstadt Pesaro ein Denk-
mal setzen. Rossini fragte dis Deputation, welche ihn hierzu
um seine Einwilligung bat, wie viel wohl die Statue kosten
würde. „Ungefähr zehntausend Lire," war die Antwort.
„Nun gut," crwiederte der Maestro, „geben Sie mir die
Hälfte, so stelle ich mich in Person auf Ihren Marktplatz!" WH.