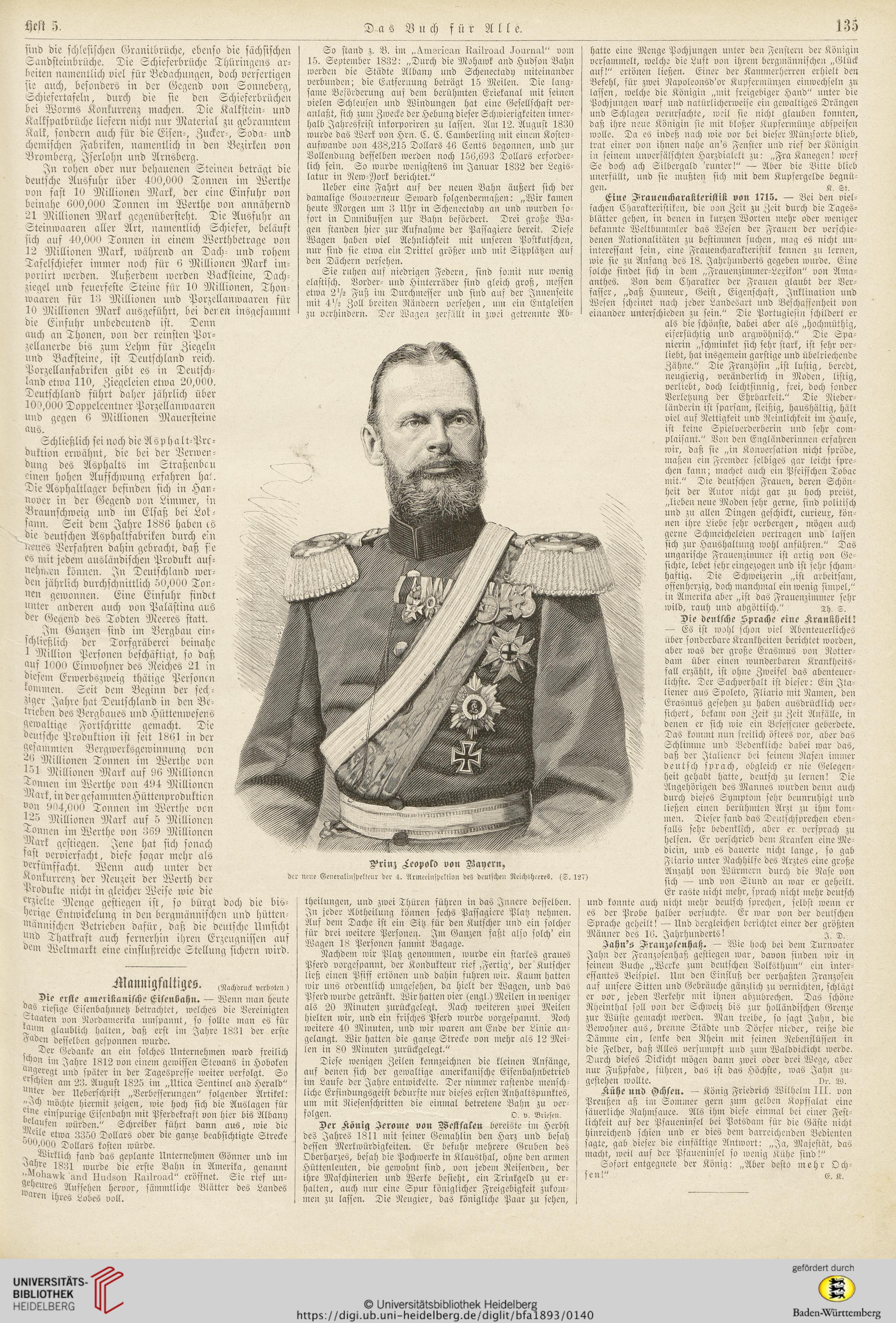Ljrst 5.
Da s Buch für All e.
sind die schlesischen Granitbrüche, ebenso die sächsischen
Sandsteinbrüche. Die Schieferbrüche Thüringens ar-
beiten namentlich viel für Bedachungen, doch verfertigen
sie auch, besonders in der Gegend von Sonneberg,
Schiefertafeln, durch die sie den Schieferbrüchen
bei Worms Konkurrenz »rachen. Die Kalkstein- und
Kalkspatbrüche liefern nicht nur Material zu gebranntem
Kalk, sondern auch für die Eisen-, Zucker-, Soda- und
chemischen Fabriken, namentlich in den Bezirken von
Bromberg, Iserlohn und Arnsberg.
In rohen oder nur behauenen Steinen beträgt die
deutsche Ausfuhr über 400,000 Tonnen im Werthe
von fast 10 Millionen Mark, der eine Einfuhr von
beinahe 600,000 Tonnen im Werthe von annähernd
21 Millionen Mark gcgenübersteht. Die Ausfuhr an
Steinwaaren aller Art, namentlich Schiefer, beläuft
sich auf 40,000 Tonnen in einem Werthbetrage von
12 Millionen Mark, während an Dach- und rohem
Tafelschiefer immer noch für 6 Millionen Mark im-
portirt werden. Außerdem werden Backsteine, Dach-
ziegel und feuerfeste Steiue für 10 Millionen, Thon-
waaren für 13 Millionen und Porzellanwaaren für
10 Millionen Mark ausgeführt, bei deren insgesammt
die Einfuhr unbedeutend ist. Denn
auch an Thonen, von der reinsten Por-
zellanerde bis zum Lehm für Ziegeln
und Backsteine, ist Deutschland reich.
Porzellanfabriken gibt es in Deutsch¬
land etwa 110, Ziegeleien etwa 20,000.
Deutschland führt daher jährlich über
100,000 Doppelcentner Porzellanwaaren
und gegen 6 Millionen Mauersteine
aus.
Schließlich sei noch die Asphalt-Prc-
duktion erwähnt, die bei der Verwen-
dung des Asphalts im Straßenbau
einen hohen Aufschwung erfahren hat.
Die Asphaltlager befinden sich in Han-
nover in der Gegend von Limmer, in
Braunschweig und in: Elsaß bei Lol -
sann. Seit dem Jahre 1886 haben cs
die deutschen Asphaltfabriken durch ein
Neues Verfahren dahin gebracht, daß sie
es mit jedem ausländischen Produkt aus-
nehmen können. In Deutschland wer¬
den jährlich durchschnittlich 50,000 Ton¬
nen gewonnen. Eine Einfuhr findet
unter anderen auch von Palästina auS
der Gegend des Todten Meeres statt.
Im Ganzen sind im Bergbau ein-
schließlich der Torfgräberei beinahe
1 Million Personen beschäftigt, so daß
auf 1000 Einwohner des Reiches 21 in
diesem Erwerbszweig thätige Personen
kommen. Seit dem Beginn der sech-
ziger Jahre hat Deutschland in den Be¬
trieben des Bergbaues und Hüttenwesens
gewaltige Fortschritte gemacht. Die
deutsche Produktion ist seit 1861 in der
gejammten Bergwerksgewinnung von
Millionen Tonnen im Werthe von
kf>1 Millionen Mark auf 96 Millionen
Wonnen im Werthe von 494 Millionen
Mark, indergesammtenHüttenproduktion
von 904,000 Tonnen im Werthe von
k25 Millionen Mark auf 5 Millionen
Wonnen ine Werthe von 369 Millionen
Mark gestiegen. Jene hat sich sonach
saft vervierfacht, diese sogar mehr als
verfünffacht. Wenn auch unter der
Konkurrenz der Neuzeit der Werth der
-Produkte nicht in gleicher Weise wie die
frzielte Menge gestiegen ist, so bürgt doch die bis-
herige Entwickelung in den bergmännischen und hütten-
vuinnischen Betrieben dafür, daß die deutsche Unisicht
und Thatkraft auch fernerhin ihren Erzeugnissen auf
dem Weltmarkt eine einflußreiche Stellung sichern wird.
Mannigfaltiges,
, Die erste amerikanische Oisenvahn. — Wenn man heute
sas rissige Eisenbahnnetz betrachtet, welches die Vereinigten
j-taaten von Nordamerika umspannt, so sollte inan es für
muin glaublich halten, daß erst im Jahre 183t der erste
Haden desselben gesponnen wurde.
Der Gedanke an ein solches Unternehmen ward freilich
schon im Jahre 1812 von eine!» gewissen Stevans in Hoboken
avgeregt und später in der Tagespresss weiter verfolgt. So
füchien am 23. August 1825 im „Utica Sentinel and Herald"
Per der Ueberschrift „Verbesserungen" folgender Artikel:
".och möchte hiermit zeigen, wie hoch sich die Auslagen für
we einspurige Eisenbahn mit Pferdekraft von hier bis Albany
eiaufsn würden." Schreiber führt dann aus, wie dis
ZfZe etwa 3350 Dollars oder die ganze beabsichtigte Strecke
vOMll) Dollars kosten würde.
Wirklich fand das geplante Unternehmen Gönner und im
iggi wurde die erste Bahn in Amerika, genannt
'' Pnnevk uuck Ilucison Uarlrouci" eröffnet. Sie rief un-
.„heures Aufsehen hervor, sämmtliche Blatter des Landes
'"vren ihres Lobes voll.
So stand z. B. im „^msrioun Uuilrouä ilournnl" vom
15. September 1832: „Durch die Mohawk and Hudson Bahn
werden die Städte Albany und Schenectady miteinander
verbunden; die Entfernung beträgt 15 Meilen. Die lang-
same Beförderung auf dem berühmten Eriekanal mit seinen
vielen Schleusen und Windungen hat eine Gesellschaft ver-
anlaßt, sich zum Zwecke der Hebung dieser Schwierigkeiten inner-
halb Jahresfrist inkorporiren zu lassen. Am 12. August 1830
wurde das Werk von Hrn. C. C. Camberling mit einem Kosten-
aufwande von 438,215 Dollars 46 Cents begonnen, und zur
Vollendung desselben werden noch 156,693 Dollars erforder-
lich sein. So wurde wenigstens im Januar 1832 der Legis-
latur in New-Dark berichtet."
Neber eine Fahrt auf der neuen Bahn äußert sich der
damalige Gouverneur Seward folgendermaßen: „Wir kamen
heute Morgen um 3 Uhr in Schenectady an und wurden so-
fort in Omnibussen zur Bahn befördert. Drei große Wa-
gen standen hier zur Aufnahme der Passagiere bereit. Diese
Wagen haben viel Aehnlichkeit mit unseren Postkutschen,
nur sind sie etwa ein Drittel größer und mit Sitzplätzen auf
den Dächern versehen.
Sie ruhen auf niedrigen Federn, sind somit nur wenig
elastisch. Vorder- und Hinterräder sind gleich groß, messen
etwa 2'/s Fuß im Durchmesser und sind auf der Innenseite
mit 4P Zoll breiten Rändern versehen, um ein Entgleisen
zu verhindern. Der Wagen zerfällt in. zwei getrennte Ab-
theilungen, und zwei Thüren führen in das Innere desselben.
In jeder Abtheilung können sechs Passagiere Platz nehmen.
Auf deni Dache ist ein Sitz für den Kutscher und ein solcher
für drei weitere Personen. Im Ganzen saßt also solch' ein
Wagen 18 Personen sammt Bagage.
Nachdem wir Platz genommen, wurde ein starkes graues
Pferd vorgespannt, der Kondukteur rief,Fertigst der Kutscher
licß einen Pfiff ertönen und dahin fuhren wir. Kaum hatten
wir uns ordentlich umgesehen, da hielt der Wagen, und das
Pferd wurde getränkt. Wir hatten vier (engl.) Meilen inweniger
als 20 Minuten zurückgelegt. Nach weiteren zwei Meilen
hielten wir, und ein frisches Pferd wurde vorgespannt. Noch
weitere 40 Minuten, und wir waren am Ende der Linie an-
gelangt. Wir hatten die ganze Strecke von mehr als 12 Mei-
len in 80 Minuten zurückgelegt."
Diese wenigen Zeilen kennzeichnen die kleinen Anfänge,
auf denen sich der gewaltige amerikanische Eisenbahnbetrieb
im Laufe der Jahre entwickelte. Der nimmer rastende mensch-
liche Erfiudungsgeist bedurfte nur dieses ersten Anhaltspunktes,
nur mit Riesenschritten die einmal betretene Bahn zu ver-
folgen. O. v. Bries-n.
Der König Zerame von Westfalen bereiste im Herbst
des Jahres 1811 mit seiner Gemahlin den Harz und besah
dessen Merkwürdigkeiten. Er befuhr mehrere Gruben des
Oberharzes, besah dis Pochwerke in Klausthal, ohne den armen
Hüttenleuten, die gewohnt sind, von jedem Reisenden, der
ihre Maschinerien und Werke besieht, ein Trinkgeld zu er-
halten, auch nur eine Spur königlicher Freigebigkeit zukom-
men zu lassen. Die Neugier, das königliche Paar zu sehen,
hatte eine Menge Pochjungen unter den Fenstern der Königin
versammelt, welche die Luft von ihrem bergmännischen „Glück
auf!" ertönen ließen. Einer der Kammerherren erhielt den
Befehl, für zwei Napoleonsd'or Kupfermünzen einwechseln zu
lassen, welche die Königin „mit freigebiger Hand" unter die
Pochjungen warf und natürlicherweise ein gewaltiges Drängen
und Schlagen verursachte, iveil sie nicht glauben konnten,
daß ihrs neue Königin sie mit bloßer Kupfermünze abspeisen
wolle. Da es indeß nach wie vor bei dieser Münzsorte blieb,
trat einer von ihnen nahe an's Fenster und rief der Königin
in seinem unverfälschten Harzdialekt zu: „Fra Kanegen! werf
Se doch ach Silbergald 'runter!" — Aber die Bitte blieb
unerfüllt, und sie mußten sich mit dem Kupfergelde begnü-
gen. K. St.
Kino Aranencliarakteristik von 1715. — Bei den viel-
fachen Charakteristiken, die von Zeit zu Zeit durch die Tages-
blätter gehen, in denen in kurzen Worten mehr oder weniger
bekannte Weltbummler das Wesen der Frauen der verschie-
denen Nationalitäten zu bestimmen suchen, mag es nicht un-
interessant sein, eine Frauencharakteristik kennen zu lernen,
wie sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegeben wurde. Eine
solche findet sich in dem „Frauenzimmer-Lexikon" von Ama-
anthes. Von dein Charakter der Frauen glaubt der Ver-
fasser, „daß Humeur, Geist, Eigenschaft, Inklination und
Wesen scheinet nach jeder Landesart und Beschaffenheit von
einander unterschieden zu sein." Die Portugiesin schildert er
als die schönste, dabei aber als „hochmüthig,
eifersüchtig und argwöhnisch." Die Spa-
nierin „schminket sich sehr stark, ist sehr ver-
liebt, hat insgemein garstige und übelriechende
Zähne." Die Französin „ist lustig, beredt,
neugierig, veränderlich in Moden, listig,
verliebt, doch leichtsinnig, frei, doch sonder
Verletzung der Ehrbarkeit." Die Nieder-
länderin ist sparsam, fleißig, haushältig, hält
viel auf Nettigkeit und Reinlichkeit im Hause,
ist keine Spielverderberin und sehr com-
plaisant." Von den Engländerinnen erfahren
wir, daß sie „in Konversation nicht spröde,
maßen ein Fremder selbiges gar leicht spre-
chen kann; machet auch ein Pfeiffchen Tobac
mit." Die deutschen Frauen, deren Schön-
heit der Autor nicht gar zu hoch preist,
„lieben neue Moden sehr gerne, sind politisch
und zu allen Dingen geschickt, curieux, kön-
nen ihre Liebe sehr verbergen, mögen auch
gerne Schmeicheleien vertragen und lassen
sich zur Haushaltung wohl anführen." Das
ungarische Frauenzimmer ist artig von Ge-
sichte, lebet sehr eingezogen und ist sehr scham-
haftig. Die Schweizerin „ist arbeitsam,
offenherzig, doch manchmal ein wenig simpel,"
in Amerika aber „ist das Frauenzimmer sehr
wild, rauh und abgöttisch." Th. S.
Die deutsche Sprache eine Krankheit!
— Es ist wohl schon viel Abenteuerliches
über sonderbare Krankheiten berichtet worden,
aber was der große Erasmus von Rotter-
dam über einen wunderbaren Krankheits-
fall erzählt, ist ohne Zweifel das abenteuer-
lichste. Der Sachverhalt ist dieser: Ein Ita-
liener aus Spoleto, Fliario mit Namen, den
Erasmus gesehen zu haben ausdrücklich ver-
sichert , bekam von Zeit zu Zeit Anfälle, in
denen er sich wie ein Besessener geberdete.
Das kommt nun freilich öfters vor, aber das
Schlimme und Bedenkliche dabei war das,
daß der Italiener bei seinem Rasen immer
deutsch sprach, obgleich er nie Gelegen-
heit gehabt hätte, deutsch zu lernen! Die
Angehörigen des Mannes wurden denn auch
durch dieses Symptom sehr beunruhigt und
ließen einen berühmten Arzt zu ihn: kom-
men. Dieser fand das Deutschsprechen eben-
falls sehr bedenklich, aber er. versprach zu
helfen. Er verschrieb dem Kranken eine Me-
dici«, und es dauerte nicht lange, so gab
Fliario unter Nachhilfe des Arztes eine große
Anzahl von Würmern durch dis Nase von
sich — und von Stund air war er geheilt.
Er raste nicht mehr, sprach nicht mehr deutsch
und konnte auch nicht mehr deutsch sprechen, selbst wenn er
es der Probe halber versuchte. Er war von der deutschen
Sprache geheilt! — Und dergleichen berichtet einer der größten
Männer des 16. Jahrhunderts! I. D.
Aahn's Iranzosenhaß. — Wie hoch bei dem Turnvater
Jahn der Franzosenhaß gestiegen war, davon finden wir in
seinem Buche „Werke zum deutschen Volksthum" ein inter-
essantes Beispiel. Um den Einfluß der verhaßten Franzosen
auf unsere Sitton und Gebräuche gänzlich zu vernichten, schlägt
er vor, jeden Verkehr mit ihnen abzubrechen. Das schöne
Nheinthal soll von der Schweiz bis zur holländischen Grenze
zur Wüste gemacht werden. Man treibe, so sagt Jahn, die
Bewohner aus, brenne Städte und Dörfer nieder, reiße die
Dämme ei», lenke den Rhein niit seine» Nebenflüssen in
die Felder, daß Alles versumpft und zmn Walddickicht werde.
Durch dieses Dickicht möge» dann zwei oder drei Wege, aber
nur Fußpfade, führen, das ist das Höchste, was Jahn zn-
gestehen wollte. i)r. W.
Kühe nnd Hchsen. — König Friedrich Wilhelm III. von
Preußen aß im Sommer gern zum gelben Kopfsalat eine
säuerliche Rahmsauce. Als ihm diese einmal bei einer Fest-
lichkeit auf der Pfaueninsel bei Potsdam für die Gäste nicht
hinreichend schien und er dies dem darreichenden Bedienten
sagte, gab dieser die einfältige Antwort: „Ja, Majestät, das
macht, Weil auf der Pfaueninsel so wenig Kühe sind!"
Sofort entgegnete der König: „Aber desto mehr Och-
sen!" E. K.
Z'rinz Deopvko von Bayern,
der neue Generalinspekleur der 4. Armeeinspeltion des deutschen Neichtzheeres. (S. 127)
Da s Buch für All e.
sind die schlesischen Granitbrüche, ebenso die sächsischen
Sandsteinbrüche. Die Schieferbrüche Thüringens ar-
beiten namentlich viel für Bedachungen, doch verfertigen
sie auch, besonders in der Gegend von Sonneberg,
Schiefertafeln, durch die sie den Schieferbrüchen
bei Worms Konkurrenz »rachen. Die Kalkstein- und
Kalkspatbrüche liefern nicht nur Material zu gebranntem
Kalk, sondern auch für die Eisen-, Zucker-, Soda- und
chemischen Fabriken, namentlich in den Bezirken von
Bromberg, Iserlohn und Arnsberg.
In rohen oder nur behauenen Steinen beträgt die
deutsche Ausfuhr über 400,000 Tonnen im Werthe
von fast 10 Millionen Mark, der eine Einfuhr von
beinahe 600,000 Tonnen im Werthe von annähernd
21 Millionen Mark gcgenübersteht. Die Ausfuhr an
Steinwaaren aller Art, namentlich Schiefer, beläuft
sich auf 40,000 Tonnen in einem Werthbetrage von
12 Millionen Mark, während an Dach- und rohem
Tafelschiefer immer noch für 6 Millionen Mark im-
portirt werden. Außerdem werden Backsteine, Dach-
ziegel und feuerfeste Steiue für 10 Millionen, Thon-
waaren für 13 Millionen und Porzellanwaaren für
10 Millionen Mark ausgeführt, bei deren insgesammt
die Einfuhr unbedeutend ist. Denn
auch an Thonen, von der reinsten Por-
zellanerde bis zum Lehm für Ziegeln
und Backsteine, ist Deutschland reich.
Porzellanfabriken gibt es in Deutsch¬
land etwa 110, Ziegeleien etwa 20,000.
Deutschland führt daher jährlich über
100,000 Doppelcentner Porzellanwaaren
und gegen 6 Millionen Mauersteine
aus.
Schließlich sei noch die Asphalt-Prc-
duktion erwähnt, die bei der Verwen-
dung des Asphalts im Straßenbau
einen hohen Aufschwung erfahren hat.
Die Asphaltlager befinden sich in Han-
nover in der Gegend von Limmer, in
Braunschweig und in: Elsaß bei Lol -
sann. Seit dem Jahre 1886 haben cs
die deutschen Asphaltfabriken durch ein
Neues Verfahren dahin gebracht, daß sie
es mit jedem ausländischen Produkt aus-
nehmen können. In Deutschland wer¬
den jährlich durchschnittlich 50,000 Ton¬
nen gewonnen. Eine Einfuhr findet
unter anderen auch von Palästina auS
der Gegend des Todten Meeres statt.
Im Ganzen sind im Bergbau ein-
schließlich der Torfgräberei beinahe
1 Million Personen beschäftigt, so daß
auf 1000 Einwohner des Reiches 21 in
diesem Erwerbszweig thätige Personen
kommen. Seit dem Beginn der sech-
ziger Jahre hat Deutschland in den Be¬
trieben des Bergbaues und Hüttenwesens
gewaltige Fortschritte gemacht. Die
deutsche Produktion ist seit 1861 in der
gejammten Bergwerksgewinnung von
Millionen Tonnen im Werthe von
kf>1 Millionen Mark auf 96 Millionen
Wonnen im Werthe von 494 Millionen
Mark, indergesammtenHüttenproduktion
von 904,000 Tonnen im Werthe von
k25 Millionen Mark auf 5 Millionen
Wonnen ine Werthe von 369 Millionen
Mark gestiegen. Jene hat sich sonach
saft vervierfacht, diese sogar mehr als
verfünffacht. Wenn auch unter der
Konkurrenz der Neuzeit der Werth der
-Produkte nicht in gleicher Weise wie die
frzielte Menge gestiegen ist, so bürgt doch die bis-
herige Entwickelung in den bergmännischen und hütten-
vuinnischen Betrieben dafür, daß die deutsche Unisicht
und Thatkraft auch fernerhin ihren Erzeugnissen auf
dem Weltmarkt eine einflußreiche Stellung sichern wird.
Mannigfaltiges,
, Die erste amerikanische Oisenvahn. — Wenn man heute
sas rissige Eisenbahnnetz betrachtet, welches die Vereinigten
j-taaten von Nordamerika umspannt, so sollte inan es für
muin glaublich halten, daß erst im Jahre 183t der erste
Haden desselben gesponnen wurde.
Der Gedanke an ein solches Unternehmen ward freilich
schon im Jahre 1812 von eine!» gewissen Stevans in Hoboken
avgeregt und später in der Tagespresss weiter verfolgt. So
füchien am 23. August 1825 im „Utica Sentinel and Herald"
Per der Ueberschrift „Verbesserungen" folgender Artikel:
".och möchte hiermit zeigen, wie hoch sich die Auslagen für
we einspurige Eisenbahn mit Pferdekraft von hier bis Albany
eiaufsn würden." Schreiber führt dann aus, wie dis
ZfZe etwa 3350 Dollars oder die ganze beabsichtigte Strecke
vOMll) Dollars kosten würde.
Wirklich fand das geplante Unternehmen Gönner und im
iggi wurde die erste Bahn in Amerika, genannt
'' Pnnevk uuck Ilucison Uarlrouci" eröffnet. Sie rief un-
.„heures Aufsehen hervor, sämmtliche Blatter des Landes
'"vren ihres Lobes voll.
So stand z. B. im „^msrioun Uuilrouä ilournnl" vom
15. September 1832: „Durch die Mohawk and Hudson Bahn
werden die Städte Albany und Schenectady miteinander
verbunden; die Entfernung beträgt 15 Meilen. Die lang-
same Beförderung auf dem berühmten Eriekanal mit seinen
vielen Schleusen und Windungen hat eine Gesellschaft ver-
anlaßt, sich zum Zwecke der Hebung dieser Schwierigkeiten inner-
halb Jahresfrist inkorporiren zu lassen. Am 12. August 1830
wurde das Werk von Hrn. C. C. Camberling mit einem Kosten-
aufwande von 438,215 Dollars 46 Cents begonnen, und zur
Vollendung desselben werden noch 156,693 Dollars erforder-
lich sein. So wurde wenigstens im Januar 1832 der Legis-
latur in New-Dark berichtet."
Neber eine Fahrt auf der neuen Bahn äußert sich der
damalige Gouverneur Seward folgendermaßen: „Wir kamen
heute Morgen um 3 Uhr in Schenectady an und wurden so-
fort in Omnibussen zur Bahn befördert. Drei große Wa-
gen standen hier zur Aufnahme der Passagiere bereit. Diese
Wagen haben viel Aehnlichkeit mit unseren Postkutschen,
nur sind sie etwa ein Drittel größer und mit Sitzplätzen auf
den Dächern versehen.
Sie ruhen auf niedrigen Federn, sind somit nur wenig
elastisch. Vorder- und Hinterräder sind gleich groß, messen
etwa 2'/s Fuß im Durchmesser und sind auf der Innenseite
mit 4P Zoll breiten Rändern versehen, um ein Entgleisen
zu verhindern. Der Wagen zerfällt in. zwei getrennte Ab-
theilungen, und zwei Thüren führen in das Innere desselben.
In jeder Abtheilung können sechs Passagiere Platz nehmen.
Auf deni Dache ist ein Sitz für den Kutscher und ein solcher
für drei weitere Personen. Im Ganzen saßt also solch' ein
Wagen 18 Personen sammt Bagage.
Nachdem wir Platz genommen, wurde ein starkes graues
Pferd vorgespannt, der Kondukteur rief,Fertigst der Kutscher
licß einen Pfiff ertönen und dahin fuhren wir. Kaum hatten
wir uns ordentlich umgesehen, da hielt der Wagen, und das
Pferd wurde getränkt. Wir hatten vier (engl.) Meilen inweniger
als 20 Minuten zurückgelegt. Nach weiteren zwei Meilen
hielten wir, und ein frisches Pferd wurde vorgespannt. Noch
weitere 40 Minuten, und wir waren am Ende der Linie an-
gelangt. Wir hatten die ganze Strecke von mehr als 12 Mei-
len in 80 Minuten zurückgelegt."
Diese wenigen Zeilen kennzeichnen die kleinen Anfänge,
auf denen sich der gewaltige amerikanische Eisenbahnbetrieb
im Laufe der Jahre entwickelte. Der nimmer rastende mensch-
liche Erfiudungsgeist bedurfte nur dieses ersten Anhaltspunktes,
nur mit Riesenschritten die einmal betretene Bahn zu ver-
folgen. O. v. Bries-n.
Der König Zerame von Westfalen bereiste im Herbst
des Jahres 1811 mit seiner Gemahlin den Harz und besah
dessen Merkwürdigkeiten. Er befuhr mehrere Gruben des
Oberharzes, besah dis Pochwerke in Klausthal, ohne den armen
Hüttenleuten, die gewohnt sind, von jedem Reisenden, der
ihre Maschinerien und Werke besieht, ein Trinkgeld zu er-
halten, auch nur eine Spur königlicher Freigebigkeit zukom-
men zu lassen. Die Neugier, das königliche Paar zu sehen,
hatte eine Menge Pochjungen unter den Fenstern der Königin
versammelt, welche die Luft von ihrem bergmännischen „Glück
auf!" ertönen ließen. Einer der Kammerherren erhielt den
Befehl, für zwei Napoleonsd'or Kupfermünzen einwechseln zu
lassen, welche die Königin „mit freigebiger Hand" unter die
Pochjungen warf und natürlicherweise ein gewaltiges Drängen
und Schlagen verursachte, iveil sie nicht glauben konnten,
daß ihrs neue Königin sie mit bloßer Kupfermünze abspeisen
wolle. Da es indeß nach wie vor bei dieser Münzsorte blieb,
trat einer von ihnen nahe an's Fenster und rief der Königin
in seinem unverfälschten Harzdialekt zu: „Fra Kanegen! werf
Se doch ach Silbergald 'runter!" — Aber die Bitte blieb
unerfüllt, und sie mußten sich mit dem Kupfergelde begnü-
gen. K. St.
Kino Aranencliarakteristik von 1715. — Bei den viel-
fachen Charakteristiken, die von Zeit zu Zeit durch die Tages-
blätter gehen, in denen in kurzen Worten mehr oder weniger
bekannte Weltbummler das Wesen der Frauen der verschie-
denen Nationalitäten zu bestimmen suchen, mag es nicht un-
interessant sein, eine Frauencharakteristik kennen zu lernen,
wie sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts gegeben wurde. Eine
solche findet sich in dem „Frauenzimmer-Lexikon" von Ama-
anthes. Von dein Charakter der Frauen glaubt der Ver-
fasser, „daß Humeur, Geist, Eigenschaft, Inklination und
Wesen scheinet nach jeder Landesart und Beschaffenheit von
einander unterschieden zu sein." Die Portugiesin schildert er
als die schönste, dabei aber als „hochmüthig,
eifersüchtig und argwöhnisch." Die Spa-
nierin „schminket sich sehr stark, ist sehr ver-
liebt, hat insgemein garstige und übelriechende
Zähne." Die Französin „ist lustig, beredt,
neugierig, veränderlich in Moden, listig,
verliebt, doch leichtsinnig, frei, doch sonder
Verletzung der Ehrbarkeit." Die Nieder-
länderin ist sparsam, fleißig, haushältig, hält
viel auf Nettigkeit und Reinlichkeit im Hause,
ist keine Spielverderberin und sehr com-
plaisant." Von den Engländerinnen erfahren
wir, daß sie „in Konversation nicht spröde,
maßen ein Fremder selbiges gar leicht spre-
chen kann; machet auch ein Pfeiffchen Tobac
mit." Die deutschen Frauen, deren Schön-
heit der Autor nicht gar zu hoch preist,
„lieben neue Moden sehr gerne, sind politisch
und zu allen Dingen geschickt, curieux, kön-
nen ihre Liebe sehr verbergen, mögen auch
gerne Schmeicheleien vertragen und lassen
sich zur Haushaltung wohl anführen." Das
ungarische Frauenzimmer ist artig von Ge-
sichte, lebet sehr eingezogen und ist sehr scham-
haftig. Die Schweizerin „ist arbeitsam,
offenherzig, doch manchmal ein wenig simpel,"
in Amerika aber „ist das Frauenzimmer sehr
wild, rauh und abgöttisch." Th. S.
Die deutsche Sprache eine Krankheit!
— Es ist wohl schon viel Abenteuerliches
über sonderbare Krankheiten berichtet worden,
aber was der große Erasmus von Rotter-
dam über einen wunderbaren Krankheits-
fall erzählt, ist ohne Zweifel das abenteuer-
lichste. Der Sachverhalt ist dieser: Ein Ita-
liener aus Spoleto, Fliario mit Namen, den
Erasmus gesehen zu haben ausdrücklich ver-
sichert , bekam von Zeit zu Zeit Anfälle, in
denen er sich wie ein Besessener geberdete.
Das kommt nun freilich öfters vor, aber das
Schlimme und Bedenkliche dabei war das,
daß der Italiener bei seinem Rasen immer
deutsch sprach, obgleich er nie Gelegen-
heit gehabt hätte, deutsch zu lernen! Die
Angehörigen des Mannes wurden denn auch
durch dieses Symptom sehr beunruhigt und
ließen einen berühmten Arzt zu ihn: kom-
men. Dieser fand das Deutschsprechen eben-
falls sehr bedenklich, aber er. versprach zu
helfen. Er verschrieb dem Kranken eine Me-
dici«, und es dauerte nicht lange, so gab
Fliario unter Nachhilfe des Arztes eine große
Anzahl von Würmern durch dis Nase von
sich — und von Stund air war er geheilt.
Er raste nicht mehr, sprach nicht mehr deutsch
und konnte auch nicht mehr deutsch sprechen, selbst wenn er
es der Probe halber versuchte. Er war von der deutschen
Sprache geheilt! — Und dergleichen berichtet einer der größten
Männer des 16. Jahrhunderts! I. D.
Aahn's Iranzosenhaß. — Wie hoch bei dem Turnvater
Jahn der Franzosenhaß gestiegen war, davon finden wir in
seinem Buche „Werke zum deutschen Volksthum" ein inter-
essantes Beispiel. Um den Einfluß der verhaßten Franzosen
auf unsere Sitton und Gebräuche gänzlich zu vernichten, schlägt
er vor, jeden Verkehr mit ihnen abzubrechen. Das schöne
Nheinthal soll von der Schweiz bis zur holländischen Grenze
zur Wüste gemacht werden. Man treibe, so sagt Jahn, die
Bewohner aus, brenne Städte und Dörfer nieder, reiße die
Dämme ei», lenke den Rhein niit seine» Nebenflüssen in
die Felder, daß Alles versumpft und zmn Walddickicht werde.
Durch dieses Dickicht möge» dann zwei oder drei Wege, aber
nur Fußpfade, führen, das ist das Höchste, was Jahn zn-
gestehen wollte. i)r. W.
Kühe nnd Hchsen. — König Friedrich Wilhelm III. von
Preußen aß im Sommer gern zum gelben Kopfsalat eine
säuerliche Rahmsauce. Als ihm diese einmal bei einer Fest-
lichkeit auf der Pfaueninsel bei Potsdam für die Gäste nicht
hinreichend schien und er dies dem darreichenden Bedienten
sagte, gab dieser die einfältige Antwort: „Ja, Majestät, das
macht, Weil auf der Pfaueninsel so wenig Kühe sind!"
Sofort entgegnete der König: „Aber desto mehr Och-
sen!" E. K.
Z'rinz Deopvko von Bayern,
der neue Generalinspekleur der 4. Armeeinspeltion des deutschen Neichtzheeres. (S. 127)