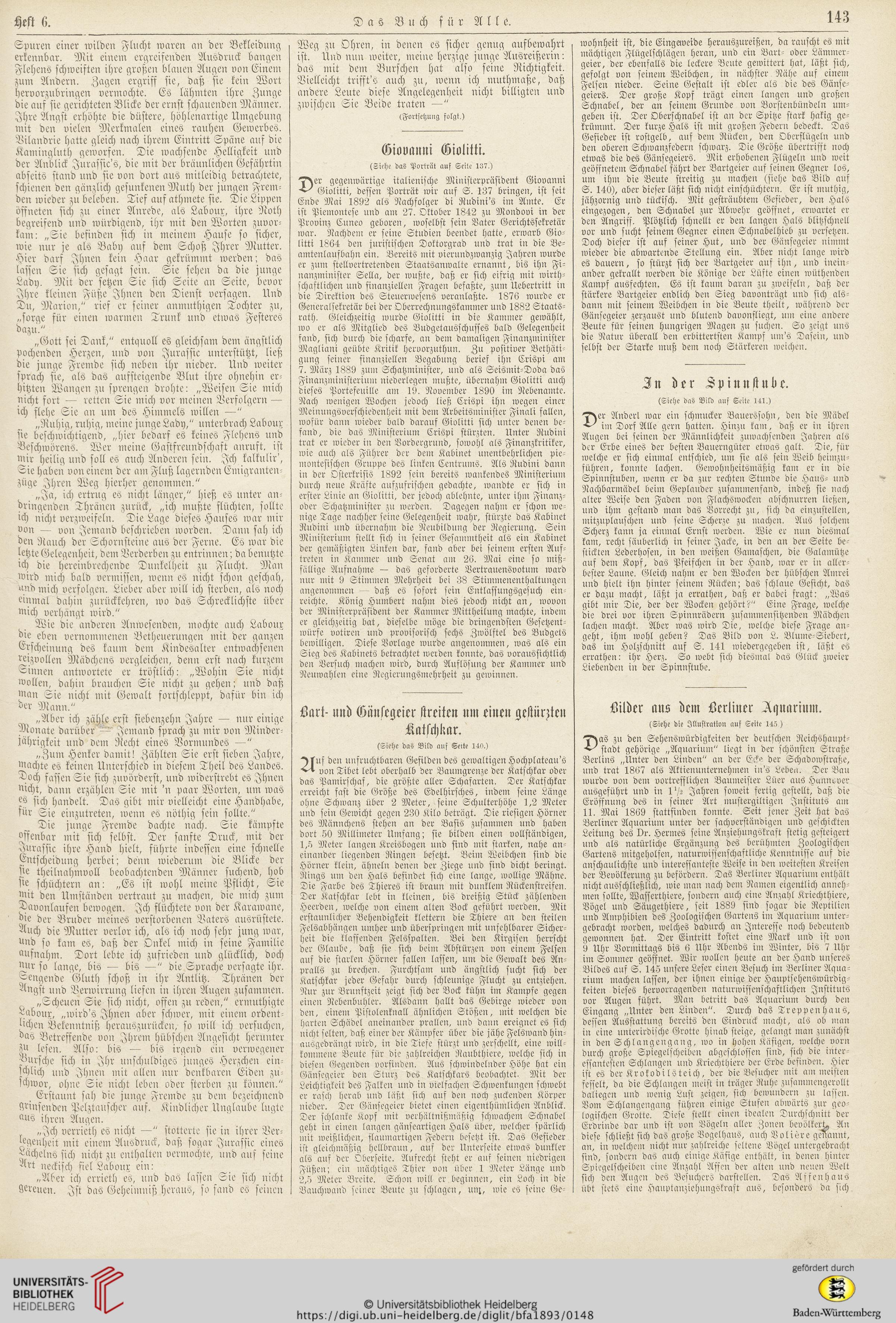Hch 6.
Das Buch für Alle.
148
Spuren einer nülden Flucht waren an der Bekleidung
erkennbar. Mit einem ergreifenden Ausdruck bangen
Flehens schweiften ihre großen blauen Augen von Einem
zum Andern. Zagen ergriff sie, daß sie kein Wort
hervorzubringen vermochte. Es lähmten ihre Zunge
die auf sie gerichteten Blicke der ernst schauenden Männer.
Ihre Angst erhöhte die düstere, höhlenartige Umgebung
mit den vielen Merkmalen eines rauhen Gewerbes.
Vilandrie hatte gleich nach ihrem Eintritt Späne auf die
Kamingluth geworfen. Die wachsende Helligkeit und
der Anblick Jurassiers, die mit der bräunlichen Gefährtin
abseits stand und sie von dort aus mitleidig betrachtete,
schienen den gänzlich gesunkenen Muth der jungen Frem-
den wieder zu beleben. Tief auf athmete sie. Die Lippen
öffneten sich zu einer Anrede, als Laboux, ihre Noth
begreifend und würdigend, ihr mit den Worten zuvor-
kam: „Sie befinden sich in meinem Hause so sicher,
wie nur je als Baby auf dem Schoß Ihrer Mutter.
Hier darf Ihnen kein Haar gekrümmt werden: das
lassen Sie sich gesagt sein. Sie sehen da die junge
Lady. Mit der fetzen Sie sich Seite an Seite, bevor
Ihre kleinen Füße Ihnen den Dienst versagen. Und
Du, Marion," rief er seiner anmuthigen Tochter zu,
„sorge für einen warmen Trunk und etwas Festeres
dazu."
„Gott sei Dank," entquoll es gleichsam dem ängstlich
pochenden Herzen, und von Jurassie unterstützt, ließ
die junge Fremde sich neben ihr nieder. Und weiter
sprach sie, als das aufstcigende Blut ihre ohnehin er-
hitzten Wangen zu sprengen drohte: „Weisen Sie mich
nicht fort — retten Sie mich vor meinen Verfolgern —
ich flehe Sic an um des Himmels willen —"
„Ruhig, ruhig, meine junge Lady," unterbrach Laboux
sie beschwichtigend, „hier bedarf es keines Flehens und
Beschwörens. Wer meine Gastfreundschaft anruft, ist
nur heilig und soll es auch Anderen sein. Ich kalkulir',
Sie haben von einem der am Fluß lagernden Emigranten-
züge Ihren Weg hierher genommen."
„Ja, ich ertrug es nicht länger," hieß es unter an-
bringenden Thrüncn zurück, „ich mußte flüchten, sollte
ich nicht verzweifeln. Die Lage dieses Hauses war mir
von — von Jemand beschrieben worden. Dann sah ich
ben Rauch der Schornsteine aus der Ferne. Es war die
letzte Gelegenheit, dem Verderben zn entrinnen; da benntztc
ich die hereinbrechende Dunkelheit zu Flucht. Man
wird mich bald vermissen, wenn es nicht schon geschah,
find mich verfolgen. Lieber aber null ich sterben, als noch
einmal dahin zurückkehren, wo das Schrecklichste über
mich verhängt wird."
Wie die anderen Anwesenden, mochte auch Laboux
bie eben vernommenen Betheuerungen mit der ganzen
^sschcinung des kaum dem Kindesalter entwachsenen
reizvollen Mädchens vergleichen, denn erst nach kurzem
binnen antwortete er tröstlich: „Wohin Sie nicht
wollen, dahin brauchen Sie nicht zu gehen: und daß
Man Sie nicht mit Gewalt fortschleppt, dafür bin ich
ver Mann."
„Aber ich zähle erst fiebenzehn Jahre — nur einige
Monate darüber Jemand sprach zu mir von Minder-
jährigkeit und vem Recht eines Vormundes —"
„Zum Henker damit! Zählten Sie erst sieben Jahre,
Machte es keinen Unterschied in diesem Theil des Landes.
Doch fassen Sie sich zuvörderst, und widerstrebt es Ihnen
uicht, dann erzählen Sie mit 'n paar Worten, um was
ks sich handelt. Das gibt mir vielleicht eine Handhabe,
kür Sie einzutreten, wenn es nöthig sein sollte."
Die junge Fremde dachte nach. Sie kämpfte
ffffenbnr mit sich selbst. Der sanfte Druck, mit der
>stirassie ihre Hand hielt, führte indessen eine schnelle
Entscheidung herbei; denn wiederum die Blicke der
sie theilnahmvoll beobachtenden Männer suchend, hob
sie schüchtern an: „Es ist wohl meine Pflicht, Sie
mit den Umstünden vertraut zu machen, die mich zum
Davonlaufen bewogen. Ich flüchtete von der Karawane,
bie der Bruder meines verstorbenen Vaters ausrüstete,
^uch die Mutter verlor ich, als ich noch sehr jung war,
und so kam es, daß der Onkel mich in seine Familie
aufnahm. Dort lebte ich zufrieden und glücklich, doch
Mir so lange, bis — bis —" die Sprache versagte ihr.
Dengende Gluth schoß in ihr Antlitz. Thränen der
Angst und Verwirrung liefen in ihren Augen zusammen.
„Scheuen Sie sich nicht, offen zu reden," ermuthigte
Laboux, „wird's Ihnen aber schwer, mit einem ordent-
uchen Bekenntnis) herauszurücken, so will ich versuchen,
bas Betreffende von Ihrem hübschen Angesicht herunter
M lesen. Also: bis — bis irgend ein verwegener
Bursche sich in Ihr unschuldiges junges Herzchen ein-
lchlich und Ihnen mit allen nur denkbaren Eiden zu-
lchwor, ohne Sic nicht leben oder sterben zu können."
Erstaunt sah die junge Fremde zu dem bezeichnend
tzvinsendcn Pelztanscher auf. Kindlicher Unglaube lugte
aus ihren Augen.
„Ich verrieth es nicht —" stotterte sie in ihrer Ver-
Menheit mit einem Ausdruck, daß sogar Jurassie eines
fächelns sich nicht zu enthalten vermochte, und aus seine
Art neckisch fiel Laboux ein:
„Aber ich crricth es, und das lassen Sic sich nicht
bereuen. Ist das Geheimniß heraus, so sand cs seinen
Weg zu Ohren, in denen es sicher genug aufbewahrt
ist. Und nuic weiter, meine herzige junge Ausreißerin:
das mit dem Burschen hat also seine Richtigkeit.
Vielleicht trifft's auch zu, wenn ich muthmaße, daß
andere Leute diese Angelegenheit nicht billigten und
zwischen Sie Beide traten —"
«Fortf-tzung folgt.)
Giomumi Giolitti.
(Liehe das Porträt auf Seite 137.)
7>er gegenwärtige italienische Ministerpräsident Giovanni
Giolitti, dessen Porträt wir auf S. 187 bringen, ist seit
Ende Mai 1892 als Nachfolger di Rndini's im Amte. Er
ist Piemontese und am 27. Oktober 1842 zu Mondovi in der
Provinz Cuneo geboren, woselbst sein Vater Gerichtssekretür
>var. Nachdem er seine Studien beendet hatte, erwarb Gio-
litti 1864 den juristischen Doktorgrad und trat in die Be-
amtsnlaufbahn ein. Bereits mit vierundzwanzig Jahren wurde
er zum stellvertretenden Staatsanwalte ernannt, bis ihn Fi-
nanzminister Sella, der wußte, daß er sich eifrig mit wirth-
schaftlichen und finanziellen Fragen befaßte, zum Uebertritt in
die Direktion des Steuerwesens veranlaßte. 1876 wurde er
Generalsekretär bei der Oberrechnnngskammer und 1882 Staats-
rath. Gleichzeitig wurde Giolitti in die Kammer gewählt,
wo er als Mitglied des Budgetausschusses bald Gelegenheit
fand, sich durch die scharfe, an deni damaligen Finanzminister
Magliani geübte Kritik hervorzuthun. Zu positiver Bethäti-
gung seiner finanziellen Begabung berief ihn Crispi am
7. März 1889 zum Schatzminister, und als Seismit-Dodn daS
Finanzministerium niederlegen mußte, übernahm Giolitti auch
dieses Portefeuille am 19. November 1890 im Nebenamte.
Nach wenigen Wochen jedoch ließ Crispi ihn wegen einer
Meinungsverschiedenheit mit dem Arbeitsminister Finali fallen,
wofür dann wieder bald darauf Giolitti sich unter denen be-
fand, die das Ministerium Crispi stürzten. Unter Rudini
trat er wieder in den Vordergrund, sowohl als Finanzkritiker,
wie auch als Führer der dem Kabinet unentbehrlichen pie-
montesischen Gruppe des linken Centrnms. Als Rudini dann
in der Osterkrisis 1892 sein bereits wankendes Ministerium
durch neue Kräfte aufzufrischen gedachte, wandte er sich in
erster Linie all Giolitti, der jedoch ablchnte, unter ihm Finanz-
oder Schatzminister zu werden. Dagegen nahm er schon we-
nige Tage nachher seine Gelegenheit wahr, stürzte das Kabinet
Rudini und übernahm die Neubildung der Regierung. Sein
Ministerium stellt sich in seiner Gesammtheit als ein Kabinet
der gemäßigten Linken dar, fand aber bei seinem ersten Auf-
treten in Kammer und Senat am 26. Mai eine so miß-
fällige Aufnahme — das geforderte Vertrauensvotum ward
nur mit 9 Stimmen Mehrheit bei 38 Stimmenenthaltungen
angenommen - daß es sofort sein Entlassungsgesuch ein
reichte. König Humbert nahm dies jedoch nicht an, wovon
der Ministerpräsident der Kammer Mittheilung machte, indem
er gleichzeitig bat, dieselbe möge die dringendsten Gesetzent-
würfe vatiren und provisorisch sechs Zwölftel des Budgets
bewilligen. Diese Vorlage wurde angenommen, was als ein
Sieg des Kabinets betrachtet werden konnte, das voraussichtlich
den Versuch machen wird, durch Auflösung der Kammer und
Neuwahlen eine Regierungsmehrheit zu gewinnen.
Lari- und Giilisegein' streiten um einen gesinnten
Katschkar.
(Siehe das Bild auf Seite 140.)
")Iuf den unfruchtbaren Gefilden des gewaltigen Hochplateau's
von Tibet lebt oberhalb der Baumgrenze der Katschkar oder
das Pamirschaf, die größte aller Schafarten. Der Katschkar
erreicht fast die Größe des Edelhirsches, indem seine Länge
ohne Schwanz über 2 Meter, seine Schulterhöhe 1,2 Meter
und sein Gewicht gegen 230 Kilo beträgt. Die riesigen Hörner
des Männchens stehen an der Basis zusammen und haben
dort 50 Millimeter Umfang; sie bilden einen vollständigen,
1.5 Meter langen Kreisbogen und sind mit starken, nahe an-
einander liegenden Ringen besetzt. Beim Weibchen sind die
Hörner klein, ähneln denen der Ziege und sind dicht beringt.
Rings um den Hals befindet sich eine lange, wollige Mähne.
Die Farbe des Thieres ist braun mit dunklem Rückenstreifen.
Der Katschkar lebt in kleinen, bis dreißig Stück zählenden
Heerden, welche von einem alten Bock geführt werden. Mit
erstaunlicher Behendigkeit klettern die Thiere an den steilen
Felsabhängen umher und überspringen mit unfehlbarer Sicher-
heit die klaffenden Felsspalten. Bei den Kirgisen herrscht
der Glaube, daß sie sich beim Abstürzen von einem Felsen
auf die starken Hörner fallen lassen, um die Gewalt des An-
pralls zu brechen. Furchtsam und ängstlich sucht sich der
Katschkar jeder Gefahr durch schleunige Flucht zu entziehen.
Nur zur Brunstzeit zeigt sich der Bock kühn im Kampfe gegen
einen Nebenbuhler. Alsdann hallt das Gebirge wieder von
den, einem Pistolenknall ähnlichen Stößen, mit welchen die
harten Schädel aneinander prallen, und dann ereignet es sich
nicht selten, daß einer der Kämpfer über die jähe Felswand hin-
nusgedrangt wird, in die Tiefe stürzt und zerschellt, eine will-
kommene Beute für die zahlreichen Raubthiere, welche sich in
diesen Gegenden vorfinden. Aus schwindelnder Höhe hat ein
Gänsegeier den Sturz des Katschkars beobachtet. Mit der
Leichtigkeit des Falken und in vielfachen Schwenkungen schwebt
er rasch herab und läßt sich auf den noch zuckenden Körper
nieder. Der Gänsegeier bietet einen eigenthümlichen Anblick.
Der schlanke Kopf mit verhältnismäßig schwachem Schnabel
geht in einen langen gänseartigen Hals über, welcher spärlich
mit weißlichen, flanmartigen Federn besetzt ist. Das Gefieder
ist gleichmäßig hellbraun, auf der Unterseite etwas dunkler
als auf der Oberseite. Aufrecht steht er auf seinen niedrigen
Füßen; ein mächtiges Thier von über 1 Meter Länge und
2.5 Meter Breite. Schon will er beginnen, ein Loch in die
Bauchwand seiner Beute zn schlagen, rny, wie es seine Ge-
wohnheit ist, die Eingeweide herauszureißen, da rauscht es mit
mächtigen Flügelschlägcn heran, und ein Bart- oder Lämmer
geier, der ebenfalls die leckere Beute gewittert hat, läßt sich,
gefolgt von seinem Weibchen, in nächster Nähe auf einein
Felsen nieder. Seine Gestalt ist edler als die des Gänse-
geiers. Der große Kopf trägt einen langen und großen
Schnabel, der an seinem Grunde von Borstenbündeln um-
geben ist. Der Oberschnabel ist an der Spitze stark hakig ge-
krümmt. Der kurze Hals ist mit großen Federn bedeckt. Das
Gefieder ist rostgelb, auf dem Rücken, den Oberflügeln und
den oberen Schwanzfedern schwarz. Die Größe übertrifft noch
etwas die des Gänsegeiers. Mit erhobenen Flügeln und weit
geöffnetem Schnabel fährt der Bartgeier auf seinen Gegner los,
um ihm die Beute streitig zu machen (siehe das Bild auf
S. 140), aber dieser läßt sich nicht einschüchtern. Er ist muthig,
jähzornig und tückisch. Mit gesträubtem Gefieder, den Hals
eingezogen, den Schnabel zur Abwehr geöffnet, erwartet er
den Angriff. Plötzlich schnellt er den langen Hals blitzschnell
vor und sucht seinem Gegner einen Schnabelhieb zu versetzen.
Doch dieser ist auf seiner Hut, und der Gänsegeier nimmt
wieder die abwartende Stellung ein. Aber nicht lange wird
es dauern, so stürzt sich der Bartgeier auf ihn, und inein-
ander gekrallt werden die Könige der Lüfte einen wüthenden
Kampf ausfechten. Es ist kanm daran zu zweifeln, daß der
stärkere Bartgeier endlich den Sieg davonträgt und sich als-
dann mit seinem Weibchen in die Beute theilt, während der
Gänsegeier zerzaust und blutend davonfliegt, uni eine andere
Beute für seinen hungrigen Magen zu suchen. So zeigt uns
die Natur überall den erbittertsten Kampf um's Dasein, und
selbst der Starke mnß dem noch Stärkeren weichen.
Än der Spinn sinke.
(Siehe das Bild auf Seite 141.)
?>er Ander! war ein schmucker Bauerssohn, den die Mädel
im Dorf Alle gern hatten. Hinzu kam, daß er in ihren
Augen bei seinen der Männlichkeit zuwachsendsn Jahren als
dcr Erbe eines der besten Bauerngüter etwas galt. Die, für
welche er sich einmal entschied, um sie als sein Weib heimzu-
führen, konnte lachen. Gewohnheitsmäßig kam er in die
Spinnstuben, wenn er da zur rechten Stunde die Haus- und
Nachbarmädel beim Geplauder zusammenfand, indeß sie nach
alter Weise den Faden von Flachswocken abschnurren ließen,
und ihm gestand man das Vorrecht zu, sich da einzustellen,
mitzuplauschen und seine Scherze zu machen. Aus solchem
Scherz kann ja einmal Ernst werden. Wie er nun diesmal
kam, recht säuberlich in seiner Jacke, in den an der Seite be-
stickten Lederhossn, in den weißen Gamaschen, die Galainütze
auf dem Kopf, das Pfeifchen in der Hand, war er in aller-
bester Laune. Gleich nahm er den Wollen der hübschen Amrei
und hielt ihn hinter seinem Rücken; das schlaue Gesicht, das
er dazu macht, läßt ja errathen, daß er dabei fragt: „Was
gibt mir Die, der der Wocken gehört?" Eins Frage, welche
die drei vor ihren Spinnrädern zusnmmensitzenden Mädchen
lachen macht. Aber was wird Dio, welche diese Frage an-
geht, ihm wohl geben? DaS Bild von L. Blume-Siebert,
das im Holzschnitt auf S. 141 wiedergegeben ist, läßt es
errathen: ihr Herz. So webt sich diesmal das Glück zweier
Liebenden in der Spinnstube.
Sitder aus dem Lcrliner Äljnarinm.
(Ziehe die Illustration auf Seite 145)
"T^as zu den Sehenswürdigkeiten der deutschen Neichshaupt-
stadt gehörige „Aquarium" liegt in der schönsten Straße
Berlins „Unter den Linden" an der Elle der Schadowftraße,
nnd trat 1867 als Akticnunternehmen in's Leben. Dcr Ban
wurde von dem vortrefflichen Baumeister Lüer aus Hannover
ausgeführt und in l'/s Jahren soweit fertig gestellt, daß die
Eröffnung des in seiner Art mustergiltigen Instituts am
11. Mai 1869 stattfinden konnte. Seit jener Zeit hat das
Berliner Aquarium unter der sachverständigen und geschickten
Leitung des vr. Hermes seine Anziehungskraft stetig gesteigert
nnd als natürliche Ergänzung des berühmten Zoologischen
Gartens mitgeholfen, naturwissenschaftliche Kenntnisse auf die
anschaulichste und interessanteste Weise in den weitesten Kreisen
der Bevölkerung zu befördern. Das Berliner Aquarium enthält
nicht ausschließlich, wie man nach dem Namen eigentlich anneh
men sollte, Wasserthiere, sondern auch eine Anzahl Kricchthiere,
Vögel und Säugethiere, seit 1889 sind sogar die Reptilien
und Amphibien des Zoojogischen Gartens im Aquarium unter-
gebracht worden, welches dadurch an Interesse noch bedeutend
gewonnen hat. Der Eintritt kostet eine Mark und ist von
9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends im Winter, bis 7 Uhr
im Sommer geöffnet. Wir wollen heute an der Hand unseres
Bildes auf S. 145 unsere Leser einen Besuch im Berliner Aqua-
rium machen lassen, der ihnen einige der Hauptsehenswürdig
leiten dieses hervorragenden naturwissenschaftlichen Instituts
vor Augen führt. Man betritt das Aquarium durch den
Eingang „Unter den Linden". Durch das Treppenhaus,
dessen Ausstattung bereits den Eindruck macht, als ob man
in eine unterirdische Grotte hinab steige, gelangt man zunächst
in den Schlangengang, wo in hohen Käfigen, welche vorn
durch große Spiegelscheiben abgeschlossen sind, sich die inter
essantesten Schlangen und Kriechthierc der Erde befinden. Hier
ist es der Krokodilsteich, der die Besucher mit am meisten
fesselt, da die Schlangen meist in träger Ruhe zusammengerollt
daliegcn und wenig Lust zeigen, sich bewundern zu lassen.
Vom Schlangengang führen einige Stufen abwärts zur geo-
logischen Grotte." Diese stellt einen idealen Durchschnitt "der
Erdrinde dar und ist von Vögeln aller Zonen bevölkert- An
diese schließt sich das große Vogelhalls, auch Voliüre genannt,
an, in welchem nicht nur zahlreiche seltene Vögel untergebracht
sind, sondern das auch einige Käfige enthält, in denen hinter
Spiegelscheiben eine Anzahl Affen der alten und neuen Welt
sich den Augen des Besuchers darstellen. Das Affenhaus
übt stets eine Hauptanziehungskraft aus, besonders da sich
Das Buch für Alle.
148
Spuren einer nülden Flucht waren an der Bekleidung
erkennbar. Mit einem ergreifenden Ausdruck bangen
Flehens schweiften ihre großen blauen Augen von Einem
zum Andern. Zagen ergriff sie, daß sie kein Wort
hervorzubringen vermochte. Es lähmten ihre Zunge
die auf sie gerichteten Blicke der ernst schauenden Männer.
Ihre Angst erhöhte die düstere, höhlenartige Umgebung
mit den vielen Merkmalen eines rauhen Gewerbes.
Vilandrie hatte gleich nach ihrem Eintritt Späne auf die
Kamingluth geworfen. Die wachsende Helligkeit und
der Anblick Jurassiers, die mit der bräunlichen Gefährtin
abseits stand und sie von dort aus mitleidig betrachtete,
schienen den gänzlich gesunkenen Muth der jungen Frem-
den wieder zu beleben. Tief auf athmete sie. Die Lippen
öffneten sich zu einer Anrede, als Laboux, ihre Noth
begreifend und würdigend, ihr mit den Worten zuvor-
kam: „Sie befinden sich in meinem Hause so sicher,
wie nur je als Baby auf dem Schoß Ihrer Mutter.
Hier darf Ihnen kein Haar gekrümmt werden: das
lassen Sie sich gesagt sein. Sie sehen da die junge
Lady. Mit der fetzen Sie sich Seite an Seite, bevor
Ihre kleinen Füße Ihnen den Dienst versagen. Und
Du, Marion," rief er seiner anmuthigen Tochter zu,
„sorge für einen warmen Trunk und etwas Festeres
dazu."
„Gott sei Dank," entquoll es gleichsam dem ängstlich
pochenden Herzen, und von Jurassie unterstützt, ließ
die junge Fremde sich neben ihr nieder. Und weiter
sprach sie, als das aufstcigende Blut ihre ohnehin er-
hitzten Wangen zu sprengen drohte: „Weisen Sie mich
nicht fort — retten Sie mich vor meinen Verfolgern —
ich flehe Sic an um des Himmels willen —"
„Ruhig, ruhig, meine junge Lady," unterbrach Laboux
sie beschwichtigend, „hier bedarf es keines Flehens und
Beschwörens. Wer meine Gastfreundschaft anruft, ist
nur heilig und soll es auch Anderen sein. Ich kalkulir',
Sie haben von einem der am Fluß lagernden Emigranten-
züge Ihren Weg hierher genommen."
„Ja, ich ertrug es nicht länger," hieß es unter an-
bringenden Thrüncn zurück, „ich mußte flüchten, sollte
ich nicht verzweifeln. Die Lage dieses Hauses war mir
von — von Jemand beschrieben worden. Dann sah ich
ben Rauch der Schornsteine aus der Ferne. Es war die
letzte Gelegenheit, dem Verderben zn entrinnen; da benntztc
ich die hereinbrechende Dunkelheit zu Flucht. Man
wird mich bald vermissen, wenn es nicht schon geschah,
find mich verfolgen. Lieber aber null ich sterben, als noch
einmal dahin zurückkehren, wo das Schrecklichste über
mich verhängt wird."
Wie die anderen Anwesenden, mochte auch Laboux
bie eben vernommenen Betheuerungen mit der ganzen
^sschcinung des kaum dem Kindesalter entwachsenen
reizvollen Mädchens vergleichen, denn erst nach kurzem
binnen antwortete er tröstlich: „Wohin Sie nicht
wollen, dahin brauchen Sie nicht zu gehen: und daß
Man Sie nicht mit Gewalt fortschleppt, dafür bin ich
ver Mann."
„Aber ich zähle erst fiebenzehn Jahre — nur einige
Monate darüber Jemand sprach zu mir von Minder-
jährigkeit und vem Recht eines Vormundes —"
„Zum Henker damit! Zählten Sie erst sieben Jahre,
Machte es keinen Unterschied in diesem Theil des Landes.
Doch fassen Sie sich zuvörderst, und widerstrebt es Ihnen
uicht, dann erzählen Sie mit 'n paar Worten, um was
ks sich handelt. Das gibt mir vielleicht eine Handhabe,
kür Sie einzutreten, wenn es nöthig sein sollte."
Die junge Fremde dachte nach. Sie kämpfte
ffffenbnr mit sich selbst. Der sanfte Druck, mit der
>stirassie ihre Hand hielt, führte indessen eine schnelle
Entscheidung herbei; denn wiederum die Blicke der
sie theilnahmvoll beobachtenden Männer suchend, hob
sie schüchtern an: „Es ist wohl meine Pflicht, Sie
mit den Umstünden vertraut zu machen, die mich zum
Davonlaufen bewogen. Ich flüchtete von der Karawane,
bie der Bruder meines verstorbenen Vaters ausrüstete,
^uch die Mutter verlor ich, als ich noch sehr jung war,
und so kam es, daß der Onkel mich in seine Familie
aufnahm. Dort lebte ich zufrieden und glücklich, doch
Mir so lange, bis — bis —" die Sprache versagte ihr.
Dengende Gluth schoß in ihr Antlitz. Thränen der
Angst und Verwirrung liefen in ihren Augen zusammen.
„Scheuen Sie sich nicht, offen zu reden," ermuthigte
Laboux, „wird's Ihnen aber schwer, mit einem ordent-
uchen Bekenntnis) herauszurücken, so will ich versuchen,
bas Betreffende von Ihrem hübschen Angesicht herunter
M lesen. Also: bis — bis irgend ein verwegener
Bursche sich in Ihr unschuldiges junges Herzchen ein-
lchlich und Ihnen mit allen nur denkbaren Eiden zu-
lchwor, ohne Sic nicht leben oder sterben zu können."
Erstaunt sah die junge Fremde zu dem bezeichnend
tzvinsendcn Pelztanscher auf. Kindlicher Unglaube lugte
aus ihren Augen.
„Ich verrieth es nicht —" stotterte sie in ihrer Ver-
Menheit mit einem Ausdruck, daß sogar Jurassie eines
fächelns sich nicht zu enthalten vermochte, und aus seine
Art neckisch fiel Laboux ein:
„Aber ich crricth es, und das lassen Sic sich nicht
bereuen. Ist das Geheimniß heraus, so sand cs seinen
Weg zu Ohren, in denen es sicher genug aufbewahrt
ist. Und nuic weiter, meine herzige junge Ausreißerin:
das mit dem Burschen hat also seine Richtigkeit.
Vielleicht trifft's auch zu, wenn ich muthmaße, daß
andere Leute diese Angelegenheit nicht billigten und
zwischen Sie Beide traten —"
«Fortf-tzung folgt.)
Giomumi Giolitti.
(Liehe das Porträt auf Seite 137.)
7>er gegenwärtige italienische Ministerpräsident Giovanni
Giolitti, dessen Porträt wir auf S. 187 bringen, ist seit
Ende Mai 1892 als Nachfolger di Rndini's im Amte. Er
ist Piemontese und am 27. Oktober 1842 zu Mondovi in der
Provinz Cuneo geboren, woselbst sein Vater Gerichtssekretür
>var. Nachdem er seine Studien beendet hatte, erwarb Gio-
litti 1864 den juristischen Doktorgrad und trat in die Be-
amtsnlaufbahn ein. Bereits mit vierundzwanzig Jahren wurde
er zum stellvertretenden Staatsanwalte ernannt, bis ihn Fi-
nanzminister Sella, der wußte, daß er sich eifrig mit wirth-
schaftlichen und finanziellen Fragen befaßte, zum Uebertritt in
die Direktion des Steuerwesens veranlaßte. 1876 wurde er
Generalsekretär bei der Oberrechnnngskammer und 1882 Staats-
rath. Gleichzeitig wurde Giolitti in die Kammer gewählt,
wo er als Mitglied des Budgetausschusses bald Gelegenheit
fand, sich durch die scharfe, an deni damaligen Finanzminister
Magliani geübte Kritik hervorzuthun. Zu positiver Bethäti-
gung seiner finanziellen Begabung berief ihn Crispi am
7. März 1889 zum Schatzminister, und als Seismit-Dodn daS
Finanzministerium niederlegen mußte, übernahm Giolitti auch
dieses Portefeuille am 19. November 1890 im Nebenamte.
Nach wenigen Wochen jedoch ließ Crispi ihn wegen einer
Meinungsverschiedenheit mit dem Arbeitsminister Finali fallen,
wofür dann wieder bald darauf Giolitti sich unter denen be-
fand, die das Ministerium Crispi stürzten. Unter Rudini
trat er wieder in den Vordergrund, sowohl als Finanzkritiker,
wie auch als Führer der dem Kabinet unentbehrlichen pie-
montesischen Gruppe des linken Centrnms. Als Rudini dann
in der Osterkrisis 1892 sein bereits wankendes Ministerium
durch neue Kräfte aufzufrischen gedachte, wandte er sich in
erster Linie all Giolitti, der jedoch ablchnte, unter ihm Finanz-
oder Schatzminister zu werden. Dagegen nahm er schon we-
nige Tage nachher seine Gelegenheit wahr, stürzte das Kabinet
Rudini und übernahm die Neubildung der Regierung. Sein
Ministerium stellt sich in seiner Gesammtheit als ein Kabinet
der gemäßigten Linken dar, fand aber bei seinem ersten Auf-
treten in Kammer und Senat am 26. Mai eine so miß-
fällige Aufnahme — das geforderte Vertrauensvotum ward
nur mit 9 Stimmen Mehrheit bei 38 Stimmenenthaltungen
angenommen - daß es sofort sein Entlassungsgesuch ein
reichte. König Humbert nahm dies jedoch nicht an, wovon
der Ministerpräsident der Kammer Mittheilung machte, indem
er gleichzeitig bat, dieselbe möge die dringendsten Gesetzent-
würfe vatiren und provisorisch sechs Zwölftel des Budgets
bewilligen. Diese Vorlage wurde angenommen, was als ein
Sieg des Kabinets betrachtet werden konnte, das voraussichtlich
den Versuch machen wird, durch Auflösung der Kammer und
Neuwahlen eine Regierungsmehrheit zu gewinnen.
Lari- und Giilisegein' streiten um einen gesinnten
Katschkar.
(Siehe das Bild auf Seite 140.)
")Iuf den unfruchtbaren Gefilden des gewaltigen Hochplateau's
von Tibet lebt oberhalb der Baumgrenze der Katschkar oder
das Pamirschaf, die größte aller Schafarten. Der Katschkar
erreicht fast die Größe des Edelhirsches, indem seine Länge
ohne Schwanz über 2 Meter, seine Schulterhöhe 1,2 Meter
und sein Gewicht gegen 230 Kilo beträgt. Die riesigen Hörner
des Männchens stehen an der Basis zusammen und haben
dort 50 Millimeter Umfang; sie bilden einen vollständigen,
1.5 Meter langen Kreisbogen und sind mit starken, nahe an-
einander liegenden Ringen besetzt. Beim Weibchen sind die
Hörner klein, ähneln denen der Ziege und sind dicht beringt.
Rings um den Hals befindet sich eine lange, wollige Mähne.
Die Farbe des Thieres ist braun mit dunklem Rückenstreifen.
Der Katschkar lebt in kleinen, bis dreißig Stück zählenden
Heerden, welche von einem alten Bock geführt werden. Mit
erstaunlicher Behendigkeit klettern die Thiere an den steilen
Felsabhängen umher und überspringen mit unfehlbarer Sicher-
heit die klaffenden Felsspalten. Bei den Kirgisen herrscht
der Glaube, daß sie sich beim Abstürzen von einem Felsen
auf die starken Hörner fallen lassen, um die Gewalt des An-
pralls zu brechen. Furchtsam und ängstlich sucht sich der
Katschkar jeder Gefahr durch schleunige Flucht zu entziehen.
Nur zur Brunstzeit zeigt sich der Bock kühn im Kampfe gegen
einen Nebenbuhler. Alsdann hallt das Gebirge wieder von
den, einem Pistolenknall ähnlichen Stößen, mit welchen die
harten Schädel aneinander prallen, und dann ereignet es sich
nicht selten, daß einer der Kämpfer über die jähe Felswand hin-
nusgedrangt wird, in die Tiefe stürzt und zerschellt, eine will-
kommene Beute für die zahlreichen Raubthiere, welche sich in
diesen Gegenden vorfinden. Aus schwindelnder Höhe hat ein
Gänsegeier den Sturz des Katschkars beobachtet. Mit der
Leichtigkeit des Falken und in vielfachen Schwenkungen schwebt
er rasch herab und läßt sich auf den noch zuckenden Körper
nieder. Der Gänsegeier bietet einen eigenthümlichen Anblick.
Der schlanke Kopf mit verhältnismäßig schwachem Schnabel
geht in einen langen gänseartigen Hals über, welcher spärlich
mit weißlichen, flanmartigen Federn besetzt ist. Das Gefieder
ist gleichmäßig hellbraun, auf der Unterseite etwas dunkler
als auf der Oberseite. Aufrecht steht er auf seinen niedrigen
Füßen; ein mächtiges Thier von über 1 Meter Länge und
2.5 Meter Breite. Schon will er beginnen, ein Loch in die
Bauchwand seiner Beute zn schlagen, rny, wie es seine Ge-
wohnheit ist, die Eingeweide herauszureißen, da rauscht es mit
mächtigen Flügelschlägcn heran, und ein Bart- oder Lämmer
geier, der ebenfalls die leckere Beute gewittert hat, läßt sich,
gefolgt von seinem Weibchen, in nächster Nähe auf einein
Felsen nieder. Seine Gestalt ist edler als die des Gänse-
geiers. Der große Kopf trägt einen langen und großen
Schnabel, der an seinem Grunde von Borstenbündeln um-
geben ist. Der Oberschnabel ist an der Spitze stark hakig ge-
krümmt. Der kurze Hals ist mit großen Federn bedeckt. Das
Gefieder ist rostgelb, auf dem Rücken, den Oberflügeln und
den oberen Schwanzfedern schwarz. Die Größe übertrifft noch
etwas die des Gänsegeiers. Mit erhobenen Flügeln und weit
geöffnetem Schnabel fährt der Bartgeier auf seinen Gegner los,
um ihm die Beute streitig zu machen (siehe das Bild auf
S. 140), aber dieser läßt sich nicht einschüchtern. Er ist muthig,
jähzornig und tückisch. Mit gesträubtem Gefieder, den Hals
eingezogen, den Schnabel zur Abwehr geöffnet, erwartet er
den Angriff. Plötzlich schnellt er den langen Hals blitzschnell
vor und sucht seinem Gegner einen Schnabelhieb zu versetzen.
Doch dieser ist auf seiner Hut, und der Gänsegeier nimmt
wieder die abwartende Stellung ein. Aber nicht lange wird
es dauern, so stürzt sich der Bartgeier auf ihn, und inein-
ander gekrallt werden die Könige der Lüfte einen wüthenden
Kampf ausfechten. Es ist kanm daran zu zweifeln, daß der
stärkere Bartgeier endlich den Sieg davonträgt und sich als-
dann mit seinem Weibchen in die Beute theilt, während der
Gänsegeier zerzaust und blutend davonfliegt, uni eine andere
Beute für seinen hungrigen Magen zu suchen. So zeigt uns
die Natur überall den erbittertsten Kampf um's Dasein, und
selbst der Starke mnß dem noch Stärkeren weichen.
Än der Spinn sinke.
(Siehe das Bild auf Seite 141.)
?>er Ander! war ein schmucker Bauerssohn, den die Mädel
im Dorf Alle gern hatten. Hinzu kam, daß er in ihren
Augen bei seinen der Männlichkeit zuwachsendsn Jahren als
dcr Erbe eines der besten Bauerngüter etwas galt. Die, für
welche er sich einmal entschied, um sie als sein Weib heimzu-
führen, konnte lachen. Gewohnheitsmäßig kam er in die
Spinnstuben, wenn er da zur rechten Stunde die Haus- und
Nachbarmädel beim Geplauder zusammenfand, indeß sie nach
alter Weise den Faden von Flachswocken abschnurren ließen,
und ihm gestand man das Vorrecht zu, sich da einzustellen,
mitzuplauschen und seine Scherze zu machen. Aus solchem
Scherz kann ja einmal Ernst werden. Wie er nun diesmal
kam, recht säuberlich in seiner Jacke, in den an der Seite be-
stickten Lederhossn, in den weißen Gamaschen, die Galainütze
auf dem Kopf, das Pfeifchen in der Hand, war er in aller-
bester Laune. Gleich nahm er den Wollen der hübschen Amrei
und hielt ihn hinter seinem Rücken; das schlaue Gesicht, das
er dazu macht, läßt ja errathen, daß er dabei fragt: „Was
gibt mir Die, der der Wocken gehört?" Eins Frage, welche
die drei vor ihren Spinnrädern zusnmmensitzenden Mädchen
lachen macht. Aber was wird Dio, welche diese Frage an-
geht, ihm wohl geben? DaS Bild von L. Blume-Siebert,
das im Holzschnitt auf S. 141 wiedergegeben ist, läßt es
errathen: ihr Herz. So webt sich diesmal das Glück zweier
Liebenden in der Spinnstube.
Sitder aus dem Lcrliner Äljnarinm.
(Ziehe die Illustration auf Seite 145)
"T^as zu den Sehenswürdigkeiten der deutschen Neichshaupt-
stadt gehörige „Aquarium" liegt in der schönsten Straße
Berlins „Unter den Linden" an der Elle der Schadowftraße,
nnd trat 1867 als Akticnunternehmen in's Leben. Dcr Ban
wurde von dem vortrefflichen Baumeister Lüer aus Hannover
ausgeführt und in l'/s Jahren soweit fertig gestellt, daß die
Eröffnung des in seiner Art mustergiltigen Instituts am
11. Mai 1869 stattfinden konnte. Seit jener Zeit hat das
Berliner Aquarium unter der sachverständigen und geschickten
Leitung des vr. Hermes seine Anziehungskraft stetig gesteigert
nnd als natürliche Ergänzung des berühmten Zoologischen
Gartens mitgeholfen, naturwissenschaftliche Kenntnisse auf die
anschaulichste und interessanteste Weise in den weitesten Kreisen
der Bevölkerung zu befördern. Das Berliner Aquarium enthält
nicht ausschließlich, wie man nach dem Namen eigentlich anneh
men sollte, Wasserthiere, sondern auch eine Anzahl Kricchthiere,
Vögel und Säugethiere, seit 1889 sind sogar die Reptilien
und Amphibien des Zoojogischen Gartens im Aquarium unter-
gebracht worden, welches dadurch an Interesse noch bedeutend
gewonnen hat. Der Eintritt kostet eine Mark und ist von
9 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends im Winter, bis 7 Uhr
im Sommer geöffnet. Wir wollen heute an der Hand unseres
Bildes auf S. 145 unsere Leser einen Besuch im Berliner Aqua-
rium machen lassen, der ihnen einige der Hauptsehenswürdig
leiten dieses hervorragenden naturwissenschaftlichen Instituts
vor Augen führt. Man betritt das Aquarium durch den
Eingang „Unter den Linden". Durch das Treppenhaus,
dessen Ausstattung bereits den Eindruck macht, als ob man
in eine unterirdische Grotte hinab steige, gelangt man zunächst
in den Schlangengang, wo in hohen Käfigen, welche vorn
durch große Spiegelscheiben abgeschlossen sind, sich die inter
essantesten Schlangen und Kriechthierc der Erde befinden. Hier
ist es der Krokodilsteich, der die Besucher mit am meisten
fesselt, da die Schlangen meist in träger Ruhe zusammengerollt
daliegcn und wenig Lust zeigen, sich bewundern zu lassen.
Vom Schlangengang führen einige Stufen abwärts zur geo-
logischen Grotte." Diese stellt einen idealen Durchschnitt "der
Erdrinde dar und ist von Vögeln aller Zonen bevölkert- An
diese schließt sich das große Vogelhalls, auch Voliüre genannt,
an, in welchem nicht nur zahlreiche seltene Vögel untergebracht
sind, sondern das auch einige Käfige enthält, in denen hinter
Spiegelscheiben eine Anzahl Affen der alten und neuen Welt
sich den Augen des Besuchers darstellen. Das Affenhaus
übt stets eine Hauptanziehungskraft aus, besonders da sich