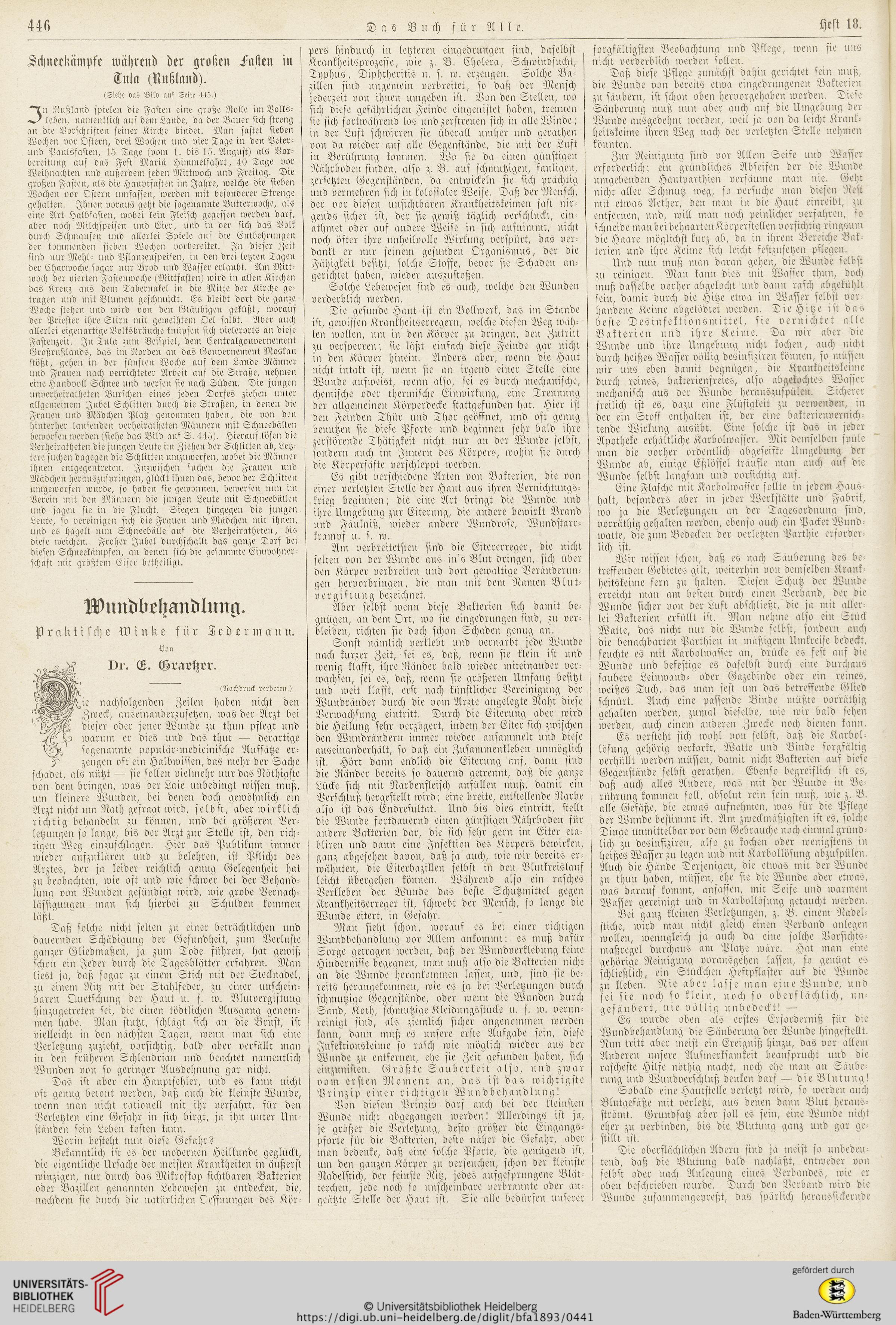446
Das Buch f ü r All e.
Lchneeknmpfc während der großen Fußen in
Tnln (Rußland).
(Siche das Bild auf Seite 4-lS.)
—ln Rußland spielen die Fasten eine große Rolle im Volks-
lebet«, namentlich auf dem Lande, da der Bauer sich streng
an die Vorschriften seiner Kirche bindet. Man fastet sieben
Wochen vor Ostern, drei Wochen und vier Tage in den Peter-
und Paulsfasten, 15 Tage (vom 1. bis 15. August) als Vor-
bereitung auf daS Fest Mariä Himmelfahrt, 40 Tage vor
Weihnachten und außerdem jeden Mittwoch und Freitag. Die
großen Fasten, als die Hauptfastsn im Jahre, welche die sieben
Wochen vor Ostern umfassen, werden mit besonderer Strenge
gehalten. Ihnen voraus geht die sogenannte Butterwoche, als
eine Art Halbfasten, wobei kein Fleisch gegessen werden darf,
aber noch Milchspeisen und Eier, und in der sich das Volk
durch Schmausen und allerlei Spiele auf die Entbehrungen
der kommenden sieben Wochen vorbereitet. In dieser Zeit
sind nur Mehl- und Pflanzenspeisen, in den drei letzten Tagen
der Eharwoche sogar nur Brod und Wasser erlaubt. Am Mitt-
woch der vierten Fastenwoche (Mittfasten) wird in allen Kirchen
das Kreuz aus dem Tabernakel in die Mitte der Kirche ge-
tragen und mit Blumen geschmückt. Es bleibt dort die ganze
Woche stehen und wird von den Gläubigen geküßt, worauf
der Priester ihre Stirn mit geweihtem Oel salbt. Aber auch
allerlei eigenartige Volksbräuche knüpfen sich vielerorts an diese
Fastenzeit. In Tula zum Beispiel, dem Eentralgouvernement
Großrußlands, das im Norden an daS Gouvernement Moskau
stößt, gehen in der fünften Woche auf dem Lande Männer
und Frauen nach verrichteter Arbeit auf die Straße, nehmen
eine Handvoll Schnee und werfen sie nach Süden. Die jungen
unverheiratheten Burschen eines jeden Dorfes ziehen unter
allgemeinem Jubel Schlitten durch die Straßen, in denen die
Frauen und Mädchen Platz genommen haben, die von den
hinterher lausenden vcrheiratheten Männern mit Schneebällen
beworfen werden (siehe das Bild auf S. 445). Hierauf lösen die
Verheiratheten die jungen Leute im Ziehen der Schlitten ab, Letz
tere suchen dagegen die Schlitten umzuwerfen, wobei die Männer
ihnen entgegentretcn. Inzwischen suchen die Frauen und
Mädchen herauszuspriugen, glückt ihnen das, bevor der Schlitten
umgeworfcn wurde, so haben sie gewonnen, bewerfen nun im
Verein mit den Männern die jungen Leute mit Schneebällen
und jagen sie in die Flucht. Siegen hingegen die jungen
Leute, so vereinigen sich die Frauen und Mädchen mit ihnen,
und es hagelt nun Schneebälle auf die Verheiratheten, bis
diese weichen. Froher Jubel durchschallt das ganze Dorf bei
diesen Schneekämpfen, an denen sich die gesummte Einwohner-
schaft mit größten« Eifer betheiligt.
Wundbehandlung.
praktische Minke für Jede rin nun.
Von
sic nachfolgenden Zeilen haben nicht den
Zweck, auseinanderzusetzen, was der Arzt bei
dieser oder jener Wunde zu thun pflegt und
warum er dies und das thut — derartige
sogenannte populär-inedicinische Aufsätze er-
zeugen oft ein Halbwissen, das mehr der Sache
schadet, als nützt — sie sollen vielmehr nur das Nöthigste
von dem bringen, was der Laie unbedingt wissen muß,
um kleinere Wunden, bei denen doch gewöhnlich ein
Arzt nicht nm Rath gefragt wird, selbst, aber wirklich
richtig behandeln zu können, und bei größeren Ver-
letzungen so lange, bis der Arzt zur Stelle ist, den rich-
tigen Weg einzuschlagen. Hier das Publikum immer
wieder aufzuklären und zu belehren, ist Pflicht des
Arztes, der ja leider reichlich genug Gelegenheit hat
zu beobachten, wie oft und wie schwer bei der Behand-
lung von« Wunden gesündigt wird, wie grobe Vernach-
lässigungen man sich hierbei zu Schulden kommen
läßt.
Daß solche nicht selten zu einer beträchtlichen und
dauernde«« Schädigung der Gesundheit, zum Verluste
ganzer Gliedmaßen, ja zum Tode führen, hat gewiß
schon eii« Jeder durch die Tagesblätter erfahre««. Alan
liest ja, daß sogar zu einem Stich mit der Stecknadel,
zu einem Ritz mit der Stahlfeder, zu einer unscheiu-
baren Quetschung der Haut u. s. w. Blutvergiftung
hinzugetreten sei, die eine«« tödtlicheu Ausgang genom-
men habe. Alan stutzt, schlägt sich an die Brust, ist
vielleicht in den nächsten Tagen, «venu man sich eine
Verletzung zuzieht, vorsichtig, bald aber verfällt man
ii« den frühere«« Schlendrian und beachtet nnmentlich
Wunden von so geringer Ausdehnung gar «richt.
Das ist aber ein Hauptfehler, und es kann «richt
oft genug betont werde««, daß auch die kleinste Wunde,
wem« man nicht rationell mit ihr verfährt, für den
Verletzte«« eine Gefahr in sich birgt, ja ihr« unter Um-
ständen sein Lebe«« koste«« kann.
Worin besteht nun diese Gefahr?
Bekanntlich ist cS der modernen Heilkunde geglückt,
die eigentliche Ursache der meisten Krankheiten in äußerst
winzigen, nur durch das Mikroskop sichtbaren Bakterien
oder Bazille«« genannten Lebewesen zu entdecken, die,
nachdem sie durch die natürlichen Sesfnungen des Kör-
pers hindurch in letzteren eiugedrungen sind, daselbst
Krankheitsprozesse, wie z. B. Cholera, Schwindsucht,
Typhus, Diphtheritis u. s. w. erzeugen. Solche Ba-
zille«« sind ungemein verbreitet, so daß der Mensch
jederzeit von ihnen umgeben ist. Von den Stellen, wo
sich diese gefährliche«« Feinde eingenistet habe««, trennen
sie sich fortwährend los und zerstreuen sich in alle Winde;
ii« der Luft schwirre«« sie überall umher und gerathen
von da wieder auf alle Gegenstände, die mit der Luft
in Berührung kommen. Wo sie da einen günstigen
Nährboden finden, also z. B. aus schmntzigcn, fauligen,
zersetzte«« Gegenständen, da entwickel«« sie sich prächtig
und vermehren sich in kolossaler Weise. Daß der Mensch,
der vor diese«« unsichtbaren KraukheitSkeimen fast nir-
gends sicher ist, -er sie gewiß täglich verschluckt, ein-
athinet oder auf andere Weise ii« sich aufnimmt, nicht
«roch öfter ihre unheilvolle Wirkung verspürt, das ver-
dankt er nur seinem gesunde«« Organismus, der die
Fähigkeit besitzt, solche Stoffe, bevor sie Schaden an-
gerichtet habe««, wieder auszustoßen.
Solche Lebewesen sind es auch, welche de«« Wunden
verderblich werden.
Die gesunde Haut ist ein Bollwerk, das im Stande
ist, gewisse«« Krankheitserregern, welche diese«« Weg wäh-
le«« «vollen, un« ii« den Körper zu dringen, den Zutritt
zu versperren; sie läßt einfach diese Feinde gar nicht
in dei« Körper hinein. Anders aber, wenn die Haut
nicht intakt ist, wenn sie an irgend einer Stelle eine
Wunde anfweist, wenn also, sei es durch mechanische,
chemische oder thermische Einwirkung, eine Trennung
der allgemeinen Körperdecke stattgefunden hat. Hier ist
dei« Feinde«« Thür und Thor geöffnet, und oft genug
benutzen sic diese Pforte und beginnen sehr bald ihre
zerstörende Thätigkeit nicht nur an der Wunde selbst,
sonder«« auch im Innern des Körpers, wohin sie durch
die Körpersäfte verschleppt werden.
Cs gibt verschiedene Arte«« von Batterien, die von
einer verletzte«« Stelle der Haut aus ihren Vernichtungs-
krieg beginnen; die eine Art bringt die Wunde und
ihre Umgebung zur Eiterung, die andere bewirkt Brand
und Fäulnis«, «nieder andere Wundrose, Wundstarr-
krampf ««. s. w.
Am verbreitetste«« sind die Eitererreger, die nicht
selten von der Wunde aus ins Blut dringen, sich über
dei« Körper verbreite«« und dort gewaltige Veränderun-
gen hervorbringen, die man mit dem Namen Blut-
vergiftung bezeichnet.
Aber selbst wenn diese Bakterie«« sich damit be-
gnügen, an den« Ort, wo sie eingedrungen sind, zu ver-
bleiben, richte«« sie doch schon Schaden genug an.
Sonst nämlich verklebt nnd vernarbt jede Wunde
nach kurzer Zeit, sei es, daß, wenn sie klein ist und
wenig klafft, ihre Ränder bald wieder miteinander ver-
wachsen, sei es, daß, wenn sie größere«« Umfang besitzt
nnd weit klafft, erst nach künstlicher Vereinigung der
Wundränder durch die von« Arzte angelegte Naht diese
Verwachsung eintritt. Durch die Eiterung aber wird
die Heilung sehr verzögert, indem der Eiter sich zwischen
dei« Wundrändern immer «nieder ansammelt nnd diese
auseinanderhült, so daß eii« Zusammenkleben nnmöglich
ist. Hört dann endlich die Eiterung auf, dann sind
die Ränder bereits so dauernd getrennt, daß die ganze
Lücke sich mit Narbenfleisch anfüllen muß, damit eii«
Verschluß hergestellt wird; eine breite, entstellende Narbe
also ist das Endresultat. Und bis dies eintritt, stellt
die Wunde fortdauernd eine«« günstige«« Nährboden für
andere Bakterie«« dar, die sich sehr gern in« Eiter eta-
bliren und -an«« eine Infektion des Körpers bewirken,
ganz abgesehen davon, daß ja auch, wie mir bereits er-
wähnte», die Eiterbazillcn selbst ii« den Blutkreislauf
leicht übergehen können. Während also eii« rasches
Verklebe«« der Wänrde das beste Schutzmittel gegen
Krankheitserreger ist, schwebt der Mensch, so lange die
Wunde eitert, ii« Gefahr.
Man sieht schon, «voraus es bei einer richtige««
Wundbehandlnng vor Allem ««»kommt« es muß dafür
Sorge getragen werden, daß der Wundvcrklebung keine
Hindernisse begegnen, man mnß also die Bakterien nicht
an die Wunde herankommen lasse««, und, sind sie be-
reits herangekommen, wie es ja bei Verletzungei« durch
schmutzige Gegenstände, oder wenn die Wunde«« durch
Sand, Koth, schmutzige Kleidungsstücke u. s. «v. verun-
reinigt sind, als ziemlich sicher angenommen werden
kam«, dann muß eü unsere erste Aufgabe sei««, diese
Jnfcktionskeimc so rasch wie möglich wieder aus der
Wunde zu entfernen, ehe sie Zeit gesunde«« haben, sich
einzunisten. Größte Sauberkeit also, uud zwar
von« ersten Moment an, das ist das wichtigste
Prinzip einer richtige«« Wundbehandlung!
Von diesen« Prinzip darf auch bei der kleinsten
Wunde nicht abgegangen werde««! Allerdings ist ja,
je größer die Verletzung, desto größer die Eingangs-
pforte für die Bakterien, desto näher die Gefahr, aber
«na«« bedenke, daß eine solche Pforte, die genügend ist,
un« de«« ganze«« Körper zu verseuchen, schon der kleinste
Nadelstich, der feinste Ritz, jedes aufgesprungene Müt-
terchen, jede noch so unscheinbare verbrannte oder an-
geätzte Stelle der Haut ist. Sie alle bedürfe«« unserer
M 16.
sorgfältigsten Beobachtung und Pflege, wen«« sie nns
nicht verderblich werden solle««.
Daß diese Pflege znnächst dahin gerichtet sei«« muß,
die Wunde von bereits etwa eingedrungenen Bakterien
zu säubern, ist schon oben« hervorgehoben worden. Diese
Säuberung mnß nun aber auch ans die Umgebung der
Wunde ausgedehnt werden, «veil ja von da leicht Krank-
heitskeime ihren Weg nach der verletzten Stelle nehme««
könnten.
Zur Reinigung sind vor Alle««« Seife und Wasser
erforderlich; ei«« gründliches Abseifen der die Wunde
umgebenden Hautparthiei« versäume man nie. Gebt
nicht aller Schmutz weg, so versuche man diese«« Rest
mit etwas Aether, den man ii« die Haut einreibt, zu
entfernen, und, will man noch peinlicher verfahren, so
schneide inan bei behaarte«« Körperstellen vorsichtig ringsum
die Haare möglichst kurz ab, da in ihre«» Bereiche Bak-
terien und ihre Keime sich leicht sestznsetzen pflegen.
Und nun muß mau daran gehen, die Wunde selbst
zu reinigen. Mai« kam« dies mit Wasser thun, doch
muß dasselbe vorher abgekocht und dann rasch abgckühlt
sein, damit durch die Hitze etwa in« Wasser selbst vor-
handene Keime abgetödtet werde««. Die Hitze ist das
beste Desinfektionsmittel, sie vernichtet alle
Bakterie«« nnd ihre Keime. Da wir aber die
Wunde und ihre Umgebung nicht kochen, auch nicht
durch heißes Wasser völlig desinfiziren können, so müsse««
«vir u«is eben damit begnügen, die Krankheitskeime
durch reines, bakterienfreies, also abgekochtes Wasser
mechanisch aus der Wunde herauszuspülen. Sicherer
freilich ist es, dazu eiue Flüsigkeit zu verwenden, ii«
der ein Stoss enthalte«« ist, der eine bakterienvcrnich
tende Wirkung ausübt. Eine solche ist das in jeder
Apotheke erhältliche Karbolwasser. Mit demselben spüle
man die vorher ordentlich abgeseifte Umgebung der
Wunde ab, einige Eßlöffel träufle mau auch auf die
Wunde selbst langsam und vorsichtig ans.
Eine Flasche mit Karbolwasser sollte ii« jedem Haus-
halt, besonders aber ii« jeder Wcrkstütte und Fabrik,
wo ja die Verletzungen an der Tagesordnung sind,
vorräthig gehalte«« werden, ebenso auch ein Packet Wund-
watte, die zum Bedecke«« der verletzten Parthie erforder-
lich ist.
Wir wissen schon, daß es nach Säuberung des be-
treffende«« Gebietes gilt, weiterhin von demselben Krank
heitskeime fern zu halten. Diesen Schutz der Wunde
erreicht man am beste«« durch einen Verband, der die
Wunde sicher von der Luft abschließt, die ja mit aller-
lei Bakterie«« erfüllt ist. Man nehme also eii« Stück
Watte, das nicht nur die Wunde selbst, sondern auch
die benachbarte«« Parthie» in müßigem Umkreise bedeckt,
feuchte es «nit Karbolwasser an, drücke es fest auf die
Wunde und befestige es daselbst durch eine durchaus
saubere Leinwand- oder Gazebinde oder ein reines,
weißes Tuch, das man fest um das betreffende Glied
schnürt. Auch eine passende Binde müßte vorräthig
gehalten werden, zumal dieselbe, wie «vir bald sehen
werden, auch einem andere«« Zwecke noch dienen kam«.
Es versteht sich wohl von selbst, daß die Karbol-
lösung gehörig verkorkt, Watte und Binde sorgfältig
verhüllt werden «Nüssen, damit nicht Bakterien aus diese
Gegenstände selbst gerathen. Ebenso begreiflich ist es,
daß auch alles Andere, was «nit der Wunde ii« Be-
rührung komme«« soll, absolut rein sein muß, wie z. B.
alle Gefäße, die etwas aufnehmen, was für die Pflege
der Wunde bestimmt ist. Am zweckmäßigsten ist es, solche
Dinge unmittelbar vor den« Gebrauche noch einmal gründ-
lich zu desinsizireu, also zu koche«« oder wenigstens in
heißes Wasser zu lege«« und «nit Karbollösung abzuspülen.
Auch die Hände Derjenigen, die etwas mit der Wunde
zu thun haben, müssen, ehe sie die Wunde oder etwas,
was darauf kommt, anfassen, mit Seife und warmem
Wasser gereinigt und in Karbollösung getaucht werden.
Bei ganz kleine«« Verletzungen, z. B. einem Nadel-
stiche, wird man nicht gleich einen Verband anlegen
wollen, wenngleich ja mich da eine solche Vorsichts
maßregel durchaus an« Platze wäre. Hat man eine
gehörige Reinigung vorausgehe«« lassen, so genügt es
schließlich, eii« Stückchen Heftpflaster auf die Wunde
zu klebeu. Nie aber lasse man eine Wunde, und
sei sie noch so klein, noch so oberflächlich, un-
gesäubert, uic völlig unbedeckt! —
Es wurde obei« als erstes Erforderniß für die
Wundbehandlung die Säuberung der Wunde hingestellt.
Nun tritt aber meist ein Ereignis) hinzu, das vor alle«««
Anderen unsere Aufmerksamkeit beansprucht und die
rascheste Hilfe nöthig «nacht, noch ehe man an Säube-
rung und Wundverschluß denken darf — die Blutung!
Sobald eine Hautstelle verletzt wird, so werden auch
Blutgefäße mit verletzt, aus denen dann Blut heraus-
strömt. Grundsatz aber soll es sein, eine Wunde nicht
eher zu verbinden, bis die Blutung ganz und gar ge-
stillt ist.
Die oberflächliche«« Adern sind ja meist so unbedeu-
tend, daß die Blutung bald nachläßt, entweder voi«
selbst oder nach Anlegung eines Verbandes, wie er
oben beschrieben wurde. Durch den Verband wird die
Wunde zusammcngepreßt, daS spärlich heraussickerndc
Das Buch f ü r All e.
Lchneeknmpfc während der großen Fußen in
Tnln (Rußland).
(Siche das Bild auf Seite 4-lS.)
—ln Rußland spielen die Fasten eine große Rolle im Volks-
lebet«, namentlich auf dem Lande, da der Bauer sich streng
an die Vorschriften seiner Kirche bindet. Man fastet sieben
Wochen vor Ostern, drei Wochen und vier Tage in den Peter-
und Paulsfasten, 15 Tage (vom 1. bis 15. August) als Vor-
bereitung auf daS Fest Mariä Himmelfahrt, 40 Tage vor
Weihnachten und außerdem jeden Mittwoch und Freitag. Die
großen Fasten, als die Hauptfastsn im Jahre, welche die sieben
Wochen vor Ostern umfassen, werden mit besonderer Strenge
gehalten. Ihnen voraus geht die sogenannte Butterwoche, als
eine Art Halbfasten, wobei kein Fleisch gegessen werden darf,
aber noch Milchspeisen und Eier, und in der sich das Volk
durch Schmausen und allerlei Spiele auf die Entbehrungen
der kommenden sieben Wochen vorbereitet. In dieser Zeit
sind nur Mehl- und Pflanzenspeisen, in den drei letzten Tagen
der Eharwoche sogar nur Brod und Wasser erlaubt. Am Mitt-
woch der vierten Fastenwoche (Mittfasten) wird in allen Kirchen
das Kreuz aus dem Tabernakel in die Mitte der Kirche ge-
tragen und mit Blumen geschmückt. Es bleibt dort die ganze
Woche stehen und wird von den Gläubigen geküßt, worauf
der Priester ihre Stirn mit geweihtem Oel salbt. Aber auch
allerlei eigenartige Volksbräuche knüpfen sich vielerorts an diese
Fastenzeit. In Tula zum Beispiel, dem Eentralgouvernement
Großrußlands, das im Norden an daS Gouvernement Moskau
stößt, gehen in der fünften Woche auf dem Lande Männer
und Frauen nach verrichteter Arbeit auf die Straße, nehmen
eine Handvoll Schnee und werfen sie nach Süden. Die jungen
unverheiratheten Burschen eines jeden Dorfes ziehen unter
allgemeinem Jubel Schlitten durch die Straßen, in denen die
Frauen und Mädchen Platz genommen haben, die von den
hinterher lausenden vcrheiratheten Männern mit Schneebällen
beworfen werden (siehe das Bild auf S. 445). Hierauf lösen die
Verheiratheten die jungen Leute im Ziehen der Schlitten ab, Letz
tere suchen dagegen die Schlitten umzuwerfen, wobei die Männer
ihnen entgegentretcn. Inzwischen suchen die Frauen und
Mädchen herauszuspriugen, glückt ihnen das, bevor der Schlitten
umgeworfcn wurde, so haben sie gewonnen, bewerfen nun im
Verein mit den Männern die jungen Leute mit Schneebällen
und jagen sie in die Flucht. Siegen hingegen die jungen
Leute, so vereinigen sich die Frauen und Mädchen mit ihnen,
und es hagelt nun Schneebälle auf die Verheiratheten, bis
diese weichen. Froher Jubel durchschallt das ganze Dorf bei
diesen Schneekämpfen, an denen sich die gesummte Einwohner-
schaft mit größten« Eifer betheiligt.
Wundbehandlung.
praktische Minke für Jede rin nun.
Von
sic nachfolgenden Zeilen haben nicht den
Zweck, auseinanderzusetzen, was der Arzt bei
dieser oder jener Wunde zu thun pflegt und
warum er dies und das thut — derartige
sogenannte populär-inedicinische Aufsätze er-
zeugen oft ein Halbwissen, das mehr der Sache
schadet, als nützt — sie sollen vielmehr nur das Nöthigste
von dem bringen, was der Laie unbedingt wissen muß,
um kleinere Wunden, bei denen doch gewöhnlich ein
Arzt nicht nm Rath gefragt wird, selbst, aber wirklich
richtig behandeln zu können, und bei größeren Ver-
letzungen so lange, bis der Arzt zur Stelle ist, den rich-
tigen Weg einzuschlagen. Hier das Publikum immer
wieder aufzuklären und zu belehren, ist Pflicht des
Arztes, der ja leider reichlich genug Gelegenheit hat
zu beobachten, wie oft und wie schwer bei der Behand-
lung von« Wunden gesündigt wird, wie grobe Vernach-
lässigungen man sich hierbei zu Schulden kommen
läßt.
Daß solche nicht selten zu einer beträchtlichen und
dauernde«« Schädigung der Gesundheit, zum Verluste
ganzer Gliedmaßen, ja zum Tode führen, hat gewiß
schon eii« Jeder durch die Tagesblätter erfahre««. Alan
liest ja, daß sogar zu einem Stich mit der Stecknadel,
zu einem Ritz mit der Stahlfeder, zu einer unscheiu-
baren Quetschung der Haut u. s. w. Blutvergiftung
hinzugetreten sei, die eine«« tödtlicheu Ausgang genom-
men habe. Alan stutzt, schlägt sich an die Brust, ist
vielleicht in den nächsten Tagen, «venu man sich eine
Verletzung zuzieht, vorsichtig, bald aber verfällt man
ii« den frühere«« Schlendrian und beachtet nnmentlich
Wunden von so geringer Ausdehnung gar «richt.
Das ist aber ein Hauptfehler, und es kann «richt
oft genug betont werde««, daß auch die kleinste Wunde,
wem« man nicht rationell mit ihr verfährt, für den
Verletzte«« eine Gefahr in sich birgt, ja ihr« unter Um-
ständen sein Lebe«« koste«« kann.
Worin besteht nun diese Gefahr?
Bekanntlich ist cS der modernen Heilkunde geglückt,
die eigentliche Ursache der meisten Krankheiten in äußerst
winzigen, nur durch das Mikroskop sichtbaren Bakterien
oder Bazille«« genannten Lebewesen zu entdecken, die,
nachdem sie durch die natürlichen Sesfnungen des Kör-
pers hindurch in letzteren eiugedrungen sind, daselbst
Krankheitsprozesse, wie z. B. Cholera, Schwindsucht,
Typhus, Diphtheritis u. s. w. erzeugen. Solche Ba-
zille«« sind ungemein verbreitet, so daß der Mensch
jederzeit von ihnen umgeben ist. Von den Stellen, wo
sich diese gefährliche«« Feinde eingenistet habe««, trennen
sie sich fortwährend los und zerstreuen sich in alle Winde;
ii« der Luft schwirre«« sie überall umher und gerathen
von da wieder auf alle Gegenstände, die mit der Luft
in Berührung kommen. Wo sie da einen günstigen
Nährboden finden, also z. B. aus schmntzigcn, fauligen,
zersetzte«« Gegenständen, da entwickel«« sie sich prächtig
und vermehren sich in kolossaler Weise. Daß der Mensch,
der vor diese«« unsichtbaren KraukheitSkeimen fast nir-
gends sicher ist, -er sie gewiß täglich verschluckt, ein-
athinet oder auf andere Weise ii« sich aufnimmt, nicht
«roch öfter ihre unheilvolle Wirkung verspürt, das ver-
dankt er nur seinem gesunde«« Organismus, der die
Fähigkeit besitzt, solche Stoffe, bevor sie Schaden an-
gerichtet habe««, wieder auszustoßen.
Solche Lebewesen sind es auch, welche de«« Wunden
verderblich werden.
Die gesunde Haut ist ein Bollwerk, das im Stande
ist, gewisse«« Krankheitserregern, welche diese«« Weg wäh-
le«« «vollen, un« ii« den Körper zu dringen, den Zutritt
zu versperren; sie läßt einfach diese Feinde gar nicht
in dei« Körper hinein. Anders aber, wenn die Haut
nicht intakt ist, wenn sie an irgend einer Stelle eine
Wunde anfweist, wenn also, sei es durch mechanische,
chemische oder thermische Einwirkung, eine Trennung
der allgemeinen Körperdecke stattgefunden hat. Hier ist
dei« Feinde«« Thür und Thor geöffnet, und oft genug
benutzen sic diese Pforte und beginnen sehr bald ihre
zerstörende Thätigkeit nicht nur an der Wunde selbst,
sonder«« auch im Innern des Körpers, wohin sie durch
die Körpersäfte verschleppt werden.
Cs gibt verschiedene Arte«« von Batterien, die von
einer verletzte«« Stelle der Haut aus ihren Vernichtungs-
krieg beginnen; die eine Art bringt die Wunde und
ihre Umgebung zur Eiterung, die andere bewirkt Brand
und Fäulnis«, «nieder andere Wundrose, Wundstarr-
krampf ««. s. w.
Am verbreitetste«« sind die Eitererreger, die nicht
selten von der Wunde aus ins Blut dringen, sich über
dei« Körper verbreite«« und dort gewaltige Veränderun-
gen hervorbringen, die man mit dem Namen Blut-
vergiftung bezeichnet.
Aber selbst wenn diese Bakterie«« sich damit be-
gnügen, an den« Ort, wo sie eingedrungen sind, zu ver-
bleiben, richte«« sie doch schon Schaden genug an.
Sonst nämlich verklebt nnd vernarbt jede Wunde
nach kurzer Zeit, sei es, daß, wenn sie klein ist und
wenig klafft, ihre Ränder bald wieder miteinander ver-
wachsen, sei es, daß, wenn sie größere«« Umfang besitzt
nnd weit klafft, erst nach künstlicher Vereinigung der
Wundränder durch die von« Arzte angelegte Naht diese
Verwachsung eintritt. Durch die Eiterung aber wird
die Heilung sehr verzögert, indem der Eiter sich zwischen
dei« Wundrändern immer «nieder ansammelt nnd diese
auseinanderhült, so daß eii« Zusammenkleben nnmöglich
ist. Hört dann endlich die Eiterung auf, dann sind
die Ränder bereits so dauernd getrennt, daß die ganze
Lücke sich mit Narbenfleisch anfüllen muß, damit eii«
Verschluß hergestellt wird; eine breite, entstellende Narbe
also ist das Endresultat. Und bis dies eintritt, stellt
die Wunde fortdauernd eine«« günstige«« Nährboden für
andere Bakterie«« dar, die sich sehr gern in« Eiter eta-
bliren und -an«« eine Infektion des Körpers bewirken,
ganz abgesehen davon, daß ja auch, wie mir bereits er-
wähnte», die Eiterbazillcn selbst ii« den Blutkreislauf
leicht übergehen können. Während also eii« rasches
Verklebe«« der Wänrde das beste Schutzmittel gegen
Krankheitserreger ist, schwebt der Mensch, so lange die
Wunde eitert, ii« Gefahr.
Man sieht schon, «voraus es bei einer richtige««
Wundbehandlnng vor Allem ««»kommt« es muß dafür
Sorge getragen werden, daß der Wundvcrklebung keine
Hindernisse begegnen, man mnß also die Bakterien nicht
an die Wunde herankommen lasse««, und, sind sie be-
reits herangekommen, wie es ja bei Verletzungei« durch
schmutzige Gegenstände, oder wenn die Wunde«« durch
Sand, Koth, schmutzige Kleidungsstücke u. s. «v. verun-
reinigt sind, als ziemlich sicher angenommen werden
kam«, dann muß eü unsere erste Aufgabe sei««, diese
Jnfcktionskeimc so rasch wie möglich wieder aus der
Wunde zu entfernen, ehe sie Zeit gesunde«« haben, sich
einzunisten. Größte Sauberkeit also, uud zwar
von« ersten Moment an, das ist das wichtigste
Prinzip einer richtige«« Wundbehandlung!
Von diesen« Prinzip darf auch bei der kleinsten
Wunde nicht abgegangen werde««! Allerdings ist ja,
je größer die Verletzung, desto größer die Eingangs-
pforte für die Bakterien, desto näher die Gefahr, aber
«na«« bedenke, daß eine solche Pforte, die genügend ist,
un« de«« ganze«« Körper zu verseuchen, schon der kleinste
Nadelstich, der feinste Ritz, jedes aufgesprungene Müt-
terchen, jede noch so unscheinbare verbrannte oder an-
geätzte Stelle der Haut ist. Sie alle bedürfe«« unserer
M 16.
sorgfältigsten Beobachtung und Pflege, wen«« sie nns
nicht verderblich werden solle««.
Daß diese Pflege znnächst dahin gerichtet sei«« muß,
die Wunde von bereits etwa eingedrungenen Bakterien
zu säubern, ist schon oben« hervorgehoben worden. Diese
Säuberung mnß nun aber auch ans die Umgebung der
Wunde ausgedehnt werden, «veil ja von da leicht Krank-
heitskeime ihren Weg nach der verletzten Stelle nehme««
könnten.
Zur Reinigung sind vor Alle««« Seife und Wasser
erforderlich; ei«« gründliches Abseifen der die Wunde
umgebenden Hautparthiei« versäume man nie. Gebt
nicht aller Schmutz weg, so versuche man diese«« Rest
mit etwas Aether, den man ii« die Haut einreibt, zu
entfernen, und, will man noch peinlicher verfahren, so
schneide inan bei behaarte«« Körperstellen vorsichtig ringsum
die Haare möglichst kurz ab, da in ihre«» Bereiche Bak-
terien und ihre Keime sich leicht sestznsetzen pflegen.
Und nun muß mau daran gehen, die Wunde selbst
zu reinigen. Mai« kam« dies mit Wasser thun, doch
muß dasselbe vorher abgekocht und dann rasch abgckühlt
sein, damit durch die Hitze etwa in« Wasser selbst vor-
handene Keime abgetödtet werde««. Die Hitze ist das
beste Desinfektionsmittel, sie vernichtet alle
Bakterie«« nnd ihre Keime. Da wir aber die
Wunde und ihre Umgebung nicht kochen, auch nicht
durch heißes Wasser völlig desinfiziren können, so müsse««
«vir u«is eben damit begnügen, die Krankheitskeime
durch reines, bakterienfreies, also abgekochtes Wasser
mechanisch aus der Wunde herauszuspülen. Sicherer
freilich ist es, dazu eiue Flüsigkeit zu verwenden, ii«
der ein Stoss enthalte«« ist, der eine bakterienvcrnich
tende Wirkung ausübt. Eine solche ist das in jeder
Apotheke erhältliche Karbolwasser. Mit demselben spüle
man die vorher ordentlich abgeseifte Umgebung der
Wunde ab, einige Eßlöffel träufle mau auch auf die
Wunde selbst langsam und vorsichtig ans.
Eine Flasche mit Karbolwasser sollte ii« jedem Haus-
halt, besonders aber ii« jeder Wcrkstütte und Fabrik,
wo ja die Verletzungen an der Tagesordnung sind,
vorräthig gehalte«« werden, ebenso auch ein Packet Wund-
watte, die zum Bedecke«« der verletzten Parthie erforder-
lich ist.
Wir wissen schon, daß es nach Säuberung des be-
treffende«« Gebietes gilt, weiterhin von demselben Krank
heitskeime fern zu halten. Diesen Schutz der Wunde
erreicht man am beste«« durch einen Verband, der die
Wunde sicher von der Luft abschließt, die ja mit aller-
lei Bakterie«« erfüllt ist. Man nehme also eii« Stück
Watte, das nicht nur die Wunde selbst, sondern auch
die benachbarte«« Parthie» in müßigem Umkreise bedeckt,
feuchte es «nit Karbolwasser an, drücke es fest auf die
Wunde und befestige es daselbst durch eine durchaus
saubere Leinwand- oder Gazebinde oder ein reines,
weißes Tuch, das man fest um das betreffende Glied
schnürt. Auch eine passende Binde müßte vorräthig
gehalten werden, zumal dieselbe, wie «vir bald sehen
werden, auch einem andere«« Zwecke noch dienen kam«.
Es versteht sich wohl von selbst, daß die Karbol-
lösung gehörig verkorkt, Watte und Binde sorgfältig
verhüllt werden «Nüssen, damit nicht Bakterien aus diese
Gegenstände selbst gerathen. Ebenso begreiflich ist es,
daß auch alles Andere, was «nit der Wunde ii« Be-
rührung komme«« soll, absolut rein sein muß, wie z. B.
alle Gefäße, die etwas aufnehmen, was für die Pflege
der Wunde bestimmt ist. Am zweckmäßigsten ist es, solche
Dinge unmittelbar vor den« Gebrauche noch einmal gründ-
lich zu desinsizireu, also zu koche«« oder wenigstens in
heißes Wasser zu lege«« und «nit Karbollösung abzuspülen.
Auch die Hände Derjenigen, die etwas mit der Wunde
zu thun haben, müssen, ehe sie die Wunde oder etwas,
was darauf kommt, anfassen, mit Seife und warmem
Wasser gereinigt und in Karbollösung getaucht werden.
Bei ganz kleine«« Verletzungen, z. B. einem Nadel-
stiche, wird man nicht gleich einen Verband anlegen
wollen, wenngleich ja mich da eine solche Vorsichts
maßregel durchaus an« Platze wäre. Hat man eine
gehörige Reinigung vorausgehe«« lassen, so genügt es
schließlich, eii« Stückchen Heftpflaster auf die Wunde
zu klebeu. Nie aber lasse man eine Wunde, und
sei sie noch so klein, noch so oberflächlich, un-
gesäubert, uic völlig unbedeckt! —
Es wurde obei« als erstes Erforderniß für die
Wundbehandlung die Säuberung der Wunde hingestellt.
Nun tritt aber meist ein Ereignis) hinzu, das vor alle«««
Anderen unsere Aufmerksamkeit beansprucht und die
rascheste Hilfe nöthig «nacht, noch ehe man an Säube-
rung und Wundverschluß denken darf — die Blutung!
Sobald eine Hautstelle verletzt wird, so werden auch
Blutgefäße mit verletzt, aus denen dann Blut heraus-
strömt. Grundsatz aber soll es sein, eine Wunde nicht
eher zu verbinden, bis die Blutung ganz und gar ge-
stillt ist.
Die oberflächliche«« Adern sind ja meist so unbedeu-
tend, daß die Blutung bald nachläßt, entweder voi«
selbst oder nach Anlegung eines Verbandes, wie er
oben beschrieben wurde. Durch den Verband wird die
Wunde zusammcngepreßt, daS spärlich heraussickerndc