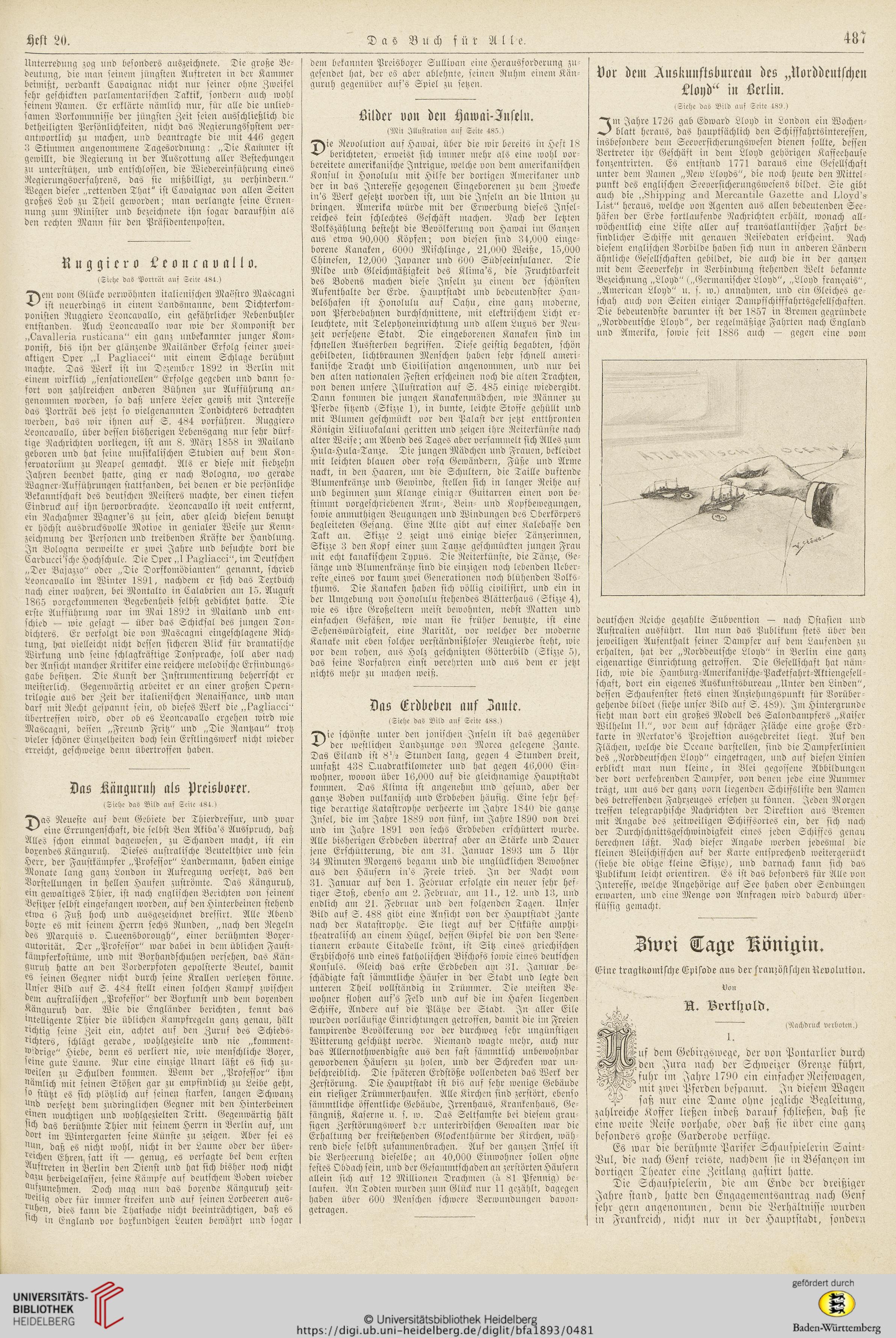Hrst üsi.
487
Das Büch f ü r All e.
Unterredung zog und besonders auszeichnete. Die große Be-
deutung, die inan seinem jüngsten Auftreten in der Kammer
bewußt, verdankt Cavaignac nicht nur seiner ohne Zweifel
sehr geschickten parlamentarischen Taktik, sondern auch wohl
seinem Namen. Er erklärte nämlich nur, für alle die unlieb-
samen Vorkommnisse der jüngsten Zeit seien ausschließlich die
betheiligteu Persönlichkeiten, nicht das Regierungssystem ver-
antwortlich zu machen, und beantragte die mit 44t! gegen
3 Stimmen angenommene Tagesordnung: „Die Kammer ist
gewillt, die Regierung in der Ausrottung aller Bestechungen
zu unterstützen, und entschlossen, die Wiedereinführung eines
Regierungsverfahrens, das sie mißbilligt, zu verhindern."
Wegen dieser „rettenden That" ist Cavaignac von allen Seiten
großes Lob zu Theil geworden; man verlangte seine Erneu
uung zum Minister und bezeichnete ihn sogar daraufhin als
den rechten Mann für den Präsidentenposten.
nllggirro V e o ll r li v nl l o.
?>enl vom Glücke verwöhnten italienischen Maestro Mascagni
ist neuerdings in einen, Landsmanne, dem Dichterkoni
ponisten Ruggiero Leoncavallo, ein gefährlicher Nebenbuhler
entstanden. Auch Leoncavallo war wie der Komponist der
„Ouvallsriu rusticmna," ein ganz unbekannter junger Kom-
ponist, bis ihn der glänzende Mailänder Erfolg seiner zwei-
aktigen Oper ,,I kuZiiaeoi" mit einem Schlage berühmt
machte. Das Werk ist im Dezember 1892 in Berlin mit
einem wirklich „sensationellen" Erfolge gegeben und dann so-
fort von zahlreichen anderen Bühnen zur Aufführung an-
genommen worden, so daß unsere Leser gewiß mit Interesse
das Porträt des jetzt so vielgenannten Tondichters betrachten
werden, das wir ihnen auf S. 484 vorführen. Ruggiero
Leoncavallo, über dessen bisherigen Lebensgang nur sehr dürf-
tige Nachrichten vorliegen, ist am 8. März 1858 in Mailand
geboren und hat seine musikalischen Studien auf den, Kou-
servatorium zu Neapel gemacht. Als er diese mit siebzehn
Jahren beendet hatte, ging er nach Bologna, wo gerade
Wagner-Aufführungen stattfanden, bei denen er die persönliche
Bekanntschaft des deutschen Meisters machte, der einen tiefen
Eindruck auf ihn hervorbrachte. Leoncavallo ist weit entfernt,
ein Nachahmer Wagner's zu sein, aber gleich diesem benutzt
er höchst ausdrucksvolle Motive in genialer Weise zur Kenn-
zeichnung der Personen und treibenden Kräfte der Handlung.
In Bologna verweilte er zwei Jahre und besuchte dort die
Carducci'sche Hochschule. Die Oper „I?a.8iiueoi", im Deutschen
„Der Bajazzo" oder „Die Dorfkomödianten" genannt, schrieb
Leoncavallo im Winter 1891, nachdem er sich das Textbuch
nach einer wahren, bei Montalto in Calabrien am 15. August
1865 vorgekommenen Begebenheit selbst gedichtet hatte. Die
erste Aufführung war im Mai 1892 in Mailand und ent
schied — wie gesagt — über das Schicksal des jungen Ton-
dichters. Er verfolgt die von Mascagni eingeschlagene Rich-
tung, hat vielleicht nicht dessen sicheren Blick für dramatische
Wirkung und seine schlagkräftige Tonsprache, soll aber nach
der Ansicht mancher Kritiker eine reichere melodische Erfindungs-
gabe besitzen. Die Kunst der Jnstrumentirung beherrscht er
meisterlich. Gegenwärtig arbeitet er an einer großen Opern-
trilogie aus der Zeit der italienischen Renaissance, und inan
darf mit Recht gespannt sein, ob dieses Werk die „?uZIiuLoi"
übertreffen wird, oder ob es Leoncavallo ergehen wird wie
Mascagni, dessen „Freund Fritz" und „Die Rantzau" trotz
vieler schöner Einzelheiten doch sein Erstlingswerk nicht wieder
erreicht, geschweige denn übertroffen haben.
Das Känguruh als preistwrer.
(Siehe das Bild auf Seile 484.)
?>as Neueste auf dem Gebiete der Thierdressur, uud zwar
eine Errungenschaft, dis selbst Ben Akiba's Ausspruch, daß
Alles schon einmal dagewesen, zu Schanden macht, ist ein
boxendes Känguruh. Dieses australische Beutelthier und sein
Herr, der Fanstkämpfer „Professor" Landermann, haben einige
Monate lang ganz London in Aufregung versetzt, das den
Vorstellungen in Hellen Haufen zuströmte. Das Känguruh,
ein gewaltiges Thier, ist nach englischen Berichten von seinem
Besitzer selbst eingefangen worden, auf den Hinterbeinen stehend
etwa 6 Fuß hoch und ausgezeichnet dressirt. Alle Abend
boxte es mit seinem Herrn sechs Runden, „nach den Regeln
des Marquis v. Queensborough", einer berühmten Boxer-
autorität. Der „Professor" war dabei in dem üblichen Faust-
kampferkostüme, uud mit Boxhandschuhen versehen, das Kän-
guruh hatte an den Vorderpfoten gepolsterte Beutel, damit
es seinen Gegner nicht durch seine Krallen verletzen könne.
Unser Bild auf S. 484 stellt einen solchen Kampf zwischen
dem australischen „Professor" der Boxkunst und dein boxenden
Känguruh dar. Wie die Engländer berichten, kennt das
intelligente Thier die üblichen Kampfregeln ganz genau, hält
richtig seine Zeit ein, achtet auf den Zuruf des Schieds-
richters, schlügt gerade, wohlgeziette uud uie „kommeut-
nndrige" Hiebe, denn es verliert nie, wie menschliche Boxer,
seine gute Laune. Nur eine einzige Unart läßt es sich zu-
weilen zu Schulden kommen. Wenn der „Professor" ihm
nämlich mit seinen Stößen gar zu empfindlich zu Leibe geht,
io stützt es sich plötzlich auf seinen starken, langen Schwanz
Und versetzt dem zudringlichen Gegner mit den Hinterbeinen
einen wuchtigen und wohlgezieltcn Tritt. Gegenwärtig hält
üch das berühmte Thier mit seinem Herrn in Berlin auf, uni
dort im Wintergarten seine Künste zu zeigen. Aber sei es
Uhu, daß es nicht wohl, nicht in der Laune oder der über-
reichen Ehren, satt ist — genug, es versagte bei dein ersten
Auftreten in Berlin den Dienst und hat sich bisher noch nicht
dazu herbeigelasseu, seine Kämpfe auf deutschem Boden wieder
oufzunehmen. Doch mag nun das boxende Känguruh zeit-
weilig oder für immer streiken und auf seinen Lorbeeren ans-
r.uhen, dies kann die Thatsache nicht beeinträchtigen, daß es
Bch in England vor boxkundigen Leuten bewährt und sogar
dem bekannten Preisboxer Sullivan eine Herausforderung zu
gesendet hat, der es aber ablehnts, seinen Ruhm einem Kän-
guruh gegenüber auf's Spiel zu setzen.
Dildei' von den Hnivni-Inselu.
(Mil Illustration auf Seite 489.)
?>ie Revolution auf Hawai, über dis wir bereits in Heft 18
berichteten, erweist sich immer mehr als eine wohl vor
bereitete amerikanische Jntrigue, welche von dem amerikanischen
Konsul in Honolulu mit Hilfe der dortigen Amerikaner und
der in das Interesse gezogenen Eingeborenen zu dem Zwecke
in's Werk gesetzt worden ist, um die Juseln an die Union zu
bringen. Amerika würde mit der Erwerbung dieses Insel-
reiches kein schlechtes Geschäft machen. Nach der letzten
Volkszählung besteht die Bevölkerung von Hawai im Ganzen
ans etwa 90,000 Köpfen; von diesen sind 34,000 einge-
borene Kanaken, 6000 Mischlinge, 21,000 Weiße, 15,000
Chinesen, 12,000 Japaner und 600 Südseeinsulaner. Die
Milde und Gleichmäßigkeit des Klima's, die Fruchtbarkeit
des Bodens machen diese Inseln zu einem der schönsten
Aufenthalte der Erde. Hauptstadt uud bedeutendster Han-
delshafen ist Honolulu auf Oahu, eine ganz moderne,
von Pferdebahnen durchschnittene, mit elektrischem Licht er-
leuchtete, mit Telephoneinrichtung und allem Luxus der Neu-
zeit versehene Stadt. Die eingeborenen Kanaken sind im
schnellen Aussterbefl begriffen. Diese geistig begabten, schön
gebildeten, lichtbrnunen Menschen haben sehr schnell ameri-
kanische Tracht und Civilisation angenommen, und nur bei
den alten nationalen Festen erscheinen noch die alten Trachten,
von denen unsere Illustration auf S. 485 einige wiedergibt.
Dann kommen die jungen Kanakenmädchen, wie Männer zu
Pferde sitzend (Skizze 1), in bunte, leichte Stoffe gehüllt und
mit Blumell geschmückt vor deu Palast der jetzt entthronten
Königin Liliuokalani geritten und zeigen ihre Reiterkünste nach
alter Weise; am Abend des Tages aber versammelt sich Alles zum
Hula-Hula-Tanze. Die jungen Mädchen und Frauen, bekleidet
mit leichten blauen oder rosa Gewändern, Füße und Arme
nackt, in den Haaren, um die Schultern, die Taille duftende
Blumenkränze und Gewinde, stellen sich in langer Reihe auf
und beginnen zum Klauge einigcr Guitarren einen von be
stimmt vorgeschriebenen Arm-, Bein und Kopfbewegungen,
sowie anmuthigen Beugungen und Windungen des Oberkörpers
begleiteten Gesang. Eine Alte gibt auf einer Kalebasse den
Takt all. Skizze 2 zeigt uns einige dieser Tänzerinnen,
Skizze 3 den Kopf einer zum Tanze geschmückten jungen Frau
mit echt kanakischem Typns. Die Reiterkünste, die Tänze, Ge-
sänge lind Blumenkränze sind die einzigen »och lebenden lieber
reste eines vor kaum zwei Generationen noch blühenden Volks
thums. Die Kanaken haben sich völlig eivilisirt, und ein in
der Umgebung von Honolulu stehendes Blätterhaus (Skizze 4),
wie es ihre Großeltern meist bewohnten, nebst Matten und
einfachen Gefäßen, wie man sie früher benutzte, ist eine
Sehenswürdigkeit, eine Naritüt, vor welcher der moderne
Kannte mit eben solcher verständnißloser Neugierde steht, wie
vor dem rohen, aus Holz geschuitzten Götterbild (Skizze 5j,
das seine Vorfahren einst verehrten und aus dem er jetzt
nichts mehr zu machen weiß.
Das Eldbkbrn v»f Zante.
(Siehe daS Bild auf Seite 488.)
?>ic schönste unter den jonischen Inseln ist das gegenüber
der westlichen Landzunge von Morca gelegene Zante.
Das Eiland ist 8V- Srunden lang, gegen 4 Stunden breit,
umfaßt 438 Quadratkilometer und hat gegen 46,000 Ein
wohner, wovon über 16,000 auf die gleichnamige Hauptstadt
kommeu. Das Klima ist angenehm und gesund, aber der
ganze Boden vulkanisch und Erdbeben häufig. Eine sehr hef
tige derartige Katastrophe verheerte im Jahre 1840 die ganze
Insel, die im Jahre 1889 von fünf, im Jahre 1890 von drei
und im Jahre 1891 von sechs Erdbeben erschüttert wurde.
Alle bisherigen Erdbeben übertraf aber an Starke und Dauer
jene Erschütterung, die am 31. Januar 1893 um 5 Uhr
34 Minuten Morgens begann und die unglücklichen Bewohner
aus den Häusern in's Freie trieb. In der Nacht vom
31. Januar auf den 1. Februar erfolgte ein neuer sehr hef
tiger Stoß, ebenso am 2. Februar, am 11., 12. und 13, und
endlich am 21. Februar und den folgenden Tagen. Unser
Bild auf S. 488 gibt eine Ansicht von der Hauptstadt Zante
nach der Katastrophe. Sie liegt auf der Ostküste amphi-
theatralisch an einem Hügel, dessen Gipfel die von den Veue-
tianern erbaute Citadelle krönt, ist Sitz eines griechischen
Erzbischofs und eines katholischen Bischofs sowie eines deutschen
Konsuls. Gleich das erste Erdbeben am 31. Januar be-
schädigte fast jämmtliche Häuser in der Stadt und legte den
unteren Theil vollständig in Trümmer. Die »leisten Be
wohner flohen auf's Feld und auf die im Hafen liegenden
Schiffe, Anders auf die Plätze der Stadt. In aller Eile
wurden vorläufige Einrichtungeu getroffen, damit die im Freien
kampirende Bevölkerung vor der durchweg sehr ungünstigen
Witterung geschützt werde. Niemand wagte mehr, auch nur
das Allernothwendigste aus den fast sämmtlich unbewohnbar
gewordenen Häusern zu holen, und der Schrecken war un
beschreiblich. Die späteren Erdstöße vollendeten daS Werk der
Zerstörung. Die Hauptstadt ist bis auf sehr wenige Gebäude
ein riesiger Trümmerhaufen. Alle Kirchen sind zerstört, ebenso
sämmtlichs öffentliche Gebäude, Irrenhaus, Krankenhaus, Ge-
fängniß, Kaserne u. s. w. Das Seltsamste bei diesem grau-
sigen Zerstörungswerk der unterirdischen Gewalten war die
Erhaltung der freistehenden Glockcnthürme der Kirchen, wäh
rend diese selbst zusammenbrachen. Auf der ganzen Insel ist
die Verheerung dieselbe; an 40,000 Einwohner sollen ohne
festes Obdach sein, und der Gesammtschaden an zerstörten Häusern
allein sich auf 12 Millionen Drachmen (ü 81 Pfennig) be
laufen. An Todten wurden zum Glück nur 11 gezählt, dagegen
haben über 600 Menschen schwere Verwundungen davon-
getragen.
Vor dem Äuslrunftsbureou des „Norddeutschen
Lloyd^ in Vertin.
(Siehe das Bild aas Seite 489.)
Dkm Jahre 1726 gab Edward Lloyd in London ein Wochen-
blatt heraus, das hauptsächlich den Schifffahrtsinteressen,
insbesondere dem Seeversicherungswesen dienen sollte, dessen
Vertreter ihr Geschäft in dem Lloyd gehörigen Kaffeehause
konzentrirten. Es entstaud 1771 daraus eine Gesellschaft
unter dem Namen „New Lloyds", die noch heute den Mittel
punkt des englischen Seeoersicherungswesens bildet. Sie gibt
auch die ,,8lnp>piu^ unci Moroaittils 6a?.stts uuck lüoz-cl's
1u8t" heraus, welche von Agenten aus allen bedeutenden See-
häfen der Erde fortlaufende Nachrichten erhält, wonach all-
wöchentlich eine Liste aller auf transatlantischer Fahrt be-
findlicher Schiffe mit genauen Reisedaten erscheint. Nach
diesen, englischen Vorbilde haben sich nun in anderen Landern
ähnliche Gesellschaften gebildet, die auch die in der ganzen
mit dem Seeverkehr in Verbindung stehenden Welt bekannte
Bezeichnung „Lloyd" („Germanischer Lloyd", „Lloyd fran^ais",
„American Lloyd" u. s. w.) annahmen, und ein Gleiches ge
schal) auch von Seiten einiger Danipfschifffahrtsgesellschaften.
Die bedeutendste darunter ist der 1857 in Bremen gegründete
„Norddeutsche Lloyd", der regelmäßige Fahrten nach England
und Amerika, sowie seit 1886 auch — gegen eine vom
deutschen Reiche gezahlte Subvention — nach Ostasien und
Australien ausführt. Um nun das Publikum stets über den
jeweiligen Aufenthalt seiner Dampfer auf den. Laufenden zu
erhalten, hat der „Norddeutsche Lloyd" in Berlin eine ganz
eigenartige Einrichtung getroffen. Die Gesellschaft hat näm
lieh, wie die Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Aktiengesell-
schaft, dort ein eigenes Auskunftsbureau „Unter den Linden",
dessen Schaufenster stets einen Anziehungspunkt für Vorüber-
gehende bildet (siehe unser Bild auf S. 489). Im Hintergrunds
sieht man dort ein großes Modell des Salondampfers „Kaiser
Wilhelm li.", vor den, auf schräger Fläche eine große Erd
karte in Merkator's Projektion ausgebreitet liegt. Auf den
Flächen, welche die Oceane barstellen, sind die Dampferlinien
des „Norddeutschen Lloyd" eingetragen, und auf diesen Linien
erblickt man nun kleine, in Blei gegossene Abbildungen
der dort verkehrenden Dampfer, von denen jede eine Nummer
trägt, uni aus der ganz vorn liegenden Schisfsliste den Namen
des betreffenden Fahrzeuges ersehen zu können. Jeden Morgen
treffen telegraphische Nachrichten der Direktion aus Bremen
mit Angabe des zeitweiligen Schiffsortes ein, der sich nach
der Durchschnittsgeschwindigkeit eines jeden Schiffes genau
berechnen läßt. Nach dieser Angabe werden jedesmal die
kleinen Bleischiffchcn au' der Karte entsprechend weitergerückt
(siehe die obige kleine Skizze), und darnach kann sich das
Publikum leicht orientiren. CS ist das besonders für Alle von
Interesse, welche Angehörige auf See haben oder Sendungen
erwarten, und eine Menge von Anfragen wird dadurch über
flüssig gemacht.
Zwei Tage Königin.
Wine tragikomische Episode aus der französischen Revolution.
A. Vrrtlzvld.
i.
uf dem Gebirgswege, der von Pontarlier durch
Jura nach der Schweizer Grenze führt,
im Fahre 1790 ein einfacher Reisewagen,
mit zwei Pferden bespannt. In diesem Wagen
saß nur eine Dame ohne jegliche Begleitung,
zahlreiche Koffer ließen indes; darauf schließen, daß sie
eine weite Reise vorhabe, oder daß sie über eine ganz
besonders große Garderobe verfüge.
Es war die berühmte Pariser Schauspielerin Saint-
Vul, die nach Genf reiste, nachdem sie in Bosangon im
dortigen Theater eine Zeitlang gastirt hatte.
Die Schauspielerin, die an, Ende der dreißiger
Fahre stand, hatte den Engagcmentsantrag nach Genf
sehr gern angenommen, denn die Verhältnisse wurden
in Frankreich, nicht nur in der Hauptstadt, sondern
487
Das Büch f ü r All e.
Unterredung zog und besonders auszeichnete. Die große Be-
deutung, die inan seinem jüngsten Auftreten in der Kammer
bewußt, verdankt Cavaignac nicht nur seiner ohne Zweifel
sehr geschickten parlamentarischen Taktik, sondern auch wohl
seinem Namen. Er erklärte nämlich nur, für alle die unlieb-
samen Vorkommnisse der jüngsten Zeit seien ausschließlich die
betheiligteu Persönlichkeiten, nicht das Regierungssystem ver-
antwortlich zu machen, und beantragte die mit 44t! gegen
3 Stimmen angenommene Tagesordnung: „Die Kammer ist
gewillt, die Regierung in der Ausrottung aller Bestechungen
zu unterstützen, und entschlossen, die Wiedereinführung eines
Regierungsverfahrens, das sie mißbilligt, zu verhindern."
Wegen dieser „rettenden That" ist Cavaignac von allen Seiten
großes Lob zu Theil geworden; man verlangte seine Erneu
uung zum Minister und bezeichnete ihn sogar daraufhin als
den rechten Mann für den Präsidentenposten.
nllggirro V e o ll r li v nl l o.
?>enl vom Glücke verwöhnten italienischen Maestro Mascagni
ist neuerdings in einen, Landsmanne, dem Dichterkoni
ponisten Ruggiero Leoncavallo, ein gefährlicher Nebenbuhler
entstanden. Auch Leoncavallo war wie der Komponist der
„Ouvallsriu rusticmna," ein ganz unbekannter junger Kom-
ponist, bis ihn der glänzende Mailänder Erfolg seiner zwei-
aktigen Oper ,,I kuZiiaeoi" mit einem Schlage berühmt
machte. Das Werk ist im Dezember 1892 in Berlin mit
einem wirklich „sensationellen" Erfolge gegeben und dann so-
fort von zahlreichen anderen Bühnen zur Aufführung an-
genommen worden, so daß unsere Leser gewiß mit Interesse
das Porträt des jetzt so vielgenannten Tondichters betrachten
werden, das wir ihnen auf S. 484 vorführen. Ruggiero
Leoncavallo, über dessen bisherigen Lebensgang nur sehr dürf-
tige Nachrichten vorliegen, ist am 8. März 1858 in Mailand
geboren und hat seine musikalischen Studien auf den, Kou-
servatorium zu Neapel gemacht. Als er diese mit siebzehn
Jahren beendet hatte, ging er nach Bologna, wo gerade
Wagner-Aufführungen stattfanden, bei denen er die persönliche
Bekanntschaft des deutschen Meisters machte, der einen tiefen
Eindruck auf ihn hervorbrachte. Leoncavallo ist weit entfernt,
ein Nachahmer Wagner's zu sein, aber gleich diesem benutzt
er höchst ausdrucksvolle Motive in genialer Weise zur Kenn-
zeichnung der Personen und treibenden Kräfte der Handlung.
In Bologna verweilte er zwei Jahre und besuchte dort die
Carducci'sche Hochschule. Die Oper „I?a.8iiueoi", im Deutschen
„Der Bajazzo" oder „Die Dorfkomödianten" genannt, schrieb
Leoncavallo im Winter 1891, nachdem er sich das Textbuch
nach einer wahren, bei Montalto in Calabrien am 15. August
1865 vorgekommenen Begebenheit selbst gedichtet hatte. Die
erste Aufführung war im Mai 1892 in Mailand und ent
schied — wie gesagt — über das Schicksal des jungen Ton-
dichters. Er verfolgt die von Mascagni eingeschlagene Rich-
tung, hat vielleicht nicht dessen sicheren Blick für dramatische
Wirkung und seine schlagkräftige Tonsprache, soll aber nach
der Ansicht mancher Kritiker eine reichere melodische Erfindungs-
gabe besitzen. Die Kunst der Jnstrumentirung beherrscht er
meisterlich. Gegenwärtig arbeitet er an einer großen Opern-
trilogie aus der Zeit der italienischen Renaissance, und inan
darf mit Recht gespannt sein, ob dieses Werk die „?uZIiuLoi"
übertreffen wird, oder ob es Leoncavallo ergehen wird wie
Mascagni, dessen „Freund Fritz" und „Die Rantzau" trotz
vieler schöner Einzelheiten doch sein Erstlingswerk nicht wieder
erreicht, geschweige denn übertroffen haben.
Das Känguruh als preistwrer.
(Siehe das Bild auf Seile 484.)
?>as Neueste auf dem Gebiete der Thierdressur, uud zwar
eine Errungenschaft, dis selbst Ben Akiba's Ausspruch, daß
Alles schon einmal dagewesen, zu Schanden macht, ist ein
boxendes Känguruh. Dieses australische Beutelthier und sein
Herr, der Fanstkämpfer „Professor" Landermann, haben einige
Monate lang ganz London in Aufregung versetzt, das den
Vorstellungen in Hellen Haufen zuströmte. Das Känguruh,
ein gewaltiges Thier, ist nach englischen Berichten von seinem
Besitzer selbst eingefangen worden, auf den Hinterbeinen stehend
etwa 6 Fuß hoch und ausgezeichnet dressirt. Alle Abend
boxte es mit seinem Herrn sechs Runden, „nach den Regeln
des Marquis v. Queensborough", einer berühmten Boxer-
autorität. Der „Professor" war dabei in dem üblichen Faust-
kampferkostüme, uud mit Boxhandschuhen versehen, das Kän-
guruh hatte an den Vorderpfoten gepolsterte Beutel, damit
es seinen Gegner nicht durch seine Krallen verletzen könne.
Unser Bild auf S. 484 stellt einen solchen Kampf zwischen
dem australischen „Professor" der Boxkunst und dein boxenden
Känguruh dar. Wie die Engländer berichten, kennt das
intelligente Thier die üblichen Kampfregeln ganz genau, hält
richtig seine Zeit ein, achtet auf den Zuruf des Schieds-
richters, schlügt gerade, wohlgeziette uud uie „kommeut-
nndrige" Hiebe, denn es verliert nie, wie menschliche Boxer,
seine gute Laune. Nur eine einzige Unart läßt es sich zu-
weilen zu Schulden kommen. Wenn der „Professor" ihm
nämlich mit seinen Stößen gar zu empfindlich zu Leibe geht,
io stützt es sich plötzlich auf seinen starken, langen Schwanz
Und versetzt dem zudringlichen Gegner mit den Hinterbeinen
einen wuchtigen und wohlgezieltcn Tritt. Gegenwärtig hält
üch das berühmte Thier mit seinem Herrn in Berlin auf, uni
dort im Wintergarten seine Künste zu zeigen. Aber sei es
Uhu, daß es nicht wohl, nicht in der Laune oder der über-
reichen Ehren, satt ist — genug, es versagte bei dein ersten
Auftreten in Berlin den Dienst und hat sich bisher noch nicht
dazu herbeigelasseu, seine Kämpfe auf deutschem Boden wieder
oufzunehmen. Doch mag nun das boxende Känguruh zeit-
weilig oder für immer streiken und auf seinen Lorbeeren ans-
r.uhen, dies kann die Thatsache nicht beeinträchtigen, daß es
Bch in England vor boxkundigen Leuten bewährt und sogar
dem bekannten Preisboxer Sullivan eine Herausforderung zu
gesendet hat, der es aber ablehnts, seinen Ruhm einem Kän-
guruh gegenüber auf's Spiel zu setzen.
Dildei' von den Hnivni-Inselu.
(Mil Illustration auf Seite 489.)
?>ie Revolution auf Hawai, über dis wir bereits in Heft 18
berichteten, erweist sich immer mehr als eine wohl vor
bereitete amerikanische Jntrigue, welche von dem amerikanischen
Konsul in Honolulu mit Hilfe der dortigen Amerikaner und
der in das Interesse gezogenen Eingeborenen zu dem Zwecke
in's Werk gesetzt worden ist, um die Juseln an die Union zu
bringen. Amerika würde mit der Erwerbung dieses Insel-
reiches kein schlechtes Geschäft machen. Nach der letzten
Volkszählung besteht die Bevölkerung von Hawai im Ganzen
ans etwa 90,000 Köpfen; von diesen sind 34,000 einge-
borene Kanaken, 6000 Mischlinge, 21,000 Weiße, 15,000
Chinesen, 12,000 Japaner und 600 Südseeinsulaner. Die
Milde und Gleichmäßigkeit des Klima's, die Fruchtbarkeit
des Bodens machen diese Inseln zu einem der schönsten
Aufenthalte der Erde. Hauptstadt uud bedeutendster Han-
delshafen ist Honolulu auf Oahu, eine ganz moderne,
von Pferdebahnen durchschnittene, mit elektrischem Licht er-
leuchtete, mit Telephoneinrichtung und allem Luxus der Neu-
zeit versehene Stadt. Die eingeborenen Kanaken sind im
schnellen Aussterbefl begriffen. Diese geistig begabten, schön
gebildeten, lichtbrnunen Menschen haben sehr schnell ameri-
kanische Tracht und Civilisation angenommen, und nur bei
den alten nationalen Festen erscheinen noch die alten Trachten,
von denen unsere Illustration auf S. 485 einige wiedergibt.
Dann kommen die jungen Kanakenmädchen, wie Männer zu
Pferde sitzend (Skizze 1), in bunte, leichte Stoffe gehüllt und
mit Blumell geschmückt vor deu Palast der jetzt entthronten
Königin Liliuokalani geritten und zeigen ihre Reiterkünste nach
alter Weise; am Abend des Tages aber versammelt sich Alles zum
Hula-Hula-Tanze. Die jungen Mädchen und Frauen, bekleidet
mit leichten blauen oder rosa Gewändern, Füße und Arme
nackt, in den Haaren, um die Schultern, die Taille duftende
Blumenkränze und Gewinde, stellen sich in langer Reihe auf
und beginnen zum Klauge einigcr Guitarren einen von be
stimmt vorgeschriebenen Arm-, Bein und Kopfbewegungen,
sowie anmuthigen Beugungen und Windungen des Oberkörpers
begleiteten Gesang. Eine Alte gibt auf einer Kalebasse den
Takt all. Skizze 2 zeigt uns einige dieser Tänzerinnen,
Skizze 3 den Kopf einer zum Tanze geschmückten jungen Frau
mit echt kanakischem Typns. Die Reiterkünste, die Tänze, Ge-
sänge lind Blumenkränze sind die einzigen »och lebenden lieber
reste eines vor kaum zwei Generationen noch blühenden Volks
thums. Die Kanaken haben sich völlig eivilisirt, und ein in
der Umgebung von Honolulu stehendes Blätterhaus (Skizze 4),
wie es ihre Großeltern meist bewohnten, nebst Matten und
einfachen Gefäßen, wie man sie früher benutzte, ist eine
Sehenswürdigkeit, eine Naritüt, vor welcher der moderne
Kannte mit eben solcher verständnißloser Neugierde steht, wie
vor dem rohen, aus Holz geschuitzten Götterbild (Skizze 5j,
das seine Vorfahren einst verehrten und aus dem er jetzt
nichts mehr zu machen weiß.
Das Eldbkbrn v»f Zante.
(Siehe daS Bild auf Seite 488.)
?>ic schönste unter den jonischen Inseln ist das gegenüber
der westlichen Landzunge von Morca gelegene Zante.
Das Eiland ist 8V- Srunden lang, gegen 4 Stunden breit,
umfaßt 438 Quadratkilometer und hat gegen 46,000 Ein
wohner, wovon über 16,000 auf die gleichnamige Hauptstadt
kommeu. Das Klima ist angenehm und gesund, aber der
ganze Boden vulkanisch und Erdbeben häufig. Eine sehr hef
tige derartige Katastrophe verheerte im Jahre 1840 die ganze
Insel, die im Jahre 1889 von fünf, im Jahre 1890 von drei
und im Jahre 1891 von sechs Erdbeben erschüttert wurde.
Alle bisherigen Erdbeben übertraf aber an Starke und Dauer
jene Erschütterung, die am 31. Januar 1893 um 5 Uhr
34 Minuten Morgens begann und die unglücklichen Bewohner
aus den Häusern in's Freie trieb. In der Nacht vom
31. Januar auf den 1. Februar erfolgte ein neuer sehr hef
tiger Stoß, ebenso am 2. Februar, am 11., 12. und 13, und
endlich am 21. Februar und den folgenden Tagen. Unser
Bild auf S. 488 gibt eine Ansicht von der Hauptstadt Zante
nach der Katastrophe. Sie liegt auf der Ostküste amphi-
theatralisch an einem Hügel, dessen Gipfel die von den Veue-
tianern erbaute Citadelle krönt, ist Sitz eines griechischen
Erzbischofs und eines katholischen Bischofs sowie eines deutschen
Konsuls. Gleich das erste Erdbeben am 31. Januar be-
schädigte fast jämmtliche Häuser in der Stadt und legte den
unteren Theil vollständig in Trümmer. Die »leisten Be
wohner flohen auf's Feld und auf die im Hafen liegenden
Schiffe, Anders auf die Plätze der Stadt. In aller Eile
wurden vorläufige Einrichtungeu getroffen, damit die im Freien
kampirende Bevölkerung vor der durchweg sehr ungünstigen
Witterung geschützt werde. Niemand wagte mehr, auch nur
das Allernothwendigste aus den fast sämmtlich unbewohnbar
gewordenen Häusern zu holen, und der Schrecken war un
beschreiblich. Die späteren Erdstöße vollendeten daS Werk der
Zerstörung. Die Hauptstadt ist bis auf sehr wenige Gebäude
ein riesiger Trümmerhaufen. Alle Kirchen sind zerstört, ebenso
sämmtlichs öffentliche Gebäude, Irrenhaus, Krankenhaus, Ge-
fängniß, Kaserne u. s. w. Das Seltsamste bei diesem grau-
sigen Zerstörungswerk der unterirdischen Gewalten war die
Erhaltung der freistehenden Glockcnthürme der Kirchen, wäh
rend diese selbst zusammenbrachen. Auf der ganzen Insel ist
die Verheerung dieselbe; an 40,000 Einwohner sollen ohne
festes Obdach sein, und der Gesammtschaden an zerstörten Häusern
allein sich auf 12 Millionen Drachmen (ü 81 Pfennig) be
laufen. An Todten wurden zum Glück nur 11 gezählt, dagegen
haben über 600 Menschen schwere Verwundungen davon-
getragen.
Vor dem Äuslrunftsbureou des „Norddeutschen
Lloyd^ in Vertin.
(Siehe das Bild aas Seite 489.)
Dkm Jahre 1726 gab Edward Lloyd in London ein Wochen-
blatt heraus, das hauptsächlich den Schifffahrtsinteressen,
insbesondere dem Seeversicherungswesen dienen sollte, dessen
Vertreter ihr Geschäft in dem Lloyd gehörigen Kaffeehause
konzentrirten. Es entstaud 1771 daraus eine Gesellschaft
unter dem Namen „New Lloyds", die noch heute den Mittel
punkt des englischen Seeoersicherungswesens bildet. Sie gibt
auch die ,,8lnp>piu^ unci Moroaittils 6a?.stts uuck lüoz-cl's
1u8t" heraus, welche von Agenten aus allen bedeutenden See-
häfen der Erde fortlaufende Nachrichten erhält, wonach all-
wöchentlich eine Liste aller auf transatlantischer Fahrt be-
findlicher Schiffe mit genauen Reisedaten erscheint. Nach
diesen, englischen Vorbilde haben sich nun in anderen Landern
ähnliche Gesellschaften gebildet, die auch die in der ganzen
mit dem Seeverkehr in Verbindung stehenden Welt bekannte
Bezeichnung „Lloyd" („Germanischer Lloyd", „Lloyd fran^ais",
„American Lloyd" u. s. w.) annahmen, und ein Gleiches ge
schal) auch von Seiten einiger Danipfschifffahrtsgesellschaften.
Die bedeutendste darunter ist der 1857 in Bremen gegründete
„Norddeutsche Lloyd", der regelmäßige Fahrten nach England
und Amerika, sowie seit 1886 auch — gegen eine vom
deutschen Reiche gezahlte Subvention — nach Ostasien und
Australien ausführt. Um nun das Publikum stets über den
jeweiligen Aufenthalt seiner Dampfer auf den. Laufenden zu
erhalten, hat der „Norddeutsche Lloyd" in Berlin eine ganz
eigenartige Einrichtung getroffen. Die Gesellschaft hat näm
lieh, wie die Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Aktiengesell-
schaft, dort ein eigenes Auskunftsbureau „Unter den Linden",
dessen Schaufenster stets einen Anziehungspunkt für Vorüber-
gehende bildet (siehe unser Bild auf S. 489). Im Hintergrunds
sieht man dort ein großes Modell des Salondampfers „Kaiser
Wilhelm li.", vor den, auf schräger Fläche eine große Erd
karte in Merkator's Projektion ausgebreitet liegt. Auf den
Flächen, welche die Oceane barstellen, sind die Dampferlinien
des „Norddeutschen Lloyd" eingetragen, und auf diesen Linien
erblickt man nun kleine, in Blei gegossene Abbildungen
der dort verkehrenden Dampfer, von denen jede eine Nummer
trägt, uni aus der ganz vorn liegenden Schisfsliste den Namen
des betreffenden Fahrzeuges ersehen zu können. Jeden Morgen
treffen telegraphische Nachrichten der Direktion aus Bremen
mit Angabe des zeitweiligen Schiffsortes ein, der sich nach
der Durchschnittsgeschwindigkeit eines jeden Schiffes genau
berechnen läßt. Nach dieser Angabe werden jedesmal die
kleinen Bleischiffchcn au' der Karte entsprechend weitergerückt
(siehe die obige kleine Skizze), und darnach kann sich das
Publikum leicht orientiren. CS ist das besonders für Alle von
Interesse, welche Angehörige auf See haben oder Sendungen
erwarten, und eine Menge von Anfragen wird dadurch über
flüssig gemacht.
Zwei Tage Königin.
Wine tragikomische Episode aus der französischen Revolution.
A. Vrrtlzvld.
i.
uf dem Gebirgswege, der von Pontarlier durch
Jura nach der Schweizer Grenze führt,
im Fahre 1790 ein einfacher Reisewagen,
mit zwei Pferden bespannt. In diesem Wagen
saß nur eine Dame ohne jegliche Begleitung,
zahlreiche Koffer ließen indes; darauf schließen, daß sie
eine weite Reise vorhabe, oder daß sie über eine ganz
besonders große Garderobe verfüge.
Es war die berühmte Pariser Schauspielerin Saint-
Vul, die nach Genf reiste, nachdem sie in Bosangon im
dortigen Theater eine Zeitlang gastirt hatte.
Die Schauspielerin, die an, Ende der dreißiger
Fahre stand, hatte den Engagcmentsantrag nach Genf
sehr gern angenommen, denn die Verhältnisse wurden
in Frankreich, nicht nur in der Hauptstadt, sondern