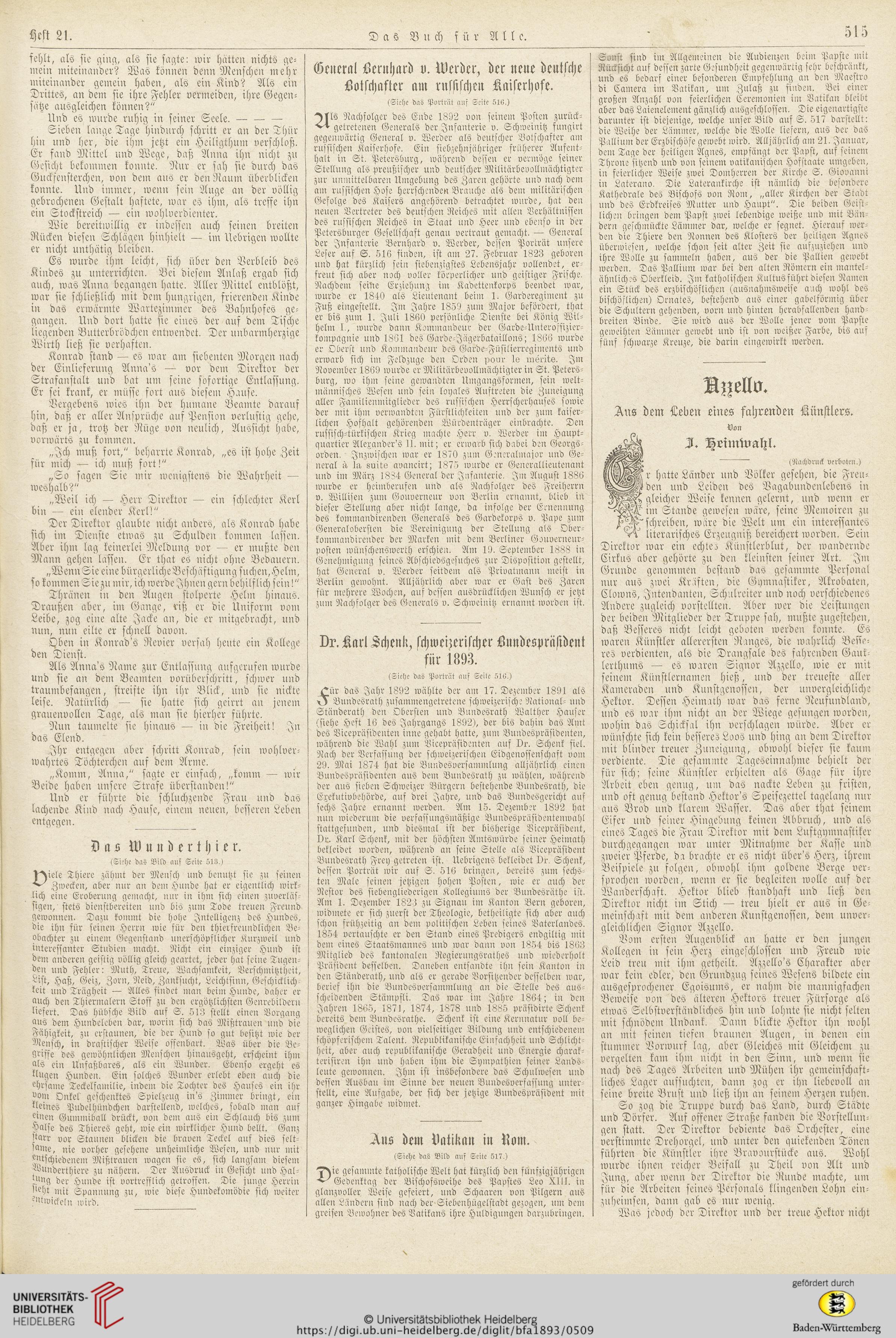Das Buch für Allo.
Holt 21.
fehlt, als sie ging, als sie sagte: wir hatten nichts ge-
mein miteinander? Was können denn Menschen mehr
miteinander gemein haben, als ein Kind? Als ein
Drittes, an dem sie ihre Fehler vermeiden, ihre Gegen-
sätze ausgleichen können?"
Und es wurde ruhig in seiner Seele.-
Sieben lange Tage hindurch schritt er an der Thür
hin und her, die ihm jetzt ein Heiligthum verschloß.
Er fand Mittel und Wege, daß Anna ihn nicht zu
Gesicht bekommen konnte. Nur er sah sie durch das
Guckfensterchen, von dem aus er den Raum überblicken
konnte. Und immer, wenn sein Auge an der völlig
gebrochenen Gestalt haftete, war cs ihm, als treffe ihn
ein Stockstreich — ein wohlverdienter.
Wie bereitwillig er indessen auch seinen breiten
Rücken diesen Schlägen hinhielt — im klebrigen wollte
er nicht unthätig bleiben.
Es wurde ihm leicht, sich über den Verbleib des
Kindes zu unterrichten. Bei diesem Anlaß ergab sich
auch, was Anna begangen hatte. Aller Mittel entblößt,
war sie schließlich mit dem hungrigen, frierenden Kinde
in das erwärmte Wartezimmer des Bahnhofes ge-
gangen. Und dort hatte sie eines der auf dem Tische
liegenden Butterbrödchen entwendet. Der unbarmherzige
Wirth ließ sie verhaften.
Konrad stand — es war am siebenten Morgen nach
der Einlieferung Anna's — vor dem Direktor der
Strafanstalt und bat um seine sofortige Entlassung.
Er sei krank, er müsse fort aus diesem Hause.
Vergebens wies ihn der humane Beamte darauf
hin, daß er aller Ansprüche auf Pension verlustig gehe,
daß er ja, trotz der Rüge von neulich, Aussicht habe,
vorwärts zu kommen.
„Ich muß fort," beharrte Konrad, „es ist hohe Zeit
für mich — ich muß fort!"
„So sagen Sie mir wenigstens die Wahrheit —
weshalb?"
„Weil ich — Herr Direktor — ein schlechter Kerl
bin — ein elender Kerl!"
Der Direktor glaubte nicht anders, als Konrad habe
sich im Dienste etwas zu Schulden kommen lassen.
Aber ihm lag keinerlei Meldung vor — er mußte den
Mann gehen lassen. Er that es nicht ohne Bedauern.
„WennSie eine bürgerlicheBeschäftigung suchen,Helm,
so kommen Sie zu mir, ich werde Ihnen gern behilflich sein!"
Thränen in den Augen stolperte Helm hinaus.
Draußen aber, im Gange, riß er die Uniform vom
Leibe, zog eine alte Jacke an, die er mitgebracht, und
nun, nun eilte er schnell davon.
Oben in Konrad's Revier versah heute ein Kollege
den Dienst.
Als Anna's Raine zur Entlassung aufgcrufen wurde
und sie an dem Beamten vorüberschritt, schwer und
traumbefangen, streifte ihn ihr Blick, und sie nickte
leise. Natürlich — sie hatte sich geirrt an jenem
grauenvollen Tage, als man sie hierher führte.
Nun taumelte sie hinaus — in die Freiheit! In
das Elend.
Ihr entgegen aber schritt Konrad, sein wohlver-
wahrtes Töchterchen auf dem Arme.
„Komm, Anna," sagte er einfach, „komm — wir
Beide haben unsere Strafe überstanden!"
Und er führte die schluchzende Frau und das
lachende Kind nach Hause, einem neuen, besseren Leben
entgegen.
Das W underthie r.
(Siche des Bild auf Seite 51S.)
"kniete Thiere zähmt der Mensch und benutzt sie zu seinen
Zwecken, aber nnr an dem Hunds hat er eigentlich wirk-
lich eine Erobernng gemacht, nur in ihm sich einen zuverläs-
sigen, stets dienstbereiten und bis zuni Tode treuen Freund
gewonnen. Dazu kommt die hohe Intelligenz des Hundes,
die ihn für seinen Herrn wie für den thierfreundlichen Be-
obachter zu einem Gegenstand unerschöpflicher Kurzweil und
interessanter Studien macht. Nicht ein einziger Hund ist
dem anderen geistig völlig gleich geartet, jeder Hai seine Tugen-
den und Fehler: Muth, Treue, Wachsamkeit, Verschmitztheit,
Ast, Haß, Geiz, Zorn, Neid, Zanksucht, Leichtsinn, Geschicklich-
keit und Trägheit — Alles findet man beim Hunde, daher er
auch den Thiermalern Stoff zu den ergötzlichsten Genrebildern
liefert. Das hübsche Bild auf S. 518 stellt einen Vorgang
ans dem Hundeleben dar, worin sich das Mißtrauen und die
Fähigkeit, zu erstaunen, die der Hund so gut besitzt wie der
Mensch, in drastischer Weise offenbart. Was über die Be-
griffe des gewöhnlichen Menschen hinansgeht, erscheint ihm
als ein Unfaßbares, als ein Wunder. Ebenso ergeht es
klugen Hunden. Ein solches Wunder erlebt eben auch die
ehrsame Teckelfamilie, indem die Tochter des Hauses ein ihr
vom Onkel geschenktes Spielzeug in's Zimmer bringt, ein
kleines Pndclhündchen darstellend, welches, sobald man auf
einen Gummiball drückt, von dem aus ein Schlauch bis zum
ftalse des Thierss geht, wie ein wirklicher Hund bellt. Ganz
starr vor Staunen blicken die braven Teckel auf dies selt-
same, nie vorher gesehene unheimliche Wesen, und nur mit
^utschiedenem Mißtrauen wagen sie es, sich langsam diesem
Wunderthiere zu nähern. Der Ausdruck in Gesicht und Hal-
sung der Hunde ist vortrefflich getroffen. Dio junge Herrin
R'ht mit Spannung zu, wie diese Hundekomödie sich weiter
Zwickeln wird.
General Sernhard v. Werder, der neue deutsche
Gotfchafter am russischen Kaiserhofe.
^sls Nachfolger des Ende 1892 von seinem Posten zurück-
getretenen Generals der Infanterie v. Schweinitz fungirt
gegenwärtig General v. Werder als deutscher Botschafter am
russischen Kaiserhofe. Ein siebzehnjähriger früherer Aufent-
halt in St. Petersburg, während dessen er vermöge seiner
Stellung als preußischer und deutscher Militärbcvollmächtigter
zur unmittelbaren Umgebung des Zaren gehörte und nach dem
am russischen Hose herrschenden Brauche als dem militärischen
Gefolge des Kaisers angehörend betrachtet wurde, hat den
neuen Vertreter des deutschen Reiches mit allen Verhältnissen
des russischen Reiches in Staat und Heer und ebenso in der
Petersburger Gesellschaft genau vertraut gemacht. — General
der Infanterie Bernhard v. Werder, dessen Porträt unsere
Leser auf S. 516 finden, ist am 27. Februar 1823 geboren
und hat kürzlich sein siebenzigstss Lebensjahr vollendet, er-
freut sich aber noch voller körperlicher und geistiger Frische.
Nachdem seine Erziehung im Kadettenkorps beendet war,
wurde er 1840 als Lieutenant beim 1. Garderegiment zu
Fuß eingestellt. Im Jahre 1859 zum Major befördert, that
er bis zum I. Juli 1860 persönliche Dienste bei König Wil-
helm 1., 'wurde dann Kommandeur der Garde-Unieroffizier-
kompagnie und 1861 des Garde-Jägerbataillons; 1866 wurde
er Oberst und Kommandeur des Garde-Fllsilierregiments und
erwarb sich im Feldzuge den Orden pour Is rnsrits. Im
November 1869 wurde er Militärbevollmächtigter in St. Peters-
burg, wo ihm seine gewandten Umgangsformen, sein welt-
männisches Wesen und sein loyales Auftreten die Zuneigung
aller Familienmitglieder des russischen Herrscherhauses sowie
der mit ihm verwandten Fürstlichkeiten und der zum kaiser-
lichen Hofhalt gehörenden Würdenträger einbrachte. Den
russisch-türkischen Krieg machte Herr v. Werder im Haupt-
quartier Alexander's ft. mit; er erwarb sich dabei den Georgs-
orden. Inzwischen war er 1870 zum Generalmajor und Ge-
neral n In suits cwancirt; 1875 wurde er Generallieutenant
und im März 1884 General der Infanterie. Im August 1886
wurde er Heimbernfen und als Nachfolger des Freiherrn
v. Willisen zum Gouverneur von Berlin ernannt, blieb in
dieser Stellung aber nicht lange, da infolge der Ernennung
des kommandirenden Generals des Gnrdekorps v. Pape zum
Generalobersten die Vereinigung der Stellung als Ober-
kommandirender der Marken mit dem Berliner Gouverneur-
posten wünschenswerth erschien. Am 19. September 1888 in
Genehmigung seines Abschiedsgesuches zur Disposition gestellt,
hat General v. Werder seitdem als Privatmann meist in
Berlin gewohnt. Alljährlich aber war er Gast des Zaren
für mehrere Wochen, auf dessen ausdrücklichen Wunsch er jetzt
zum Nachfolger des Generals v. Schweinitz ernannt worden ist.
vr. Karl Meuli, schweizerischer Gnndespräsldent
für 1tt93.
(Siehe dn8 Porträt auf Seite 516.)
^ür das Jahr 1892 wählte der am 17. Dezember 1891 als
-O Bundesrath zusainmengetretcne schweizerische National- und
Ständerath den Obersten und Bnndesrath Walther Hauser
(siehe Heft 16 des Jahrgangs 1892), der bis dahin das Amt
des Viceprüsidenten inne gehabt hatte, zum Bundespräsidenten,
während die Wahl zum Viceprüsidenten auf Or. Schenk fiel.
Nach der Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom
29. Mai 1874 hat die Bundesversammlung alljährlich einen
Bundespräsidenten aus dem Bundesrath zu wählen, während
der aus sieben Schweizer Bürgern bestehende Bundesrath, die
Exekutivbehörde, auf drei Jahre, und das Bundesgericht auf
sechs Jahre ernannt werden. Am 15. Dezember 1892 hat
nun wiederum die verfassungsmäßige Bundespräsidentenwahl
stattgefunden, und diesmal ist der bisherige Vicepräsident,
Ov. Karl Schenk, mit der höchsten Amtswürde seiner Heimath
bekleidet worden, während an seine Stells als Vicepräsident
Bundesrath Frey getreten ist. Uebrigcns bekleidet vr. Schenk,
dessen Porträt wir auf S. 516 bringen, bereits zum sechs-
ten Mals seinen jetzigen hohen Posten, wie er auch der
Nestor des siebengliedcrigen Kollegiums der Bundesräthe ist.
Am 1. Dezember 1823 zu Signau im Kanton Bern geboren,
widmete er sich zuerst der Theologie, betheiligte sich aber auch
schon frühzeitig an dem politischen Leben seines Vaterlandes.
1854 vertauschte er den Stand eines Predigers endgiltig mit
dem eines Staatsmannes und war dann von 1854 bis 1863
Mitglied des kantonalen Regierungsrathes und wiederholt
Präsident desselben. Daneben entsandte ihn sein Kanton in
den Ständerath, und als er gerade Vorsitzender desselben war,
berief ihn die Bundesversammlung an die Stelle des aus-
scheidenden Stämpfli. Das war im Jahre 1864; in den
Jahren 1865, 1871, 1874, 1878 und 1885 präsidirte Schenk
bereits dem Bundesräthe. Schenk ist eins Kernnatur voll be-
weglichen Geistes, von vielseitiger Bildung und entschiedenem
schöpferischem Talent. Republikanische Einfachheit und Schlicht-
heit, aber auch republikanische Geradheit und Energie charak-
terisiren ihn nnd haben ihm die Sympathien seiner Lands-
leute gewonnen. Ihm ist insbesondere das Schulwesen und
dessen Ausbau im Sinne der neuen Bundesverfassung unter-
stellt, eine Aufgabe, der sich der jetzige Bundespräsident mit
ganzer Hingabe widmet.
^ns dem Mikail in Rom.
(Siehe daS Bild auf Seite 517.)
1>ie gesammte katholische Welt hat kürzlich den fünfzigjährigen
Gedenktag der Bischofsweihe des Papstes Leo XIII. in
glanzvoller Weise gefeiert, und Schaaren von Pilgern aus
allen Ländern sind nach dsr-Siebenhügelstadt gezogen, um dem
greisen Bewohner des Vatikans ihre Huldigungen darzubringen.
Sonst sind im Allgemeinen die Audienzen beim Papste mit
Rücksicht auf dessen zarte Gesundheit gegenwärtig sehr beschränkt,
und es bedarf einer besonderen Empfehlung an den Maestro
di Camera im Vatikan, um Zulaß zu finden. Bei einer
großen Unzahl von feierlichen Ceremonien im Vatikan bleibt
aber das Laienelsment gänzlich ausgeschlossen. Die eigenartigste
darunter ist diejenige, welche unser Bild auf S. 517 darstellt:
die Weihs der Lämmer, welche die Wolle liefern, aus der das
Pallium der Erzbischöfe gewebt wird. Alljährlich am 21. Januar,
dem Tage der heiligen Agnes, empfängt der Papst, auf seinem
Throne sitzend und von seinem vatikanischen Hofstaate umgeben,
in feierlicher Weise zwei Domherren der Kirche S. Giovanni
in Laterans. Die Laterankirchs ist nämlich die besondere
Kathedrale des Bischofs von Rom, „aller Kirchen der Stadt
und des Erdkreises Mutter und Haupt". Die beiden Geist-
lichen bringen dem Papst zwei lebendige weiße und mit Bän-
dern geschmückte Lämmer dar, welche er segnet. Hierauf wer-
den die Thiere den Nonnen des Klosters der heiligen Agnes
überwiesen, welche schon seit alter Zeit sie aufzuziehen und
ihre Wolle zu sammeln haben, aus der dis Pallien gewebt
werden. Das Pallium war bei den alten Römern ein mantel-
ähnliches Oberkleid. Im katholischen Kultusführt diesen Namen
ein Stück des erzbischöflichen (ausnahmsweise auch wohl deS
bischöflichen) Ornates, bestehend aus einer gabelförmig über
die Schultern gehenden, vorn und hinten herabfallenden hand-
breiten Binde. Sie wird aus der Wolle jener vom Papste
geweihten Lämmer gsivebt nnd ist von weißer Farbe, bis auf
fünf schwarze Kreuze, die darin eingewirkt werden.
Ayello.
Ans dem Leben Lines fahrenden Künstlers.
Von
I. Hrimwahl.
„' (Nachdruck verboten.)
r Mte Länder nnd Völker gesehen, die Freu-
und Leiden des Vagabundenlebens in
Weise kennen gelernt, nnd wenn er
f-L im Stande gewesen wäre, seine Memoiren zu
schreiben, wäre die Welt um ein interessantes
literarisches Erzeugniß bereichert worden. Sein
Direktor war ein echtes Künstlerblut, der wandernde
Cirkus aber gehörte zu den kleinsten seiner Art. Im
Grunde genommen bestand das gesammte Personal
nur aus zwei Kräften, die Gymnastiker, Akrobaten,
Clowns, Intendanten, Schulreiter und noch verschiedenes
Andere zugleich vorstellten. Aber wer die Leistungen
der beiden Mitglieder der Truppe sah, mußte zugestehen,
daß Besseres nicht leicht geboten werden konnte. Es
waren Künstler allerersten Ranges, die wahrlich Besse-
res verdienten, als die Drangsale des fahrenden Gaui-
lerthums — es waren Signor Azzello, wie er mit
seinem Künstlernamen hieß, und der treueste aller
Kameraden und Kunstgenossen, der unvergleichliche
Hektor. Dessen Heimath war das ferne Neufundland,
und es war ihm nicht an der Wiege gesungen worden,
umhin das Schicksal ihn verschlagen würde. Aber er-
wünschte sich kein besseres Loos und hing an dem Direktor
mit blinder treuer Zuneigung, obwohl dieser sie kaum
verdiente. Die gesammte Tageseinnahme behielt der
für sich; seine Künstler erhielten als Gage für ihre
Arbeit eben genug, um das nackte Leben zu fristen,
und oft genug bestand Hektor's Speisezettel tagelang nur
aus Brod und klarem Wasser. Das aber that seinem
Eifer und seiner Hingebung keinen Abbruch, und als
eines Tages die Frau Direktor mit dem Luftgymnastiker
durchgegangcn war unter Mitnahme der Kasse und
zweier Pferde, da brachte er es nicht über's Herz, ihrem
Beispiele zu folgen, obwohl ihm goldene Berge ver-
sprochen worden, wenn er sie begleiten wolle auf der
Wanderschaft. Hektor blieb standhaft und ließ den
Direktor nicht im Stich — treu hielt er aus in Ge-
meinschaft mit dem anderen Kunstgenossen, dem unver-
gleichlichen Signor Azzello.
Vom ersten Augenblick an hatte er den jungen
Kollegen in sein Herz eingeschlossen und Freud wie
Leid treu mit ihm getheilt. Azzello's Charakter aber
war kein edler, den Grundzug seines Wesens bildete ein
ausgesprochener Egoisums, er nahm die mannigfachen
Beweise von des älteren Hektors treuer Fürsorge als
etwas Selbstverständliches hin und lohnte sie nicht selten
mit schnödem Undank. Dann blickte Hektor ihn wohl
an mit seinen tiefen braunen Augen, in denen ein
stummer Vorwurf lag, aber Gleiches mit Gleichem zu
vergelten kam ihm nicht in den Sinn, und wenn sie
nach des Tages Arbeiten und Mühen ihr gemeinschaft-
liches Lager aufsuchten, dann zog er ihn liebevoll an
seine breite Brust und ließ ihn an seinem Herzen ruhen.
So zog die Truppe durch das Land, durch Städte
und Dörfer. Auf offener Straße sanden die Vorstellun-
gen statt. Der Direktor bediente das Orchester, eine
verstimmte Drehorgel, und unter den quiekenden Tönen
führten die Künstler ihre Bravourstücke aus. Wohl
wurde ihnen reicher Beifall zu Theil von Alt und
Jung, aber wenn der Direktor die Runde machte, um
für die Arbeiten seines Personals klingenden Lohn ein-
zuheimsen, dann gab es nur wenig.
Was jedoch der Direktor und der treue Hektor nicht
Holt 21.
fehlt, als sie ging, als sie sagte: wir hatten nichts ge-
mein miteinander? Was können denn Menschen mehr
miteinander gemein haben, als ein Kind? Als ein
Drittes, an dem sie ihre Fehler vermeiden, ihre Gegen-
sätze ausgleichen können?"
Und es wurde ruhig in seiner Seele.-
Sieben lange Tage hindurch schritt er an der Thür
hin und her, die ihm jetzt ein Heiligthum verschloß.
Er fand Mittel und Wege, daß Anna ihn nicht zu
Gesicht bekommen konnte. Nur er sah sie durch das
Guckfensterchen, von dem aus er den Raum überblicken
konnte. Und immer, wenn sein Auge an der völlig
gebrochenen Gestalt haftete, war cs ihm, als treffe ihn
ein Stockstreich — ein wohlverdienter.
Wie bereitwillig er indessen auch seinen breiten
Rücken diesen Schlägen hinhielt — im klebrigen wollte
er nicht unthätig bleiben.
Es wurde ihm leicht, sich über den Verbleib des
Kindes zu unterrichten. Bei diesem Anlaß ergab sich
auch, was Anna begangen hatte. Aller Mittel entblößt,
war sie schließlich mit dem hungrigen, frierenden Kinde
in das erwärmte Wartezimmer des Bahnhofes ge-
gangen. Und dort hatte sie eines der auf dem Tische
liegenden Butterbrödchen entwendet. Der unbarmherzige
Wirth ließ sie verhaften.
Konrad stand — es war am siebenten Morgen nach
der Einlieferung Anna's — vor dem Direktor der
Strafanstalt und bat um seine sofortige Entlassung.
Er sei krank, er müsse fort aus diesem Hause.
Vergebens wies ihn der humane Beamte darauf
hin, daß er aller Ansprüche auf Pension verlustig gehe,
daß er ja, trotz der Rüge von neulich, Aussicht habe,
vorwärts zu kommen.
„Ich muß fort," beharrte Konrad, „es ist hohe Zeit
für mich — ich muß fort!"
„So sagen Sie mir wenigstens die Wahrheit —
weshalb?"
„Weil ich — Herr Direktor — ein schlechter Kerl
bin — ein elender Kerl!"
Der Direktor glaubte nicht anders, als Konrad habe
sich im Dienste etwas zu Schulden kommen lassen.
Aber ihm lag keinerlei Meldung vor — er mußte den
Mann gehen lassen. Er that es nicht ohne Bedauern.
„WennSie eine bürgerlicheBeschäftigung suchen,Helm,
so kommen Sie zu mir, ich werde Ihnen gern behilflich sein!"
Thränen in den Augen stolperte Helm hinaus.
Draußen aber, im Gange, riß er die Uniform vom
Leibe, zog eine alte Jacke an, die er mitgebracht, und
nun, nun eilte er schnell davon.
Oben in Konrad's Revier versah heute ein Kollege
den Dienst.
Als Anna's Raine zur Entlassung aufgcrufen wurde
und sie an dem Beamten vorüberschritt, schwer und
traumbefangen, streifte ihn ihr Blick, und sie nickte
leise. Natürlich — sie hatte sich geirrt an jenem
grauenvollen Tage, als man sie hierher führte.
Nun taumelte sie hinaus — in die Freiheit! In
das Elend.
Ihr entgegen aber schritt Konrad, sein wohlver-
wahrtes Töchterchen auf dem Arme.
„Komm, Anna," sagte er einfach, „komm — wir
Beide haben unsere Strafe überstanden!"
Und er führte die schluchzende Frau und das
lachende Kind nach Hause, einem neuen, besseren Leben
entgegen.
Das W underthie r.
(Siche des Bild auf Seite 51S.)
"kniete Thiere zähmt der Mensch und benutzt sie zu seinen
Zwecken, aber nnr an dem Hunds hat er eigentlich wirk-
lich eine Erobernng gemacht, nur in ihm sich einen zuverläs-
sigen, stets dienstbereiten und bis zuni Tode treuen Freund
gewonnen. Dazu kommt die hohe Intelligenz des Hundes,
die ihn für seinen Herrn wie für den thierfreundlichen Be-
obachter zu einem Gegenstand unerschöpflicher Kurzweil und
interessanter Studien macht. Nicht ein einziger Hund ist
dem anderen geistig völlig gleich geartet, jeder Hai seine Tugen-
den und Fehler: Muth, Treue, Wachsamkeit, Verschmitztheit,
Ast, Haß, Geiz, Zorn, Neid, Zanksucht, Leichtsinn, Geschicklich-
keit und Trägheit — Alles findet man beim Hunde, daher er
auch den Thiermalern Stoff zu den ergötzlichsten Genrebildern
liefert. Das hübsche Bild auf S. 518 stellt einen Vorgang
ans dem Hundeleben dar, worin sich das Mißtrauen und die
Fähigkeit, zu erstaunen, die der Hund so gut besitzt wie der
Mensch, in drastischer Weise offenbart. Was über die Be-
griffe des gewöhnlichen Menschen hinansgeht, erscheint ihm
als ein Unfaßbares, als ein Wunder. Ebenso ergeht es
klugen Hunden. Ein solches Wunder erlebt eben auch die
ehrsame Teckelfamilie, indem die Tochter des Hauses ein ihr
vom Onkel geschenktes Spielzeug in's Zimmer bringt, ein
kleines Pndclhündchen darstellend, welches, sobald man auf
einen Gummiball drückt, von dem aus ein Schlauch bis zum
ftalse des Thierss geht, wie ein wirklicher Hund bellt. Ganz
starr vor Staunen blicken die braven Teckel auf dies selt-
same, nie vorher gesehene unheimliche Wesen, und nur mit
^utschiedenem Mißtrauen wagen sie es, sich langsam diesem
Wunderthiere zu nähern. Der Ausdruck in Gesicht und Hal-
sung der Hunde ist vortrefflich getroffen. Dio junge Herrin
R'ht mit Spannung zu, wie diese Hundekomödie sich weiter
Zwickeln wird.
General Sernhard v. Werder, der neue deutsche
Gotfchafter am russischen Kaiserhofe.
^sls Nachfolger des Ende 1892 von seinem Posten zurück-
getretenen Generals der Infanterie v. Schweinitz fungirt
gegenwärtig General v. Werder als deutscher Botschafter am
russischen Kaiserhofe. Ein siebzehnjähriger früherer Aufent-
halt in St. Petersburg, während dessen er vermöge seiner
Stellung als preußischer und deutscher Militärbcvollmächtigter
zur unmittelbaren Umgebung des Zaren gehörte und nach dem
am russischen Hose herrschenden Brauche als dem militärischen
Gefolge des Kaisers angehörend betrachtet wurde, hat den
neuen Vertreter des deutschen Reiches mit allen Verhältnissen
des russischen Reiches in Staat und Heer und ebenso in der
Petersburger Gesellschaft genau vertraut gemacht. — General
der Infanterie Bernhard v. Werder, dessen Porträt unsere
Leser auf S. 516 finden, ist am 27. Februar 1823 geboren
und hat kürzlich sein siebenzigstss Lebensjahr vollendet, er-
freut sich aber noch voller körperlicher und geistiger Frische.
Nachdem seine Erziehung im Kadettenkorps beendet war,
wurde er 1840 als Lieutenant beim 1. Garderegiment zu
Fuß eingestellt. Im Jahre 1859 zum Major befördert, that
er bis zum I. Juli 1860 persönliche Dienste bei König Wil-
helm 1., 'wurde dann Kommandeur der Garde-Unieroffizier-
kompagnie und 1861 des Garde-Jägerbataillons; 1866 wurde
er Oberst und Kommandeur des Garde-Fllsilierregiments und
erwarb sich im Feldzuge den Orden pour Is rnsrits. Im
November 1869 wurde er Militärbevollmächtigter in St. Peters-
burg, wo ihm seine gewandten Umgangsformen, sein welt-
männisches Wesen und sein loyales Auftreten die Zuneigung
aller Familienmitglieder des russischen Herrscherhauses sowie
der mit ihm verwandten Fürstlichkeiten und der zum kaiser-
lichen Hofhalt gehörenden Würdenträger einbrachte. Den
russisch-türkischen Krieg machte Herr v. Werder im Haupt-
quartier Alexander's ft. mit; er erwarb sich dabei den Georgs-
orden. Inzwischen war er 1870 zum Generalmajor und Ge-
neral n In suits cwancirt; 1875 wurde er Generallieutenant
und im März 1884 General der Infanterie. Im August 1886
wurde er Heimbernfen und als Nachfolger des Freiherrn
v. Willisen zum Gouverneur von Berlin ernannt, blieb in
dieser Stellung aber nicht lange, da infolge der Ernennung
des kommandirenden Generals des Gnrdekorps v. Pape zum
Generalobersten die Vereinigung der Stellung als Ober-
kommandirender der Marken mit dem Berliner Gouverneur-
posten wünschenswerth erschien. Am 19. September 1888 in
Genehmigung seines Abschiedsgesuches zur Disposition gestellt,
hat General v. Werder seitdem als Privatmann meist in
Berlin gewohnt. Alljährlich aber war er Gast des Zaren
für mehrere Wochen, auf dessen ausdrücklichen Wunsch er jetzt
zum Nachfolger des Generals v. Schweinitz ernannt worden ist.
vr. Karl Meuli, schweizerischer Gnndespräsldent
für 1tt93.
(Siehe dn8 Porträt auf Seite 516.)
^ür das Jahr 1892 wählte der am 17. Dezember 1891 als
-O Bundesrath zusainmengetretcne schweizerische National- und
Ständerath den Obersten und Bnndesrath Walther Hauser
(siehe Heft 16 des Jahrgangs 1892), der bis dahin das Amt
des Viceprüsidenten inne gehabt hatte, zum Bundespräsidenten,
während die Wahl zum Viceprüsidenten auf Or. Schenk fiel.
Nach der Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom
29. Mai 1874 hat die Bundesversammlung alljährlich einen
Bundespräsidenten aus dem Bundesrath zu wählen, während
der aus sieben Schweizer Bürgern bestehende Bundesrath, die
Exekutivbehörde, auf drei Jahre, und das Bundesgericht auf
sechs Jahre ernannt werden. Am 15. Dezember 1892 hat
nun wiederum die verfassungsmäßige Bundespräsidentenwahl
stattgefunden, und diesmal ist der bisherige Vicepräsident,
Ov. Karl Schenk, mit der höchsten Amtswürde seiner Heimath
bekleidet worden, während an seine Stells als Vicepräsident
Bundesrath Frey getreten ist. Uebrigcns bekleidet vr. Schenk,
dessen Porträt wir auf S. 516 bringen, bereits zum sechs-
ten Mals seinen jetzigen hohen Posten, wie er auch der
Nestor des siebengliedcrigen Kollegiums der Bundesräthe ist.
Am 1. Dezember 1823 zu Signau im Kanton Bern geboren,
widmete er sich zuerst der Theologie, betheiligte sich aber auch
schon frühzeitig an dem politischen Leben seines Vaterlandes.
1854 vertauschte er den Stand eines Predigers endgiltig mit
dem eines Staatsmannes und war dann von 1854 bis 1863
Mitglied des kantonalen Regierungsrathes und wiederholt
Präsident desselben. Daneben entsandte ihn sein Kanton in
den Ständerath, und als er gerade Vorsitzender desselben war,
berief ihn die Bundesversammlung an die Stelle des aus-
scheidenden Stämpfli. Das war im Jahre 1864; in den
Jahren 1865, 1871, 1874, 1878 und 1885 präsidirte Schenk
bereits dem Bundesräthe. Schenk ist eins Kernnatur voll be-
weglichen Geistes, von vielseitiger Bildung und entschiedenem
schöpferischem Talent. Republikanische Einfachheit und Schlicht-
heit, aber auch republikanische Geradheit und Energie charak-
terisiren ihn nnd haben ihm die Sympathien seiner Lands-
leute gewonnen. Ihm ist insbesondere das Schulwesen und
dessen Ausbau im Sinne der neuen Bundesverfassung unter-
stellt, eine Aufgabe, der sich der jetzige Bundespräsident mit
ganzer Hingabe widmet.
^ns dem Mikail in Rom.
(Siehe daS Bild auf Seite 517.)
1>ie gesammte katholische Welt hat kürzlich den fünfzigjährigen
Gedenktag der Bischofsweihe des Papstes Leo XIII. in
glanzvoller Weise gefeiert, und Schaaren von Pilgern aus
allen Ländern sind nach dsr-Siebenhügelstadt gezogen, um dem
greisen Bewohner des Vatikans ihre Huldigungen darzubringen.
Sonst sind im Allgemeinen die Audienzen beim Papste mit
Rücksicht auf dessen zarte Gesundheit gegenwärtig sehr beschränkt,
und es bedarf einer besonderen Empfehlung an den Maestro
di Camera im Vatikan, um Zulaß zu finden. Bei einer
großen Unzahl von feierlichen Ceremonien im Vatikan bleibt
aber das Laienelsment gänzlich ausgeschlossen. Die eigenartigste
darunter ist diejenige, welche unser Bild auf S. 517 darstellt:
die Weihs der Lämmer, welche die Wolle liefern, aus der das
Pallium der Erzbischöfe gewebt wird. Alljährlich am 21. Januar,
dem Tage der heiligen Agnes, empfängt der Papst, auf seinem
Throne sitzend und von seinem vatikanischen Hofstaate umgeben,
in feierlicher Weise zwei Domherren der Kirche S. Giovanni
in Laterans. Die Laterankirchs ist nämlich die besondere
Kathedrale des Bischofs von Rom, „aller Kirchen der Stadt
und des Erdkreises Mutter und Haupt". Die beiden Geist-
lichen bringen dem Papst zwei lebendige weiße und mit Bän-
dern geschmückte Lämmer dar, welche er segnet. Hierauf wer-
den die Thiere den Nonnen des Klosters der heiligen Agnes
überwiesen, welche schon seit alter Zeit sie aufzuziehen und
ihre Wolle zu sammeln haben, aus der dis Pallien gewebt
werden. Das Pallium war bei den alten Römern ein mantel-
ähnliches Oberkleid. Im katholischen Kultusführt diesen Namen
ein Stück des erzbischöflichen (ausnahmsweise auch wohl deS
bischöflichen) Ornates, bestehend aus einer gabelförmig über
die Schultern gehenden, vorn und hinten herabfallenden hand-
breiten Binde. Sie wird aus der Wolle jener vom Papste
geweihten Lämmer gsivebt nnd ist von weißer Farbe, bis auf
fünf schwarze Kreuze, die darin eingewirkt werden.
Ayello.
Ans dem Leben Lines fahrenden Künstlers.
Von
I. Hrimwahl.
„' (Nachdruck verboten.)
r Mte Länder nnd Völker gesehen, die Freu-
und Leiden des Vagabundenlebens in
Weise kennen gelernt, nnd wenn er
f-L im Stande gewesen wäre, seine Memoiren zu
schreiben, wäre die Welt um ein interessantes
literarisches Erzeugniß bereichert worden. Sein
Direktor war ein echtes Künstlerblut, der wandernde
Cirkus aber gehörte zu den kleinsten seiner Art. Im
Grunde genommen bestand das gesammte Personal
nur aus zwei Kräften, die Gymnastiker, Akrobaten,
Clowns, Intendanten, Schulreiter und noch verschiedenes
Andere zugleich vorstellten. Aber wer die Leistungen
der beiden Mitglieder der Truppe sah, mußte zugestehen,
daß Besseres nicht leicht geboten werden konnte. Es
waren Künstler allerersten Ranges, die wahrlich Besse-
res verdienten, als die Drangsale des fahrenden Gaui-
lerthums — es waren Signor Azzello, wie er mit
seinem Künstlernamen hieß, und der treueste aller
Kameraden und Kunstgenossen, der unvergleichliche
Hektor. Dessen Heimath war das ferne Neufundland,
und es war ihm nicht an der Wiege gesungen worden,
umhin das Schicksal ihn verschlagen würde. Aber er-
wünschte sich kein besseres Loos und hing an dem Direktor
mit blinder treuer Zuneigung, obwohl dieser sie kaum
verdiente. Die gesammte Tageseinnahme behielt der
für sich; seine Künstler erhielten als Gage für ihre
Arbeit eben genug, um das nackte Leben zu fristen,
und oft genug bestand Hektor's Speisezettel tagelang nur
aus Brod und klarem Wasser. Das aber that seinem
Eifer und seiner Hingebung keinen Abbruch, und als
eines Tages die Frau Direktor mit dem Luftgymnastiker
durchgegangcn war unter Mitnahme der Kasse und
zweier Pferde, da brachte er es nicht über's Herz, ihrem
Beispiele zu folgen, obwohl ihm goldene Berge ver-
sprochen worden, wenn er sie begleiten wolle auf der
Wanderschaft. Hektor blieb standhaft und ließ den
Direktor nicht im Stich — treu hielt er aus in Ge-
meinschaft mit dem anderen Kunstgenossen, dem unver-
gleichlichen Signor Azzello.
Vom ersten Augenblick an hatte er den jungen
Kollegen in sein Herz eingeschlossen und Freud wie
Leid treu mit ihm getheilt. Azzello's Charakter aber
war kein edler, den Grundzug seines Wesens bildete ein
ausgesprochener Egoisums, er nahm die mannigfachen
Beweise von des älteren Hektors treuer Fürsorge als
etwas Selbstverständliches hin und lohnte sie nicht selten
mit schnödem Undank. Dann blickte Hektor ihn wohl
an mit seinen tiefen braunen Augen, in denen ein
stummer Vorwurf lag, aber Gleiches mit Gleichem zu
vergelten kam ihm nicht in den Sinn, und wenn sie
nach des Tages Arbeiten und Mühen ihr gemeinschaft-
liches Lager aufsuchten, dann zog er ihn liebevoll an
seine breite Brust und ließ ihn an seinem Herzen ruhen.
So zog die Truppe durch das Land, durch Städte
und Dörfer. Auf offener Straße sanden die Vorstellun-
gen statt. Der Direktor bediente das Orchester, eine
verstimmte Drehorgel, und unter den quiekenden Tönen
führten die Künstler ihre Bravourstücke aus. Wohl
wurde ihnen reicher Beifall zu Theil von Alt und
Jung, aber wenn der Direktor die Runde machte, um
für die Arbeiten seines Personals klingenden Lohn ein-
zuheimsen, dann gab es nur wenig.
Was jedoch der Direktor und der treue Hektor nicht