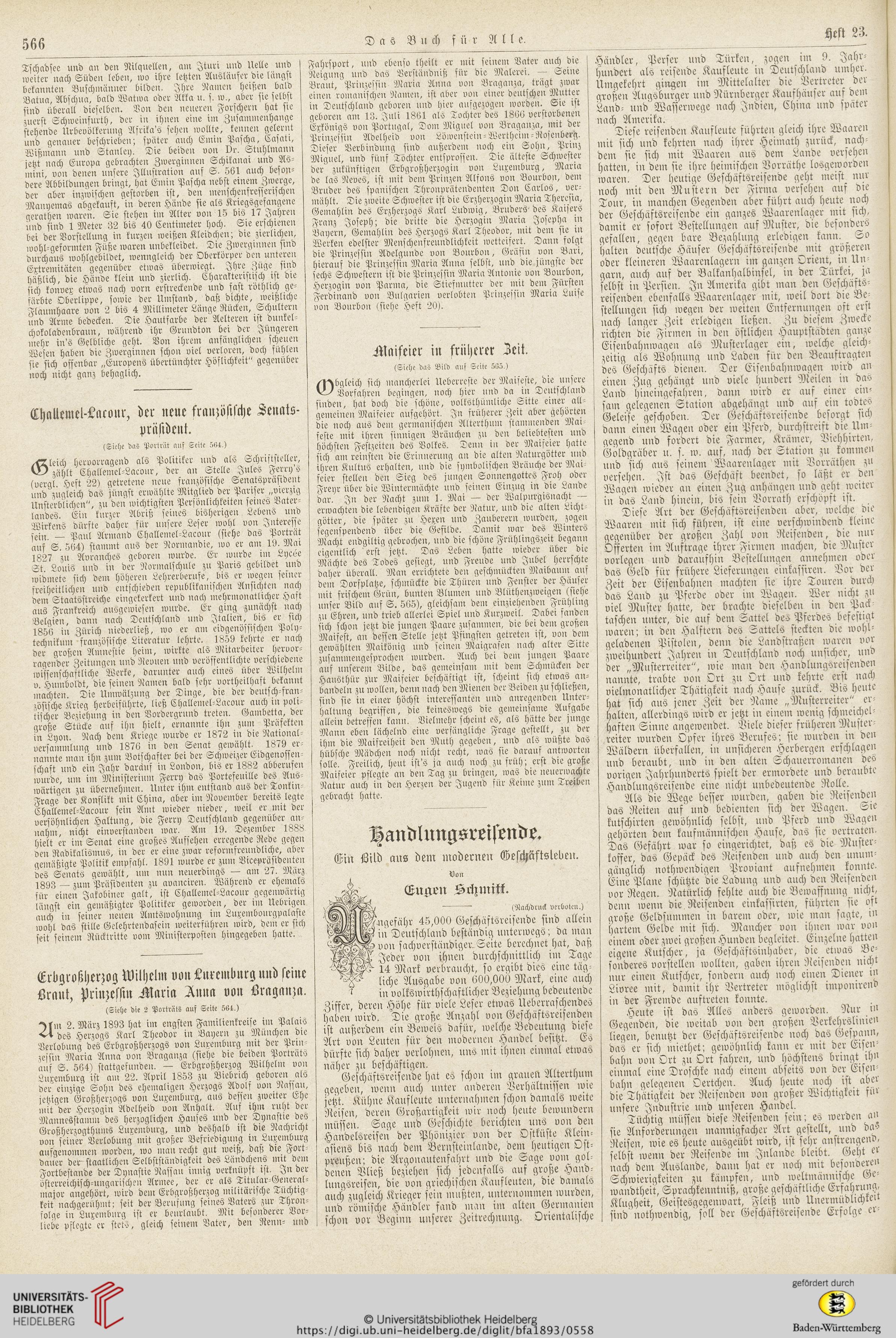566
Das Buch f ü r All c.
Tschadsee und an den Nilquellen, am Jturi und Uelle und
weiter nach Süden leben, wo ihre letzten Ausläufer die längst
bekannten Buschmänner bilden. Ihre Namen heißen bald
Batua, Abschua, bald Watwa oder Akka u. s. n>., aber sie selbst
sind überall dieselben. Von den neueren Forschern hat sie
zuerst Schweinfurth, der in ihnen eine im Zusammenhänge
stehende Urbevölkerung Afrika's sehen wollte, kennen gelernt
und genauer beschrieben; später auch Emin Pascha, Casati,
Wißmann und Stanley. Die beiden von vr. Stuhlmann
jetzt nach Europa gebrachten Zwerginnen Schikanai und AS-
mini, von denen unsere Illustration auf S. 561 auch beson-
dere Abbildungen bringt, hat Emin Pascha nebst einem Zwerge,
der aber inzwischen gestorben ist, den menschenfresserischen
Manyomas abgekauft, in deren Hände sie als Kriegsgefangene
gerathen waren. Sie stehen im Alter von 15 bis 17 Jahren
und sind 1 Meter 82 bis 40 Centimetor hoch. Sie erschienen
bei der Vorstellung in kurzen weißen Kleidchen; die zierlichen,
wohl-geformten Füße waren unbekleidet. Dio Zwerginnen sind
durchaus wohlgebildet, wenngleich der Oberkörper den unteren
Extremitäten gegenüber etwas überwiegt. Ihre Züge sind
häßlich, die Hände klein und zierlich. Charakteristisch ist die
sich konvex etwas nach vorn erstreckende und fast röthlich ge-
färbte Oberlippe, sowie der Umstand, daß dichte, weißliche
Flaumhaare von 2 bis 4 Millimeter Länge Rücken, Schultern
und Arme bedecken. Die Hautfarbe der Aelteren ist dunkel-
chokoladenbraun, während ihr Grundton bei der Jüngeren
mehr in's Gelbliche geht. Von ihrem anfänglichen scheuen
Wesen haben die Zwerginnen schon viel verloren, doch fühlen
sie sich offenbar „Europens übertünchter Höflichkeit" gegenüber
noch nicht ganz behaglich.
LhaUemel-LlMuu', der neue französische Senats-
Mkdent.
(Siche das Porträt auf Seite 5tt-l.)
/gleich hervorragend als Politiker und als Schriftsteller,
vN zählt Challemcl-Lacour, der an Stelle Jules Ferry's
(vergl. Heft 22) getretene neue französische Senatspräsident
und zugleich das jüngst erwählte Mitglied der Pariser „vierzig
Unsterblichen", zu den wichtigsten Persönlichkeiten seines Vater-
landes. Ein kurzer Abriß seines bisherigen Lebens und
Wirkens dürfte daher für unsere Leser wohl von Interesse
sein. — Paul Armand Challemel-Lacour (siehe das Porträt
auf S. 564) stammt aus der Normandie, ivo er am 1!). Mai
1827 zu Avranches geboren wurde. Er wurde im Lycse
St. LouiS und in der Normalschule zu Paris gebildet und
widmete sich dem höheren Lehrerberufe, bis er wegen seiner
freiheitlichen und entschieden republikanischen Ansichten nach
dem Staatsstreiche eingckerkert und nach mehrmonatlicher Haft
aus Frankreich ausgewiesen wurde. Er ging zunächst nach
Belgien, dann nach Deutschland und Italien, bis er sich
1856 in Zürich niederließ, wo er am eidgenössischen Poly-
technikum französische Literatur lehrte. 1859 kehrte er nach
der großen Amnestie heim, wirkte als Mitarbeiter hervor-
ragender Zeitungen und Revuen und veröffentlichte verschiedene
wissenschaftliche Werke, darunter auch eines über Wilhelm
v. Humboldt, die seinen Namen bald sehr vortheilhaft bekannt
machten. Die Umwälzung der Dinge, die der deutsch-fran-
zösische Krieg herbeiführte, ließ Challemel-Lacour auch in poli
tischer Beziehung in den Vordergrund treten. Gambetta, der
große Stücke auf ihn hielt, ernannte ihn zum Präfekten
in Lyon. Nach dem Kriege wurde er 1872 in die National-
versammlung und 1876 in den Senat gewählt. 1879 er-
nannte man ihn zum Botschafter bei der Schweizer Eidgenossen
schäft und ein Jahr daräuf in London, bis er 1882 abberufen
wurde, um im Ministerium Ferry das Portefeuille des Aus
wärtigen zu übernehmen. Unter ihm entstand aus der Tonkin
Frage der Konflikt mit China, aber im November bereits legte
Challemel-Lacour sein Amt wieder nieder, weil er mit dcr
versöhnlichen Haltung, die Ferry Deutschland gegenüber an-
nahm, nicht einverstanden war. Am 19. Dezember 1888
hielt er im Senat eine großes Aufsehen erregende Rede gegen
den Radikalismus, in der er eine zwar reformfreundliche, aber-
gemäßigte Politik empfahl. 1891 wurde er zum Vicepräsidenten
des Senats gewählt, um nun neuerdings — am 27. März
1898 — zum Präsidenten zu avancireu. Während er ehemals
für einen Jakobiner galt, ist Challemel-Lacour gegenwärtig
längst ein gemäßigter Politiker geworden, der im klebrigen
auch in seiner neuen Amtswohnung im Luxembourgpalaste
wohl das stille Gelehrtendasein weiterführen wird, dem er sich
seit seinem Rücktritte vom Ministerposten hingegeben hatte.
Erbgroßherzog Wilhelm von Lurembnrg und leine
Lrant, Prinzessin Marin Anna von Sraganza.
(Siehe die 2 Porträts auf Seite 564.)
^sm 2. März 1893 hat im engsten Familienkreise im Palais
des Herzogs Karl Theodor in Bayern zu München die
Verlobung des Erbgroßherzogs von Luxemburg mit der Pria
zessin Maria Anna von Braganza (siehe die beiden Porträts
auf S. 564) stattgefunden. — Erbgroßherzog Wilhelm von
Luxemburg ist am 22. April 1853 zu Biebrich geboren als
der einzige Sohn des ehemaligen Herzogs Adolf von Nassau,
jetzigen Großherzogs von Luxemburg, auS dessen zweiter Ehe
mit der Herzogin Adelheid von Anhalt. Auf ihm ruht der
Mannesstamm des herzoglichen Hauses und der Dynastie des
Großherzogthums Luxemburg, und deshalb ist die Nachricht
von seiner Verlobung mit großer Befriedigung in Luxemburg
ausgenommen worden, wo man recht gut weiß, daß die Fort
dauer der staatlichen Selbstständigkeit des Ländchens mit dem
Fortbestände der Dynastie Nassau innig verknüpft ist. In der
österreichisch-ungarischen Armee, der er als Titular-General-
major angehört, wird dem Erbgroßherzog militärische Tüchtig-
keit nachgerühmt; seit der Berufung seines Vaters zur Thron-
folge in Luxemburg ist er beurlaubt. Mit besonderer Vor-
liebe pflegte er stets, gleich seinem Vater, den Renn- und
Fahrsport, und ebenso thcilt er mit seinem Vater auch die
Neigung und das Verständnis! für die Malerei. — Seine
Braut, Prinzessin Marin Anna von Braganza, trägt zwar
einen romanischen Namen, ist aber von einer deutschen Mutter
in Deutschland geboren und hier aufgezogen worden. Sie ist
geboren am 13. Juli 1861 als Tochter des 1866 verstorbenen
Exkönigs von Portugal, Dom Miguel von Braganza, mit der
Prinzessin Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
Dieser Verbindung sind außerdem noch ein Sohn, Prinz
Miguel, und fünf Töchter entsprossen. Die älteste Schwester
der zukünftigen Erbgroßherzogin von Luxemburg, Maria
de las Neves, ist mit dem Prinzen Alfons von Bourbon, dem
Bruder des spanischen Thronprätendenten Don Carlos, ver-
mählt. Die zweite Schwester ist die Erzherzogin Maria Theresia,
Gemahlin dos Erzherzogs Karl Ludwig, Bruders-des Kaisers
Franz Joseph; die dritte die Herzogin Maria Josepha in
Bayern, Gemahlin des Herzogs Karl Theodor, mit dein sie in
Werken edelster Menschenfreundlichkeit wetteifert. Dann folgt
die Prinzessin Adelgunde von Bourbon, Gräfin von Bari,
hierauf die Prinzessin Maria Anna selbst, und die jüngste der
sechs Schwestern ist dis Prinzessin Maria -Antonic von Bourbon,
Herzogin von Parma, die Stiefmutter der mit dem Fürsten
Ferdinand von Bulgarien verlobten Prinzessin Maria Luise
von Bourbon (siehe Heft 20).
Maifeier in früherer Zeit.
(Siehe Bild auf Seite 565.)
/Obgleich sich mancherlei Ueberreste der Maiseste, die unsere
Vorfahren begingen, noch hier und da in Deutschland
finden, hat doch die schöne, volksthümliche Sitte einer all-
gemeinen Maifeier aufgehört. In früherer Zeit aber gehörten
die noch aus dem germanischen Alterthum stammenden Mai
feste mit ihren sinnigen Bräuchen zu den beliebtesten und
höchsten Festzeitcn des Volkes. Denn in der Maifeier hatte
sich am reinsten die Erinnerung an die alten Naturgötter uud
ihren Kultus erhalten, und die symbolischen Bräuche der Mai
feier stellen den Sieg deS jungen Sonnengottes Froh odcr
Freyr über die Wintermächtc und seinen Einzug in dis Lande
dar. In der Nacht zum 1. Mai — der Walpurgisnacht —
erwachten die lebendigen Kräfte der -Natur, und die alten Licht
götter, die später zu Hexen und Zauberern wurden, zogen
segcnspendend über die Gefilde. Damit war des Winters
Macht endgiltig gebrochen, und die schöne Frühlingszeit begann
eigentlich erst jetzt. Das Leben hatte wieder über die
Mächte des Todes gesiegt, und Freude und Jubel herrschte
daher überall. Man errichtete den geschmückten Maibaum auf
deni Dorfplatze, schmückte die Thüren und Fenster der Hauser
init frischem Grün, bunten Blumen und Blüthenzweigen (siehe
unser Bild auf S. 565), gleichsam dem einziehenden Frühling
zu Ehren, und trieb allerlei Spiel und Kurzweil. Dabei fanden
sich schon jetzt die jungen Paare zusammen, die bei dem großen
Maifest, an dessen Stelle jetzt Pfingsten getreten ist, von dem
gewählten Maikönig und seinen Maigrafen nach alter Sitte
zusammengesprochen wurden. Auch bei dem jungen Paare
auf unserem Bilde, das gemeinsam mit dem Schmücken der
HauSthür zur Maifeier beschäftigt ist, scheint sich etwas an-
bandeln zu wollen, denn nach den Mienen der Beiden zu schließen,
sind sie in einer höchst interessanten und anregenden Unter-
haltung begriffen, die keineswegs die gemeinsame Aufgabe
allein betreffen kann. Vielmehr scheint es, als hätte der junge
Mann eben lächelnd eine verfängliche Frage gestellt, zu der
ihm die Maifreiheit den Muth gegeben, und als wüßte das
hübsche Mädchen noch nicht recht, waS sie darauf antworten
solle. Freilich, heut ist's ja auch noch zu früh; erst die große
Maifeier pflegte an den Tag zu bringen, was die ueuerwachte
Natur auch in den Herzen der Jugend für Keime zum Treiben
gebracht hatte.
Handlnngsreisende.
Ein Md aus dem modernen Geschäftsieben.
Von
Eugen Schmitt.
(Nachdruck verboten.)
45,000 Geschäftsreisende sind allein
Deutschland beständig unterwegs; da man
sachverständiger.Leite berechnet hat, daß
Jeder von ihnen durchschnittlich im Tage
14 Mark verbraucht, so ergibt dies eine täg-
liche Ausgabe von 600,000 Mark, eine auch
l in volkswirthschaftlicher Beziehung bedeutende
Ziffer, deren Höhe für viele Leser etwas UeberraschendeS
haben wird. Die große Anzahl von Geschäftsreisenden
ist außerdem ein Beweis dafür, welche Bedeutung diese
Art von Leuten für den modernen Handel besitzt. Es
dürfte sich daher verlohnen, uns mit ihnen einmal etwas
näher zu beschäftigen.
Geschäftsreisende hat es schon im grauen Alterthum
gegeben, wenn auch unter anderen Verhältnissen wie
jetzt. Kühne Kaufleute unternahmen schon damals weite
Reisen, deren Großartigkeit wir nach heute bewundern
müssen. Sage und Geschichte berichten uns von den
Handelsreisen der Phönizier von der Ostküste Klein-
asiens bis nach dem Bernsteinlande, dem heutigen Ost-
preußen; die Argonautenfahrt und die Sage von: gol-
denen Vließ beziehen sich jedenfalls auf große Hand-
lungSreisen, die von griechischen Kaufleuten, die damals
auch zugleich Krieger sein mußten, unternommen wurden,
und römische Händler fand man im alten Germanien
schon vor Beginn unserer Zeitrechnung. Orientalische
Heft 23.
Händler, Perser und Türken, zogen im 9. Jahr-
hundert als reisende Kaufleute in Deutschland umher.
Umgekehrt girrgen im Mittelalter die Vertreter der
großen Augsburger und Nürnberger Kaufhäuser aus dem
Land- und Wasserwege nach Indien, China und später
nach Amerika.
Diese reisenden Kaufleute führten gleich ihre Waaren
mit sich und kehrten nach ihrer Heimath zurück, nach-
dem sie sich mit Waaren aus dem Lande versehen
hatten, in dem sie ihre heimischen Vorräthe losgeworden
waren. Der heutige Geschäftsreisende geht meist nur
noch mit den Mustern der Firma versehen auf die
Tour, in manchen Gegenden aber führt auch heute noch
der Geschäftsreisende ein ganzes Waarenlager mit sich,
damit er sofort Bestellungen auf Muster, die besonders
gefallen, gegen bare Bezahlung erledigen kann. So
halten deutsche Häuser Geschäftsreisende mit größeren
oder kleineren Waarenlagern im ganzen Orient, in Un-
garn, auch auf der Balkanhalbinsel, in der Türkei, ja
selbst in Persien. In Amerika gibt man den Geschäfts-
reisenden ebenfalls Waarenlager mit, weil dort die Be-
stellungen sich wegen der weiten Entfernungen oft erst
nach langer Zeit erledigen ließen. Zu diesem Zwecke
richten die Firmen in den östlichen Hauptstädten ganze
Eisenbahnwagen als Musterlager ein, welche gleich-
zeitig als Wohnung und Laden für den Beauftragten
des Geschäfts dienen. Der Eisenbahnwagen wird an
einen Zug gehängt und viele hundert Meilen in das
Land hineingefahren, dann wird er auf einer ein-
sam gelegenen Station abgehängt und auf ein todtes
Geleise geschoben. Der Geschäftsreisende besorgt sich
dann einen Wagen oder ein Pferd, durchstreift die Um-
gegend und fordert die Farmer, Krämer, Viehhirten,
Goldgräber u. s. w. auf, nach der Station zu kommen
und sich aus seinem Waarenlager mit Vorräthen zu
versehen. Ist das Geschäft beendet, so läßt er den
Wagen wieder an einen Zug anhängen und geht wcitcr
in das Land hinein, bis sein Vorrath erschöpft ist.
Diese Art der Geschäftsreisenden aber, welche die
Waaren mit sich führen, ist eine verschwindend kleine
gegenüber der großen Zahl von Reisenden, die nur
Offerten im Auftrage ihrer Firmen machen, die Mustcr
vorlegen und daraufhin Bestellungen annehmen oder
das Geld für frühere Lieferungen einkassiren. Vor der
Zeit der Eisenbahnen machten sie ihre Touren durch
das Land zu Pferde oder im Wagen. Wer nicht zu
viel Muster hatte, der brachte dieselben in den Pack
taschen unter, die auf dem Sattel des Pferdes befestigt
waren; in den Halftern des Sattels steckten die wohl-
geladenen Pistolen, denn die Landstraßen waren vor
zweihundert Jahren in Deutschland noch unsicher, und
der „Musterreiter", ivie man den Handlungsreisenden
nannte, trabte von Ort zu Ort und kehrte erst nach
vielmonatlicher Thätigkeit nach Hause zurück. Bis heute
hat sich aus jener Zeit der Name „Musterreiter" er-
halten, allerdings wird er jetzt in einem wenig schmeichel-
haften Sinne angewendet. Viele dieser früheren Muster
reiter wurden Opfer ihres Berufes; sie wurden in den
Wäldern überfallen, in unsicheren Herbergen erschlagen
und beraubt, und in den alten Schauerromanen des
vorigen Jahrhunderts spielt der ermordete und beraubte
Handlungsreisende eine nicht unbedeutende Rolle.
Als die Wege besser wurden, gaben die Reisenden
das Reiten auf und bedienten sich der Wagen. Sie
kutschirten gewöhnlich selbst, und Pferd und Wagen
gehörten dem kaufmännischen Hause, das sie vertraten.
Das Geführt war so eingerichtet, daß es die Muster-
koffer, das Gepäck des Reisenden und auch den unum-
gänglich nothwendigen Proviant aufnehmen konnte.
Eine Plane schützte die Ladung und auch den Reisenden
vor Regen. Natürlich fehlte auch die Bewaffnung nicht,
denn wenn die Reisenden einkassirten, führten sie oft
große Geldsummen in baren: oder, wie man sagte, in
hartem Gelde mit sich. Mancher von ihnen war von
einem oder zwei großen Hunden begleitet. Einzelne hatten
eigene Kutscher, ja Geschäftsinhaber, die etwas Be-
sonderes vorstellen wollten, gaben ihren Reisenden nicht
nur einen Kutscher, sondern auch noch einen Diener in
Livree mit, damit ihr Vertreter möglichst imponirend
in der Fremde auftreten konnte.
Heute ist das Alles anders geworden. Nur in
Gegenden, die weitab von den großen Verkehrslinien
liegen, benutzt der Geschäftsreisende noch das Gespann,
das er sich miethet; gewöhnlich kann er mit der Eisen-
bahn von Ort zu Ort fahren, und höchstens bringt ihn
einmal eine Droschke nach einen: abseits von der Eisen-
bahn gelegene,: Oertchen. Auch heute noch ist aber
die Thätigkeit der Reisenden von großer Wichtigkeit für
unsere Industrie und unseren Handel.
Tüchtig müssen diese Reisenden sein ; es werden an
sie Anforderungen mannigfacher Art gestellt, und das
Reisen, ivie es heute ausgeübt wird, ist sehr anstrengend,
selbst wenn der Reisende im Inlands bleibt. Geht er
nach dem Auslande, dann hat er noch mit besonderen
Schwierigkeiten zu kämpfen, und weltmännische Ge-
wandtheit, Sprachkenntniß, große geschäftliche Erfahrung,
Klugheit, Geistesgegenwart, Fleiß und Unermüdlichkeit
sind notwendig, soll der Geschäftsreisende Erfolge er-
Das Buch f ü r All c.
Tschadsee und an den Nilquellen, am Jturi und Uelle und
weiter nach Süden leben, wo ihre letzten Ausläufer die längst
bekannten Buschmänner bilden. Ihre Namen heißen bald
Batua, Abschua, bald Watwa oder Akka u. s. n>., aber sie selbst
sind überall dieselben. Von den neueren Forschern hat sie
zuerst Schweinfurth, der in ihnen eine im Zusammenhänge
stehende Urbevölkerung Afrika's sehen wollte, kennen gelernt
und genauer beschrieben; später auch Emin Pascha, Casati,
Wißmann und Stanley. Die beiden von vr. Stuhlmann
jetzt nach Europa gebrachten Zwerginnen Schikanai und AS-
mini, von denen unsere Illustration auf S. 561 auch beson-
dere Abbildungen bringt, hat Emin Pascha nebst einem Zwerge,
der aber inzwischen gestorben ist, den menschenfresserischen
Manyomas abgekauft, in deren Hände sie als Kriegsgefangene
gerathen waren. Sie stehen im Alter von 15 bis 17 Jahren
und sind 1 Meter 82 bis 40 Centimetor hoch. Sie erschienen
bei der Vorstellung in kurzen weißen Kleidchen; die zierlichen,
wohl-geformten Füße waren unbekleidet. Dio Zwerginnen sind
durchaus wohlgebildet, wenngleich der Oberkörper den unteren
Extremitäten gegenüber etwas überwiegt. Ihre Züge sind
häßlich, die Hände klein und zierlich. Charakteristisch ist die
sich konvex etwas nach vorn erstreckende und fast röthlich ge-
färbte Oberlippe, sowie der Umstand, daß dichte, weißliche
Flaumhaare von 2 bis 4 Millimeter Länge Rücken, Schultern
und Arme bedecken. Die Hautfarbe der Aelteren ist dunkel-
chokoladenbraun, während ihr Grundton bei der Jüngeren
mehr in's Gelbliche geht. Von ihrem anfänglichen scheuen
Wesen haben die Zwerginnen schon viel verloren, doch fühlen
sie sich offenbar „Europens übertünchter Höflichkeit" gegenüber
noch nicht ganz behaglich.
LhaUemel-LlMuu', der neue französische Senats-
Mkdent.
(Siche das Porträt auf Seite 5tt-l.)
/gleich hervorragend als Politiker und als Schriftsteller,
vN zählt Challemcl-Lacour, der an Stelle Jules Ferry's
(vergl. Heft 22) getretene neue französische Senatspräsident
und zugleich das jüngst erwählte Mitglied der Pariser „vierzig
Unsterblichen", zu den wichtigsten Persönlichkeiten seines Vater-
landes. Ein kurzer Abriß seines bisherigen Lebens und
Wirkens dürfte daher für unsere Leser wohl von Interesse
sein. — Paul Armand Challemel-Lacour (siehe das Porträt
auf S. 564) stammt aus der Normandie, ivo er am 1!). Mai
1827 zu Avranches geboren wurde. Er wurde im Lycse
St. LouiS und in der Normalschule zu Paris gebildet und
widmete sich dem höheren Lehrerberufe, bis er wegen seiner
freiheitlichen und entschieden republikanischen Ansichten nach
dem Staatsstreiche eingckerkert und nach mehrmonatlicher Haft
aus Frankreich ausgewiesen wurde. Er ging zunächst nach
Belgien, dann nach Deutschland und Italien, bis er sich
1856 in Zürich niederließ, wo er am eidgenössischen Poly-
technikum französische Literatur lehrte. 1859 kehrte er nach
der großen Amnestie heim, wirkte als Mitarbeiter hervor-
ragender Zeitungen und Revuen und veröffentlichte verschiedene
wissenschaftliche Werke, darunter auch eines über Wilhelm
v. Humboldt, die seinen Namen bald sehr vortheilhaft bekannt
machten. Die Umwälzung der Dinge, die der deutsch-fran-
zösische Krieg herbeiführte, ließ Challemel-Lacour auch in poli
tischer Beziehung in den Vordergrund treten. Gambetta, der
große Stücke auf ihn hielt, ernannte ihn zum Präfekten
in Lyon. Nach dem Kriege wurde er 1872 in die National-
versammlung und 1876 in den Senat gewählt. 1879 er-
nannte man ihn zum Botschafter bei der Schweizer Eidgenossen
schäft und ein Jahr daräuf in London, bis er 1882 abberufen
wurde, um im Ministerium Ferry das Portefeuille des Aus
wärtigen zu übernehmen. Unter ihm entstand aus der Tonkin
Frage der Konflikt mit China, aber im November bereits legte
Challemel-Lacour sein Amt wieder nieder, weil er mit dcr
versöhnlichen Haltung, die Ferry Deutschland gegenüber an-
nahm, nicht einverstanden war. Am 19. Dezember 1888
hielt er im Senat eine großes Aufsehen erregende Rede gegen
den Radikalismus, in der er eine zwar reformfreundliche, aber-
gemäßigte Politik empfahl. 1891 wurde er zum Vicepräsidenten
des Senats gewählt, um nun neuerdings — am 27. März
1898 — zum Präsidenten zu avancireu. Während er ehemals
für einen Jakobiner galt, ist Challemel-Lacour gegenwärtig
längst ein gemäßigter Politiker geworden, der im klebrigen
auch in seiner neuen Amtswohnung im Luxembourgpalaste
wohl das stille Gelehrtendasein weiterführen wird, dem er sich
seit seinem Rücktritte vom Ministerposten hingegeben hatte.
Erbgroßherzog Wilhelm von Lurembnrg und leine
Lrant, Prinzessin Marin Anna von Sraganza.
(Siehe die 2 Porträts auf Seite 564.)
^sm 2. März 1893 hat im engsten Familienkreise im Palais
des Herzogs Karl Theodor in Bayern zu München die
Verlobung des Erbgroßherzogs von Luxemburg mit der Pria
zessin Maria Anna von Braganza (siehe die beiden Porträts
auf S. 564) stattgefunden. — Erbgroßherzog Wilhelm von
Luxemburg ist am 22. April 1853 zu Biebrich geboren als
der einzige Sohn des ehemaligen Herzogs Adolf von Nassau,
jetzigen Großherzogs von Luxemburg, auS dessen zweiter Ehe
mit der Herzogin Adelheid von Anhalt. Auf ihm ruht der
Mannesstamm des herzoglichen Hauses und der Dynastie des
Großherzogthums Luxemburg, und deshalb ist die Nachricht
von seiner Verlobung mit großer Befriedigung in Luxemburg
ausgenommen worden, wo man recht gut weiß, daß die Fort
dauer der staatlichen Selbstständigkeit des Ländchens mit dem
Fortbestände der Dynastie Nassau innig verknüpft ist. In der
österreichisch-ungarischen Armee, der er als Titular-General-
major angehört, wird dem Erbgroßherzog militärische Tüchtig-
keit nachgerühmt; seit der Berufung seines Vaters zur Thron-
folge in Luxemburg ist er beurlaubt. Mit besonderer Vor-
liebe pflegte er stets, gleich seinem Vater, den Renn- und
Fahrsport, und ebenso thcilt er mit seinem Vater auch die
Neigung und das Verständnis! für die Malerei. — Seine
Braut, Prinzessin Marin Anna von Braganza, trägt zwar
einen romanischen Namen, ist aber von einer deutschen Mutter
in Deutschland geboren und hier aufgezogen worden. Sie ist
geboren am 13. Juli 1861 als Tochter des 1866 verstorbenen
Exkönigs von Portugal, Dom Miguel von Braganza, mit der
Prinzessin Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
Dieser Verbindung sind außerdem noch ein Sohn, Prinz
Miguel, und fünf Töchter entsprossen. Die älteste Schwester
der zukünftigen Erbgroßherzogin von Luxemburg, Maria
de las Neves, ist mit dem Prinzen Alfons von Bourbon, dem
Bruder des spanischen Thronprätendenten Don Carlos, ver-
mählt. Die zweite Schwester ist die Erzherzogin Maria Theresia,
Gemahlin dos Erzherzogs Karl Ludwig, Bruders-des Kaisers
Franz Joseph; die dritte die Herzogin Maria Josepha in
Bayern, Gemahlin des Herzogs Karl Theodor, mit dein sie in
Werken edelster Menschenfreundlichkeit wetteifert. Dann folgt
die Prinzessin Adelgunde von Bourbon, Gräfin von Bari,
hierauf die Prinzessin Maria Anna selbst, und die jüngste der
sechs Schwestern ist dis Prinzessin Maria -Antonic von Bourbon,
Herzogin von Parma, die Stiefmutter der mit dem Fürsten
Ferdinand von Bulgarien verlobten Prinzessin Maria Luise
von Bourbon (siehe Heft 20).
Maifeier in früherer Zeit.
(Siehe Bild auf Seite 565.)
/Obgleich sich mancherlei Ueberreste der Maiseste, die unsere
Vorfahren begingen, noch hier und da in Deutschland
finden, hat doch die schöne, volksthümliche Sitte einer all-
gemeinen Maifeier aufgehört. In früherer Zeit aber gehörten
die noch aus dem germanischen Alterthum stammenden Mai
feste mit ihren sinnigen Bräuchen zu den beliebtesten und
höchsten Festzeitcn des Volkes. Denn in der Maifeier hatte
sich am reinsten die Erinnerung an die alten Naturgötter uud
ihren Kultus erhalten, und die symbolischen Bräuche der Mai
feier stellen den Sieg deS jungen Sonnengottes Froh odcr
Freyr über die Wintermächtc und seinen Einzug in dis Lande
dar. In der Nacht zum 1. Mai — der Walpurgisnacht —
erwachten die lebendigen Kräfte der -Natur, und die alten Licht
götter, die später zu Hexen und Zauberern wurden, zogen
segcnspendend über die Gefilde. Damit war des Winters
Macht endgiltig gebrochen, und die schöne Frühlingszeit begann
eigentlich erst jetzt. Das Leben hatte wieder über die
Mächte des Todes gesiegt, und Freude und Jubel herrschte
daher überall. Man errichtete den geschmückten Maibaum auf
deni Dorfplatze, schmückte die Thüren und Fenster der Hauser
init frischem Grün, bunten Blumen und Blüthenzweigen (siehe
unser Bild auf S. 565), gleichsam dem einziehenden Frühling
zu Ehren, und trieb allerlei Spiel und Kurzweil. Dabei fanden
sich schon jetzt die jungen Paare zusammen, die bei dem großen
Maifest, an dessen Stelle jetzt Pfingsten getreten ist, von dem
gewählten Maikönig und seinen Maigrafen nach alter Sitte
zusammengesprochen wurden. Auch bei dem jungen Paare
auf unserem Bilde, das gemeinsam mit dem Schmücken der
HauSthür zur Maifeier beschäftigt ist, scheint sich etwas an-
bandeln zu wollen, denn nach den Mienen der Beiden zu schließen,
sind sie in einer höchst interessanten und anregenden Unter-
haltung begriffen, die keineswegs die gemeinsame Aufgabe
allein betreffen kann. Vielmehr scheint es, als hätte der junge
Mann eben lächelnd eine verfängliche Frage gestellt, zu der
ihm die Maifreiheit den Muth gegeben, und als wüßte das
hübsche Mädchen noch nicht recht, waS sie darauf antworten
solle. Freilich, heut ist's ja auch noch zu früh; erst die große
Maifeier pflegte an den Tag zu bringen, was die ueuerwachte
Natur auch in den Herzen der Jugend für Keime zum Treiben
gebracht hatte.
Handlnngsreisende.
Ein Md aus dem modernen Geschäftsieben.
Von
Eugen Schmitt.
(Nachdruck verboten.)
45,000 Geschäftsreisende sind allein
Deutschland beständig unterwegs; da man
sachverständiger.Leite berechnet hat, daß
Jeder von ihnen durchschnittlich im Tage
14 Mark verbraucht, so ergibt dies eine täg-
liche Ausgabe von 600,000 Mark, eine auch
l in volkswirthschaftlicher Beziehung bedeutende
Ziffer, deren Höhe für viele Leser etwas UeberraschendeS
haben wird. Die große Anzahl von Geschäftsreisenden
ist außerdem ein Beweis dafür, welche Bedeutung diese
Art von Leuten für den modernen Handel besitzt. Es
dürfte sich daher verlohnen, uns mit ihnen einmal etwas
näher zu beschäftigen.
Geschäftsreisende hat es schon im grauen Alterthum
gegeben, wenn auch unter anderen Verhältnissen wie
jetzt. Kühne Kaufleute unternahmen schon damals weite
Reisen, deren Großartigkeit wir nach heute bewundern
müssen. Sage und Geschichte berichten uns von den
Handelsreisen der Phönizier von der Ostküste Klein-
asiens bis nach dem Bernsteinlande, dem heutigen Ost-
preußen; die Argonautenfahrt und die Sage von: gol-
denen Vließ beziehen sich jedenfalls auf große Hand-
lungSreisen, die von griechischen Kaufleuten, die damals
auch zugleich Krieger sein mußten, unternommen wurden,
und römische Händler fand man im alten Germanien
schon vor Beginn unserer Zeitrechnung. Orientalische
Heft 23.
Händler, Perser und Türken, zogen im 9. Jahr-
hundert als reisende Kaufleute in Deutschland umher.
Umgekehrt girrgen im Mittelalter die Vertreter der
großen Augsburger und Nürnberger Kaufhäuser aus dem
Land- und Wasserwege nach Indien, China und später
nach Amerika.
Diese reisenden Kaufleute führten gleich ihre Waaren
mit sich und kehrten nach ihrer Heimath zurück, nach-
dem sie sich mit Waaren aus dem Lande versehen
hatten, in dem sie ihre heimischen Vorräthe losgeworden
waren. Der heutige Geschäftsreisende geht meist nur
noch mit den Mustern der Firma versehen auf die
Tour, in manchen Gegenden aber führt auch heute noch
der Geschäftsreisende ein ganzes Waarenlager mit sich,
damit er sofort Bestellungen auf Muster, die besonders
gefallen, gegen bare Bezahlung erledigen kann. So
halten deutsche Häuser Geschäftsreisende mit größeren
oder kleineren Waarenlagern im ganzen Orient, in Un-
garn, auch auf der Balkanhalbinsel, in der Türkei, ja
selbst in Persien. In Amerika gibt man den Geschäfts-
reisenden ebenfalls Waarenlager mit, weil dort die Be-
stellungen sich wegen der weiten Entfernungen oft erst
nach langer Zeit erledigen ließen. Zu diesem Zwecke
richten die Firmen in den östlichen Hauptstädten ganze
Eisenbahnwagen als Musterlager ein, welche gleich-
zeitig als Wohnung und Laden für den Beauftragten
des Geschäfts dienen. Der Eisenbahnwagen wird an
einen Zug gehängt und viele hundert Meilen in das
Land hineingefahren, dann wird er auf einer ein-
sam gelegenen Station abgehängt und auf ein todtes
Geleise geschoben. Der Geschäftsreisende besorgt sich
dann einen Wagen oder ein Pferd, durchstreift die Um-
gegend und fordert die Farmer, Krämer, Viehhirten,
Goldgräber u. s. w. auf, nach der Station zu kommen
und sich aus seinem Waarenlager mit Vorräthen zu
versehen. Ist das Geschäft beendet, so läßt er den
Wagen wieder an einen Zug anhängen und geht wcitcr
in das Land hinein, bis sein Vorrath erschöpft ist.
Diese Art der Geschäftsreisenden aber, welche die
Waaren mit sich führen, ist eine verschwindend kleine
gegenüber der großen Zahl von Reisenden, die nur
Offerten im Auftrage ihrer Firmen machen, die Mustcr
vorlegen und daraufhin Bestellungen annehmen oder
das Geld für frühere Lieferungen einkassiren. Vor der
Zeit der Eisenbahnen machten sie ihre Touren durch
das Land zu Pferde oder im Wagen. Wer nicht zu
viel Muster hatte, der brachte dieselben in den Pack
taschen unter, die auf dem Sattel des Pferdes befestigt
waren; in den Halftern des Sattels steckten die wohl-
geladenen Pistolen, denn die Landstraßen waren vor
zweihundert Jahren in Deutschland noch unsicher, und
der „Musterreiter", ivie man den Handlungsreisenden
nannte, trabte von Ort zu Ort und kehrte erst nach
vielmonatlicher Thätigkeit nach Hause zurück. Bis heute
hat sich aus jener Zeit der Name „Musterreiter" er-
halten, allerdings wird er jetzt in einem wenig schmeichel-
haften Sinne angewendet. Viele dieser früheren Muster
reiter wurden Opfer ihres Berufes; sie wurden in den
Wäldern überfallen, in unsicheren Herbergen erschlagen
und beraubt, und in den alten Schauerromanen des
vorigen Jahrhunderts spielt der ermordete und beraubte
Handlungsreisende eine nicht unbedeutende Rolle.
Als die Wege besser wurden, gaben die Reisenden
das Reiten auf und bedienten sich der Wagen. Sie
kutschirten gewöhnlich selbst, und Pferd und Wagen
gehörten dem kaufmännischen Hause, das sie vertraten.
Das Geführt war so eingerichtet, daß es die Muster-
koffer, das Gepäck des Reisenden und auch den unum-
gänglich nothwendigen Proviant aufnehmen konnte.
Eine Plane schützte die Ladung und auch den Reisenden
vor Regen. Natürlich fehlte auch die Bewaffnung nicht,
denn wenn die Reisenden einkassirten, führten sie oft
große Geldsummen in baren: oder, wie man sagte, in
hartem Gelde mit sich. Mancher von ihnen war von
einem oder zwei großen Hunden begleitet. Einzelne hatten
eigene Kutscher, ja Geschäftsinhaber, die etwas Be-
sonderes vorstellen wollten, gaben ihren Reisenden nicht
nur einen Kutscher, sondern auch noch einen Diener in
Livree mit, damit ihr Vertreter möglichst imponirend
in der Fremde auftreten konnte.
Heute ist das Alles anders geworden. Nur in
Gegenden, die weitab von den großen Verkehrslinien
liegen, benutzt der Geschäftsreisende noch das Gespann,
das er sich miethet; gewöhnlich kann er mit der Eisen-
bahn von Ort zu Ort fahren, und höchstens bringt ihn
einmal eine Droschke nach einen: abseits von der Eisen-
bahn gelegene,: Oertchen. Auch heute noch ist aber
die Thätigkeit der Reisenden von großer Wichtigkeit für
unsere Industrie und unseren Handel.
Tüchtig müssen diese Reisenden sein ; es werden an
sie Anforderungen mannigfacher Art gestellt, und das
Reisen, ivie es heute ausgeübt wird, ist sehr anstrengend,
selbst wenn der Reisende im Inlands bleibt. Geht er
nach dem Auslande, dann hat er noch mit besonderen
Schwierigkeiten zu kämpfen, und weltmännische Ge-
wandtheit, Sprachkenntniß, große geschäftliche Erfahrung,
Klugheit, Geistesgegenwart, Fleiß und Unermüdlichkeit
sind notwendig, soll der Geschäftsreisende Erfolge er-