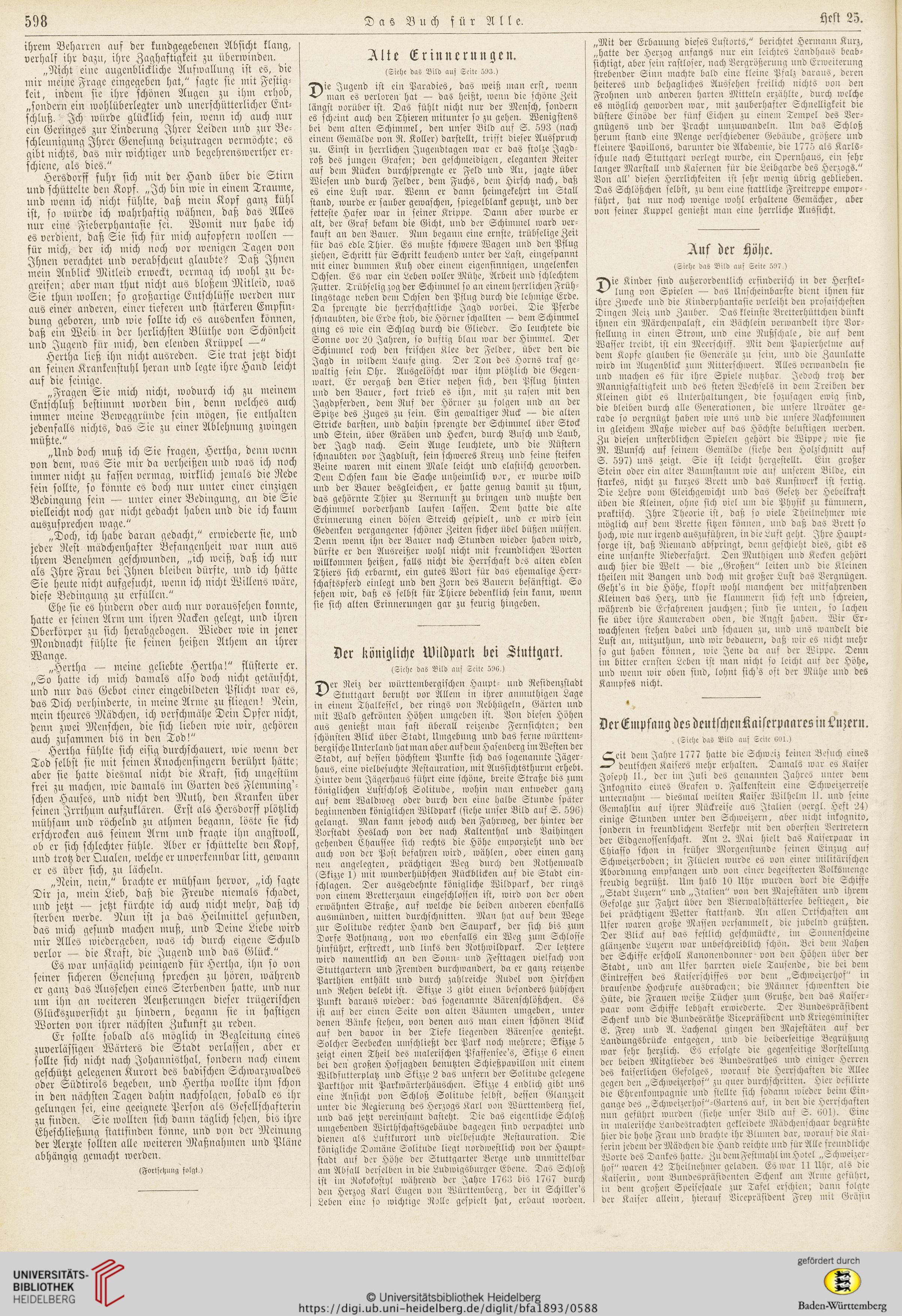598
Das Buch für Alle.
Lfelt 2ö.
ihrem Beharren auf der kundgeqebenen Absicht klang,
verhalf ihr dazu, ihre Zaghaftigkeit zu überwinden.
„Nicht eine augenblickliche Aufwallung ist cs, die
mir meine Frage eingegeben hat," sagte sie mit Festig-
keit, indem sie ihre schönen Augen zu ihm erhob,
„sondern ein wohlüberlegter und unerschütterlicher Ent-
schluß. Ich würde glücklich sein, wenn ich auch nur
ein Geringes zur Linderung Ihrer Leiden und zur Be-
schleunigung Ihrer Genesung beizutragen vermöchte; eS
gibt nichts, das mir wichtiger und bcgehrenSwerther er-
schiene, als dies."
Hersdorff fuhr sich mit der Hand über die Stirn
und schüttelte den Kopf. „Ich bin wie in einein Traume,
und wenn ich nicht fühlte, daß mein Kopf ganz kühl
ist, so würde ich wahrhaftig wähnen, daß das Alles
nur eine Fieberphantnsie sei. Womit nur habe ich
es verdient, daß Sie sich für mich aufopfern wollen —
für mich, der ich mich noch vor wenigen Tagen von
Ihnen verachtet und verabscheut glaubte? Daß Ihnen
mein Anblick Mitleid erweckt, vermag ich wohl zu be-
greifen; aber man thut nicht aus bloßem Mitleid, was
Sie thun wollen; so großartige Entschlüsse werden nur
aus einer anderen, einer tieferen und stärkeren Empfin-
dung geboren, und wie sollte ich cs ausdenken können,
daß ein Weib in der herlichsten Blüthe von Schönheit
und Jugend für mich, den elenden Krüppel —"
Hertha ließ ihn nicht ausreden. Sie trat jetzt dicht
an seinen Krankenstuhl heran und legte ihre Hand leicht
auf die seinige.
„Fragen Sie mich nicht, wodurch ich zu meinem
Entschluß bestimmt worden bin, denn welches auch
immer meine Beweggründe sein mögen, sie enthalten
jedenfalls nichts, das Sic zu einer Ablehnung zwingen
müßte."
„Und doch muß ich Sie fragen, Hertha, denn wenn
von dem, was Sie mir da verheißen und was ich noch
immer nicht zu fassen vermag, wirklich jemals die Rede
sein sollte, so könnte es doch nur unter einer einzigen
Bedingung sein — unter einer Bedingung, an die Sie
vielleicht noch gar nicht gedacht haben und die ich kaum
auszusprechen wage."
„Doch, ich habe daran gedacht," erwiederte sie, und
jeder Rest mädchenhafter Befangenheit war nun aus
ihrem Benehmen geschwunden, „ich weiß, daß ich nur
als Ihre Frau bei Ihnen bleiben dürfte, und ich hätte
Sie heute nicht aufgesucht, wenn ich nicht Willens wäre,
diese Bedingung zu erfüllen."
Ehe sie es hindern oder auch nur voraussehen konnte,
hatte er seinen Arm um ihren Nacken gelegt, und ihren
Oberkörper zu sich herabgebogcn. Wieder wie in jener
Mondnacht fühlte sie seinen heißen Athen: an ihrer
Wange.
„Hertha — meine geliebte Hertha!" flüsterte er.
„So hatte ich mich damals also doch nicht getäuscht,
und nur das Gebot einer eingebildeten Pflicht war es,
das Dich verhinderte, in meine Arme zu fliegen! Nein,
mein thcures Mädchen, ich verschmähe Dein Opfer nicht,
denn zwei Menschen, die sich lieben wie wir, gehören
auch zusammen bis in den Tod!"
Hertha fühlte sich eisig durchschauert, wie wenn der
Tod selbst sie mit seinen Knochenfingern berührt hätte;
aber sie hatte diesmal nicht die Kraft, sich ungestüm
frei zu machen, wie damals im Garten des Flemming'-
schen Hauses, und nicht den Muth, den Kranken über
seinen Jrrthum aufzuklären. Erst als Hersdorff plötzlich
mühsam und röchelnd zu athmen begann, löste sie sich
erschrocken aus seinem Arm und fragte ihn angstvoll,
ob er sich schlechter fühle. Aber er schüttelte den Kopf,
und trotz der Qualen, welche er unverkennbar litt, gewann
er es über sich, zu lächeln.
„Nein, nein," brachte er mühsam hervor, „ich sagte
Dir ja, mein Lieb, daß die Freude niemals schadet,
und jetzt — jetzt fürchte ich auch nicht mehr, daß ich
sterben werde. Nun ist ja das Heilmittel gefunden,
das mich gesund machen muß, und Deine Liebe wird
mir Alles wiedcrgeben, was ich durch eigene Schuld
verlor — die Kraft, die Jugend und das Glück."
Es war unsäglich peinigend für Hertha, ihn so von
seiner sicheren Genesung sprechen zu hören, während
er ganz das Aussehen eines Sterbenden hatte, und nur
um ihn an weiteren Aeußerungen dieser trügerischen
Glückszuversicht zu hindern, begann sie in hastigen
Worten von ihrer nächsten Zukunft zu reden.
Er sollte sobald als möglich in Begleitung eines
zuverlässigen Wärters die Stadt verlassen, aber er
sollte sich nicht nach Johannisthal, sondern nach einem
geschützt gelegenen Kurort des badischen Schwarzwaldes
oder Südtirols begeben, und Hertha wollte ihm schon
in den nächsten Tagen dahin nachfolgen, sobald eS ihr
gelungen sei, eine geeignete Person als Gesellschafterin
zu finden. Sie wollten sich dann täglich sehen, bis ihre
Eheschließung stattsinden könne, und von der Meinung
der Aerzte sollten alle weiteren Maßnahmen und Pläne
abhängig gemacht werden.
(Forlsctzung solgt.)
ÄIte Erinnerungen.
(Siehe das Bild auf Seite 593.)
7>ie Jugend ist ein Paradies, das weiß man erst, wenn
man es verloren hat — das heißt, wenn die schöne Zeit
längst vorüber ist. Das fühlt nicht nur der Mensch, sondern
es scheint auch den Thieren mitunter so zu gehen. Wenigstens
bei dem alten Schimmel, den unser Bild auf S. 593 (nach
einem Gemälde von R. Koller) darstellt, trifft dieser Ausspruch
zu. Einst in herrlichen Jugendtagen war er das stolze Jagd-
roß des jungen Grafen; den geschmeidigen, eleganten Reiter
auf dem Rücken durchsprengte er Feld und Au, jagte über
Wiesen und durch Felder, dem Fuchs, dem Hirsch nach, daß
es eine Lust war. Wenn er dann heimgekehrt im Stall
stand, wurde er sauber gewaschen, spiegelblank geputzt, und der
fetteste Hafer war in seiner Krippe. Dann aber wurde er
alt, der Graf bekam die Gicht, und der Schimmel ward ver-
kauft an den Bauer. Nun begann eine ernste, trübselige Zeit
für das edle Thier. Es mußte schwere Wagen und den Pflug
ziehen, Schritt für Schritt keuchend unter der Last, eingespannt
mit einer dummen Kuh oder einem eigensinnigen, ungelenken
Ochsen. Es war ein Leben voller Blühe, Arbeit und schlechtem
Futter. Trübselig zog der Schimmel so an einem herrlichen Früh-
lingstage neben dem Ochsen den Pflug durch die lehmige Erde.
Da sprengte die herrschaftliche Jagd vorbei. Die Pferde
schnaubten, die Erde stob, die Horner schallten — dem Schimmel
ging es wie ein Schlag durch die Glieder. So leuchtete die
Sonne vor 20 Jahren, so duftig blau war dec Himmel. Der
Schimmel roch den frischen Klee der Felder, über den die
Jagd in wildem Laufe ging. Der Ton des Horns traf ge-
waltig sein Ohr. Ausgelöscht war ihm plötzlich die Gegen-
wart. Er vergaß den Stier neben sich, den Pflug hinten
und den Bauer, fort trieb es ihn, mit zu rasen mit den
Jagdpferden, dein Rus der Hörner zu folgen und an der
Spitze des Zuges zu sein. Ein gewaltiger Ruck — die alten
Stricke barsten, und dahin sprengte der Schimmel über Stock
und Stein, über Gräben und Hecken, durch Busch und Laub,
der Jagd nach. Sein Auge leuchtete, und die Nüstern
schnaubten vor Jagdlust, sein schweres Kreuz und seine steifen
Beine waren mit einem Male leicht und elastisch geworden.
Dem Ochsen kam die Sache unheimlich vor, er wurde wild
und der Bauer desgleichen, er hatte genug damit zu thun,
das gehörnte Thier zu Vernunft zu bringen und mußte den
Schimmel vorderhand laufen lassen. Dem hatte die alte
Erinnerung einen bösen Streich gespielt, und er wird sein
Gedenken vergangener schöner Zeiten sicher übel büßen müssen.
Denn wenn ihn der Bauer nach Stunden wieder haben wird,
dürfte er den Ausreißer wohl nicht mit freundlichen Worten
willkommen heißen, falls nicht die Herrschaft des alten edlen
Thiers sich erbarmt, ein gutes Wort für das ehemalige Herr-
schaftspferd einlegt und den Zorn des Bauern besänftigt. So
sehen wir, daß es selbst für Thiere bedenklich sein kann, wenn
sie sich alten Erinnerungen gar zu feurig hingeben.
Der königliche Wildpark bei Stuttgart.
(Siche das Bild aas Sciic S!>6.)
7>sr Reiz der württembergischen Haupt- und Residenzstadt
Stuttgart beruht vor Allem in ihrer anmuthigen Lage
in einem Thalkessel, der rings voll Rebhügeln, Gärten und
mit Wald gekrönten Höhen umgeben ist. Voll diesen Höhen
aus genießt man fast überall reizende Fernsichten; den
schönsten Blick über Stadt, Umgebung und das ferne württem-
bergische Unterland hat man aber auf dem Hasenberg im Westen der
Stadt, auf dessen höchstem Punkte sich das sogenannte Jäger-
haus, eine vielbesuchte Restauration, mit Aussichtsthurm erhebt.
Hinter dem Jägerhaus führt eine schöne, breite Straße bis zum
königlichen Lustschloß Solitude, wohin man entweder ganz
auf dem Waldweg oder durch den eine halbe Stunde später
beginnenden königlichen Wildpark (siehe unser Bild auf S. 596)
gelangt. Man kann jedoch auch den Fahrweg, der hinter der
Vorstadt Heslach von der nach Kaltenthal und Vaihingen
gehenden Chaussee sich rechts die Höhe emporzieht und der
auch von der Post befahren wird, wählen, oder einen ganz
neu angelegten, prächtigen Weg durch den Rothenwald
(Skizze 1) mit wunderhübschen Rückblicken auf die Stadt ein-
schlagen. Der ausgedehnte königliche Wildpark, der rings
von einem Bretterzaun eingeschlossen ist, wird von der oben
erwähnten Straße, auf welche die beiden anderen ebenfalls
nusmünden, mitten durchschnitten. Man hat auf dem Wege
zur Solitude rechter Hand den Saupark, der sich bis zum
Dorfs Bothnang, von wo ebenfalls ein Weg zum Schlosse
hinführt, erstreckt, und links den Rothwildpark. Der letztere
wird namentlich an den Sonn- und Festtagen vielfach von
Stuttgartern und Fremden durchwandert, da er ganz reizende
Parthicn enthält und durch zahlreiche Rudel von Hirschen
und Rehen belebt ist. Skizze 3 gibt einen besonders hübschen
Punkt daraus wieder' das sogenannte Bärenschlößchen. Es
ist auf der einen Seite von alten Bäumen umgeben, unter
denen Bänke stehen, von denen aus man einen schönen Blick
auf den davor in der Tiefe liegenden Bärensee genießt.
Solcher Seebecken umschließt der Park noch mehrere; Skizze 5
zeigt einen Theil des malerischen Pfasfensee's, Skizze 6 einen
bei den großen Hofjagden benutzten Schießpavillon mit einem
Wildfutterplatz und Skizze 2 das unfern der Solitude gelegene
Parkthor mit Parkwärterhäuschen. Skizze 4 endlich gibt uns
eine Ansicht von Schloß Solitude selbst, dessen Glanzzeit
unter die Regierung des Herzogs Karl von Württemberg fiel,
und das jetzt vereinsamt dasteht. Die das eigentliche Schloß
umgebenden WirthschaftSgebäude dagegen sind verpachtet und
dienen als Luftkurort und vielbesuchte Restauration. Die
königliche Domäne Solitude liegt nordwestlich von der Haupt-
stadt auf der Höhe der Stuttgarter Berge und unmittelbar
am Abfall derselben in die Ludwigsburger Ebene. Das Schloß
ist im Rokokostyl während der Jahre 1763 bis 1767 durch
den Herzog Karl Eugen von Württemberg, der in Schiller's
Leben eine so wichtige Rolle gespielt hat, erbaut worden.
„Mit der Erbauung dieses Lustorts," berichtet Hermann Kurz,
„hatte der Herzog anfangs nur ein leichtes Landhaus beab-
sichtigt, aber sein rastloser, nach Vergrößerung und Erweiterung
strebender Sinn machte bald eine kleine Pfalz daraus, deren
heiteres und behagliches Aussehen freilich nichts von den
Frohnen und anderen harten Mitteln erzählte, durch welche
es möglich geworden war, mit zauberhafter Schnelligkeit die
düstere Einöde der fünf Eichen zu einem Tempel des Ver-
gnügens und der Pracht umzuwandeln. Um das Schloß
herum stand eine Menge verschiedener Gebäude, größere und
! kleinere Pavillons, darunter dis Akademie, die 1775 als Karls-
schule nach Stuttgart verlegt wurde, ein Opernhaus, ein sehr
janger Marstall und Kasernen für die Leibgarde des Herzogs."
Von all' diesen Herrlichkeiten ist sehr wenig übrig geblieben.
Das Schlößchen selbst, zu dem eins stattliche Freitreppe empor-
führt, hat nur noch wenige wohl erhaltene Gemächer, aber
von seiner Kuppel genießt man eine herrliche Aussicht.
Änf der Höhe.
(Siehe das Bild auf Seite 597.)
?>ie Kinder sind außerordentlich erfinderisch in der Herstel-
lang von Spielen — das Unscheinbarste dient ihnen für
ihre Zwecke und die Kinderphantasie verleiht den prosaischesten
Dingen Reiz und Zauber. Das kleinste Bretterhüttchen dünkt
ihnen ein Märchenpalast, ein Bächlein verwandelt ihre Vor-
stellung in einen Strom, und eine Nußschale, die auf dem
Wasser treibt, ist ein Meerschisf. Mit dem Papierhelme auf
dem Kopfe glauben sie Generäle zu sein, und die Zaunlatte
wird im Augenblick zum Ritterschwert. Alles verwandeln sie
und machen es für ihre Spiele nutzbar. Jedoch trotz der
Mannigfaltigkeit und des steten Wechsels in dem Treiben der
Kleinen gibt es Unterhaltungen, dis sozusagen ewig sind,
die bleiben durch alle Generationen, die unsere Urväter ge-
rade so vergnügt haben wie uns und die unsere Nachkommen
in gleichem Maße wieder auf das Höchste belustigen werden.
Zu diesen unsterblichen Spielen gehört die Wippe, wie sie
M. Wunsch auf seinem Gemälde (siehe den Holzschnitt auf
S. 597) uns zeigt. Sie ist leicht hcrgestellt. Ein großer
Stein oder ein alter Baumstamm wie auf unserem Bilde, ein
starkes, nicht zu kurzes Brett und das Kunstwerk ist fertig.
Die Lehre vom Gleichgewicht und das Gesetz der Hebelkraft
üben die Kleinen, ohne sich viel um die Physik zu kümmern,
praktisch. Ihre Theorie ist, daß so viele Theilnehmer wie
möglich auf dein Brette sitzen können, und daß das Brett so
hoch, ivie nur irgend auszuführen, in die Luft geht. Ihre Haupt-
sorge ist, daß Niemand abspringt, denn geschieht dies, gibt es
eine unsanfte Niederfahrt. Den Muthigen und Kecken gehört
auch hier die Welt — die „Großen" leiten und die Kleinen
theilen mit Bangen und doch mit großer Lust das Vergnügen.
Geht's in die Höhe, klopft wohl manchem der mitfahrenden
Kleinen das Herz, und sie klammern sich fest und schreien,
während die Erfahrenen jauchzen; sind sie unten, so lachen
sie über ihre Kameraden oben, die Angst haben. Wir Er-
wachsenen stehen dabei und schauen zu, und uns wandelt die
Lust an, mitzuthun, und wir bedauern, daß wir es nicht mehr
so gut haben können, wie Jene da auf der Wippe. Denn
im bitter ernsten Leben ist man nicht so leicht auf der Höhe,
und wenn wir oben sind, lohnt sich's oft der Mühe und des
Kampfes nicht.
DerEmpflkiig des deutschenKinserpmu-es in Ln;ern.
. (Siche das Bild aus Sciic 001.)
c" eit dem Jahre 1777 hatte die Schweiz keinen Besuch eines
deutschen Kaisers mehr erhalten. Damals war es Kaiser
Joseph II., der im Juli des genannten Jahres unter dem
Inkognito eines Grafen v. Falkenstein eine Schweizerreise
unternahm — diesmal weilten Kaiser Wilhelm 11. und seins
Gemahlin auf ihrer Rückreise aus Italien (vergl. Heft 24)
einige Stunden unter den Schweizern, aber nicht inkognito,
sondern in freundlichem Verkehr mit den obersten Vertretern
der Eidgenossenschaft. Am 2. Mai hielt das Kaiserpaar in
Chiasso schon in früher Morgenstunde seinen Einzug auf
Schweizerboden; in Mieten wurde es von einer militärischen
Abordnung empfangen und von einer begeisterten Volksmenge
freudig begrüßt. Um halb 10 Uhr wurden dort die Schiffe
„Stadt Luzern" und „Italien" von den Majestäten und ihrem
Gefolge zur Fahrt über den Vierwaldstättersee bestiegen, die
bei prächtigem Wetter stattfand. An allen Ortschaften am
Ufer waren große Massen versammelt, die jubelnd grüßten.
Der Blick auf das festlich geschmückte, im Sonnenscheine
glänzende Luzern war unbeschreiblich schön. Bei dem Nahen
der Schiffe erscholl Kanonendonner von den Höhen über der
Stadt, und am Ufer harrten viele Tausende, die bei dem
Eintreffen des Kaiscrschiffes vor dem „Schweizerhof" in
brausende Hochrufe ausbrachen; die Männer schwenkten die
Hüte, die Frauen weiße Tücher zum Gruße, den das Kaiser-
paar vom Schiffe lebhaft erwiederte. Der Bundespräsident
Schenk und die Bundesräthe Vicepräsident und Kriegsminister
E. Frey und A. Lachenal gingen den Majestäten auf der
Landungsbrücke entgegen, und die beiderseitige Begrüßung
war sehr herzlich. Es erfolgte die gegenseitige Vorstellung
der beiden Mitglieder des Bundesrathes und einiger Herren
des kaiserlichen Gefolges, worauf die Herrschaften die Allee
gegen den „Schweizerhof" zu quer durchschritten. Hier defilirte
die Ehrenkompagnie und stellte sich sodann wieder beim Ein-
gangs des „Schweizerhof"-Gartens auf, in den die Herrschaften
nun geführt wurden (siehe unser Bild auf S. 601). Eine
in malerische Landestrachten gekleidete Mädchenschaar begrüßte
hier die hohe Frau und brachte ihr Blumen dar, worauf die Kai-
serin jedem der Mädchen die Hand reichte und für Alle freundliche
Worte des Dankes hatte. Zu demFestmahl im Hotel „Schweizer-
hof" waren 42 Theilnehmer geladen. Es war 11 Uhr, als die
Kaiserin, vom Bundespräsidenten Schenk am Arme geführt,
in dem großen Speisesaale zur Tafel erschien; dann folgte
der Kaiser allein, hierauf Vicepräsident Frey mit Gräfin
Das Buch für Alle.
Lfelt 2ö.
ihrem Beharren auf der kundgeqebenen Absicht klang,
verhalf ihr dazu, ihre Zaghaftigkeit zu überwinden.
„Nicht eine augenblickliche Aufwallung ist cs, die
mir meine Frage eingegeben hat," sagte sie mit Festig-
keit, indem sie ihre schönen Augen zu ihm erhob,
„sondern ein wohlüberlegter und unerschütterlicher Ent-
schluß. Ich würde glücklich sein, wenn ich auch nur
ein Geringes zur Linderung Ihrer Leiden und zur Be-
schleunigung Ihrer Genesung beizutragen vermöchte; eS
gibt nichts, das mir wichtiger und bcgehrenSwerther er-
schiene, als dies."
Hersdorff fuhr sich mit der Hand über die Stirn
und schüttelte den Kopf. „Ich bin wie in einein Traume,
und wenn ich nicht fühlte, daß mein Kopf ganz kühl
ist, so würde ich wahrhaftig wähnen, daß das Alles
nur eine Fieberphantnsie sei. Womit nur habe ich
es verdient, daß Sie sich für mich aufopfern wollen —
für mich, der ich mich noch vor wenigen Tagen von
Ihnen verachtet und verabscheut glaubte? Daß Ihnen
mein Anblick Mitleid erweckt, vermag ich wohl zu be-
greifen; aber man thut nicht aus bloßem Mitleid, was
Sie thun wollen; so großartige Entschlüsse werden nur
aus einer anderen, einer tieferen und stärkeren Empfin-
dung geboren, und wie sollte ich cs ausdenken können,
daß ein Weib in der herlichsten Blüthe von Schönheit
und Jugend für mich, den elenden Krüppel —"
Hertha ließ ihn nicht ausreden. Sie trat jetzt dicht
an seinen Krankenstuhl heran und legte ihre Hand leicht
auf die seinige.
„Fragen Sie mich nicht, wodurch ich zu meinem
Entschluß bestimmt worden bin, denn welches auch
immer meine Beweggründe sein mögen, sie enthalten
jedenfalls nichts, das Sic zu einer Ablehnung zwingen
müßte."
„Und doch muß ich Sie fragen, Hertha, denn wenn
von dem, was Sie mir da verheißen und was ich noch
immer nicht zu fassen vermag, wirklich jemals die Rede
sein sollte, so könnte es doch nur unter einer einzigen
Bedingung sein — unter einer Bedingung, an die Sie
vielleicht noch gar nicht gedacht haben und die ich kaum
auszusprechen wage."
„Doch, ich habe daran gedacht," erwiederte sie, und
jeder Rest mädchenhafter Befangenheit war nun aus
ihrem Benehmen geschwunden, „ich weiß, daß ich nur
als Ihre Frau bei Ihnen bleiben dürfte, und ich hätte
Sie heute nicht aufgesucht, wenn ich nicht Willens wäre,
diese Bedingung zu erfüllen."
Ehe sie es hindern oder auch nur voraussehen konnte,
hatte er seinen Arm um ihren Nacken gelegt, und ihren
Oberkörper zu sich herabgebogcn. Wieder wie in jener
Mondnacht fühlte sie seinen heißen Athen: an ihrer
Wange.
„Hertha — meine geliebte Hertha!" flüsterte er.
„So hatte ich mich damals also doch nicht getäuscht,
und nur das Gebot einer eingebildeten Pflicht war es,
das Dich verhinderte, in meine Arme zu fliegen! Nein,
mein thcures Mädchen, ich verschmähe Dein Opfer nicht,
denn zwei Menschen, die sich lieben wie wir, gehören
auch zusammen bis in den Tod!"
Hertha fühlte sich eisig durchschauert, wie wenn der
Tod selbst sie mit seinen Knochenfingern berührt hätte;
aber sie hatte diesmal nicht die Kraft, sich ungestüm
frei zu machen, wie damals im Garten des Flemming'-
schen Hauses, und nicht den Muth, den Kranken über
seinen Jrrthum aufzuklären. Erst als Hersdorff plötzlich
mühsam und röchelnd zu athmen begann, löste sie sich
erschrocken aus seinem Arm und fragte ihn angstvoll,
ob er sich schlechter fühle. Aber er schüttelte den Kopf,
und trotz der Qualen, welche er unverkennbar litt, gewann
er es über sich, zu lächeln.
„Nein, nein," brachte er mühsam hervor, „ich sagte
Dir ja, mein Lieb, daß die Freude niemals schadet,
und jetzt — jetzt fürchte ich auch nicht mehr, daß ich
sterben werde. Nun ist ja das Heilmittel gefunden,
das mich gesund machen muß, und Deine Liebe wird
mir Alles wiedcrgeben, was ich durch eigene Schuld
verlor — die Kraft, die Jugend und das Glück."
Es war unsäglich peinigend für Hertha, ihn so von
seiner sicheren Genesung sprechen zu hören, während
er ganz das Aussehen eines Sterbenden hatte, und nur
um ihn an weiteren Aeußerungen dieser trügerischen
Glückszuversicht zu hindern, begann sie in hastigen
Worten von ihrer nächsten Zukunft zu reden.
Er sollte sobald als möglich in Begleitung eines
zuverlässigen Wärters die Stadt verlassen, aber er
sollte sich nicht nach Johannisthal, sondern nach einem
geschützt gelegenen Kurort des badischen Schwarzwaldes
oder Südtirols begeben, und Hertha wollte ihm schon
in den nächsten Tagen dahin nachfolgen, sobald eS ihr
gelungen sei, eine geeignete Person als Gesellschafterin
zu finden. Sie wollten sich dann täglich sehen, bis ihre
Eheschließung stattsinden könne, und von der Meinung
der Aerzte sollten alle weiteren Maßnahmen und Pläne
abhängig gemacht werden.
(Forlsctzung solgt.)
ÄIte Erinnerungen.
(Siehe das Bild auf Seite 593.)
7>ie Jugend ist ein Paradies, das weiß man erst, wenn
man es verloren hat — das heißt, wenn die schöne Zeit
längst vorüber ist. Das fühlt nicht nur der Mensch, sondern
es scheint auch den Thieren mitunter so zu gehen. Wenigstens
bei dem alten Schimmel, den unser Bild auf S. 593 (nach
einem Gemälde von R. Koller) darstellt, trifft dieser Ausspruch
zu. Einst in herrlichen Jugendtagen war er das stolze Jagd-
roß des jungen Grafen; den geschmeidigen, eleganten Reiter
auf dem Rücken durchsprengte er Feld und Au, jagte über
Wiesen und durch Felder, dem Fuchs, dem Hirsch nach, daß
es eine Lust war. Wenn er dann heimgekehrt im Stall
stand, wurde er sauber gewaschen, spiegelblank geputzt, und der
fetteste Hafer war in seiner Krippe. Dann aber wurde er
alt, der Graf bekam die Gicht, und der Schimmel ward ver-
kauft an den Bauer. Nun begann eine ernste, trübselige Zeit
für das edle Thier. Es mußte schwere Wagen und den Pflug
ziehen, Schritt für Schritt keuchend unter der Last, eingespannt
mit einer dummen Kuh oder einem eigensinnigen, ungelenken
Ochsen. Es war ein Leben voller Blühe, Arbeit und schlechtem
Futter. Trübselig zog der Schimmel so an einem herrlichen Früh-
lingstage neben dem Ochsen den Pflug durch die lehmige Erde.
Da sprengte die herrschaftliche Jagd vorbei. Die Pferde
schnaubten, die Erde stob, die Horner schallten — dem Schimmel
ging es wie ein Schlag durch die Glieder. So leuchtete die
Sonne vor 20 Jahren, so duftig blau war dec Himmel. Der
Schimmel roch den frischen Klee der Felder, über den die
Jagd in wildem Laufe ging. Der Ton des Horns traf ge-
waltig sein Ohr. Ausgelöscht war ihm plötzlich die Gegen-
wart. Er vergaß den Stier neben sich, den Pflug hinten
und den Bauer, fort trieb es ihn, mit zu rasen mit den
Jagdpferden, dein Rus der Hörner zu folgen und an der
Spitze des Zuges zu sein. Ein gewaltiger Ruck — die alten
Stricke barsten, und dahin sprengte der Schimmel über Stock
und Stein, über Gräben und Hecken, durch Busch und Laub,
der Jagd nach. Sein Auge leuchtete, und die Nüstern
schnaubten vor Jagdlust, sein schweres Kreuz und seine steifen
Beine waren mit einem Male leicht und elastisch geworden.
Dem Ochsen kam die Sache unheimlich vor, er wurde wild
und der Bauer desgleichen, er hatte genug damit zu thun,
das gehörnte Thier zu Vernunft zu bringen und mußte den
Schimmel vorderhand laufen lassen. Dem hatte die alte
Erinnerung einen bösen Streich gespielt, und er wird sein
Gedenken vergangener schöner Zeiten sicher übel büßen müssen.
Denn wenn ihn der Bauer nach Stunden wieder haben wird,
dürfte er den Ausreißer wohl nicht mit freundlichen Worten
willkommen heißen, falls nicht die Herrschaft des alten edlen
Thiers sich erbarmt, ein gutes Wort für das ehemalige Herr-
schaftspferd einlegt und den Zorn des Bauern besänftigt. So
sehen wir, daß es selbst für Thiere bedenklich sein kann, wenn
sie sich alten Erinnerungen gar zu feurig hingeben.
Der königliche Wildpark bei Stuttgart.
(Siche das Bild aas Sciic S!>6.)
7>sr Reiz der württembergischen Haupt- und Residenzstadt
Stuttgart beruht vor Allem in ihrer anmuthigen Lage
in einem Thalkessel, der rings voll Rebhügeln, Gärten und
mit Wald gekrönten Höhen umgeben ist. Voll diesen Höhen
aus genießt man fast überall reizende Fernsichten; den
schönsten Blick über Stadt, Umgebung und das ferne württem-
bergische Unterland hat man aber auf dem Hasenberg im Westen der
Stadt, auf dessen höchstem Punkte sich das sogenannte Jäger-
haus, eine vielbesuchte Restauration, mit Aussichtsthurm erhebt.
Hinter dem Jägerhaus führt eine schöne, breite Straße bis zum
königlichen Lustschloß Solitude, wohin man entweder ganz
auf dem Waldweg oder durch den eine halbe Stunde später
beginnenden königlichen Wildpark (siehe unser Bild auf S. 596)
gelangt. Man kann jedoch auch den Fahrweg, der hinter der
Vorstadt Heslach von der nach Kaltenthal und Vaihingen
gehenden Chaussee sich rechts die Höhe emporzieht und der
auch von der Post befahren wird, wählen, oder einen ganz
neu angelegten, prächtigen Weg durch den Rothenwald
(Skizze 1) mit wunderhübschen Rückblicken auf die Stadt ein-
schlagen. Der ausgedehnte königliche Wildpark, der rings
von einem Bretterzaun eingeschlossen ist, wird von der oben
erwähnten Straße, auf welche die beiden anderen ebenfalls
nusmünden, mitten durchschnitten. Man hat auf dem Wege
zur Solitude rechter Hand den Saupark, der sich bis zum
Dorfs Bothnang, von wo ebenfalls ein Weg zum Schlosse
hinführt, erstreckt, und links den Rothwildpark. Der letztere
wird namentlich an den Sonn- und Festtagen vielfach von
Stuttgartern und Fremden durchwandert, da er ganz reizende
Parthicn enthält und durch zahlreiche Rudel von Hirschen
und Rehen belebt ist. Skizze 3 gibt einen besonders hübschen
Punkt daraus wieder' das sogenannte Bärenschlößchen. Es
ist auf der einen Seite von alten Bäumen umgeben, unter
denen Bänke stehen, von denen aus man einen schönen Blick
auf den davor in der Tiefe liegenden Bärensee genießt.
Solcher Seebecken umschließt der Park noch mehrere; Skizze 5
zeigt einen Theil des malerischen Pfasfensee's, Skizze 6 einen
bei den großen Hofjagden benutzten Schießpavillon mit einem
Wildfutterplatz und Skizze 2 das unfern der Solitude gelegene
Parkthor mit Parkwärterhäuschen. Skizze 4 endlich gibt uns
eine Ansicht von Schloß Solitude selbst, dessen Glanzzeit
unter die Regierung des Herzogs Karl von Württemberg fiel,
und das jetzt vereinsamt dasteht. Die das eigentliche Schloß
umgebenden WirthschaftSgebäude dagegen sind verpachtet und
dienen als Luftkurort und vielbesuchte Restauration. Die
königliche Domäne Solitude liegt nordwestlich von der Haupt-
stadt auf der Höhe der Stuttgarter Berge und unmittelbar
am Abfall derselben in die Ludwigsburger Ebene. Das Schloß
ist im Rokokostyl während der Jahre 1763 bis 1767 durch
den Herzog Karl Eugen von Württemberg, der in Schiller's
Leben eine so wichtige Rolle gespielt hat, erbaut worden.
„Mit der Erbauung dieses Lustorts," berichtet Hermann Kurz,
„hatte der Herzog anfangs nur ein leichtes Landhaus beab-
sichtigt, aber sein rastloser, nach Vergrößerung und Erweiterung
strebender Sinn machte bald eine kleine Pfalz daraus, deren
heiteres und behagliches Aussehen freilich nichts von den
Frohnen und anderen harten Mitteln erzählte, durch welche
es möglich geworden war, mit zauberhafter Schnelligkeit die
düstere Einöde der fünf Eichen zu einem Tempel des Ver-
gnügens und der Pracht umzuwandeln. Um das Schloß
herum stand eine Menge verschiedener Gebäude, größere und
! kleinere Pavillons, darunter dis Akademie, die 1775 als Karls-
schule nach Stuttgart verlegt wurde, ein Opernhaus, ein sehr
janger Marstall und Kasernen für die Leibgarde des Herzogs."
Von all' diesen Herrlichkeiten ist sehr wenig übrig geblieben.
Das Schlößchen selbst, zu dem eins stattliche Freitreppe empor-
führt, hat nur noch wenige wohl erhaltene Gemächer, aber
von seiner Kuppel genießt man eine herrliche Aussicht.
Änf der Höhe.
(Siehe das Bild auf Seite 597.)
?>ie Kinder sind außerordentlich erfinderisch in der Herstel-
lang von Spielen — das Unscheinbarste dient ihnen für
ihre Zwecke und die Kinderphantasie verleiht den prosaischesten
Dingen Reiz und Zauber. Das kleinste Bretterhüttchen dünkt
ihnen ein Märchenpalast, ein Bächlein verwandelt ihre Vor-
stellung in einen Strom, und eine Nußschale, die auf dem
Wasser treibt, ist ein Meerschisf. Mit dem Papierhelme auf
dem Kopfe glauben sie Generäle zu sein, und die Zaunlatte
wird im Augenblick zum Ritterschwert. Alles verwandeln sie
und machen es für ihre Spiele nutzbar. Jedoch trotz der
Mannigfaltigkeit und des steten Wechsels in dem Treiben der
Kleinen gibt es Unterhaltungen, dis sozusagen ewig sind,
die bleiben durch alle Generationen, die unsere Urväter ge-
rade so vergnügt haben wie uns und die unsere Nachkommen
in gleichem Maße wieder auf das Höchste belustigen werden.
Zu diesen unsterblichen Spielen gehört die Wippe, wie sie
M. Wunsch auf seinem Gemälde (siehe den Holzschnitt auf
S. 597) uns zeigt. Sie ist leicht hcrgestellt. Ein großer
Stein oder ein alter Baumstamm wie auf unserem Bilde, ein
starkes, nicht zu kurzes Brett und das Kunstwerk ist fertig.
Die Lehre vom Gleichgewicht und das Gesetz der Hebelkraft
üben die Kleinen, ohne sich viel um die Physik zu kümmern,
praktisch. Ihre Theorie ist, daß so viele Theilnehmer wie
möglich auf dein Brette sitzen können, und daß das Brett so
hoch, ivie nur irgend auszuführen, in die Luft geht. Ihre Haupt-
sorge ist, daß Niemand abspringt, denn geschieht dies, gibt es
eine unsanfte Niederfahrt. Den Muthigen und Kecken gehört
auch hier die Welt — die „Großen" leiten und die Kleinen
theilen mit Bangen und doch mit großer Lust das Vergnügen.
Geht's in die Höhe, klopft wohl manchem der mitfahrenden
Kleinen das Herz, und sie klammern sich fest und schreien,
während die Erfahrenen jauchzen; sind sie unten, so lachen
sie über ihre Kameraden oben, die Angst haben. Wir Er-
wachsenen stehen dabei und schauen zu, und uns wandelt die
Lust an, mitzuthun, und wir bedauern, daß wir es nicht mehr
so gut haben können, wie Jene da auf der Wippe. Denn
im bitter ernsten Leben ist man nicht so leicht auf der Höhe,
und wenn wir oben sind, lohnt sich's oft der Mühe und des
Kampfes nicht.
DerEmpflkiig des deutschenKinserpmu-es in Ln;ern.
. (Siche das Bild aus Sciic 001.)
c" eit dem Jahre 1777 hatte die Schweiz keinen Besuch eines
deutschen Kaisers mehr erhalten. Damals war es Kaiser
Joseph II., der im Juli des genannten Jahres unter dem
Inkognito eines Grafen v. Falkenstein eine Schweizerreise
unternahm — diesmal weilten Kaiser Wilhelm 11. und seins
Gemahlin auf ihrer Rückreise aus Italien (vergl. Heft 24)
einige Stunden unter den Schweizern, aber nicht inkognito,
sondern in freundlichem Verkehr mit den obersten Vertretern
der Eidgenossenschaft. Am 2. Mai hielt das Kaiserpaar in
Chiasso schon in früher Morgenstunde seinen Einzug auf
Schweizerboden; in Mieten wurde es von einer militärischen
Abordnung empfangen und von einer begeisterten Volksmenge
freudig begrüßt. Um halb 10 Uhr wurden dort die Schiffe
„Stadt Luzern" und „Italien" von den Majestäten und ihrem
Gefolge zur Fahrt über den Vierwaldstättersee bestiegen, die
bei prächtigem Wetter stattfand. An allen Ortschaften am
Ufer waren große Massen versammelt, die jubelnd grüßten.
Der Blick auf das festlich geschmückte, im Sonnenscheine
glänzende Luzern war unbeschreiblich schön. Bei dem Nahen
der Schiffe erscholl Kanonendonner von den Höhen über der
Stadt, und am Ufer harrten viele Tausende, die bei dem
Eintreffen des Kaiscrschiffes vor dem „Schweizerhof" in
brausende Hochrufe ausbrachen; die Männer schwenkten die
Hüte, die Frauen weiße Tücher zum Gruße, den das Kaiser-
paar vom Schiffe lebhaft erwiederte. Der Bundespräsident
Schenk und die Bundesräthe Vicepräsident und Kriegsminister
E. Frey und A. Lachenal gingen den Majestäten auf der
Landungsbrücke entgegen, und die beiderseitige Begrüßung
war sehr herzlich. Es erfolgte die gegenseitige Vorstellung
der beiden Mitglieder des Bundesrathes und einiger Herren
des kaiserlichen Gefolges, worauf die Herrschaften die Allee
gegen den „Schweizerhof" zu quer durchschritten. Hier defilirte
die Ehrenkompagnie und stellte sich sodann wieder beim Ein-
gangs des „Schweizerhof"-Gartens auf, in den die Herrschaften
nun geführt wurden (siehe unser Bild auf S. 601). Eine
in malerische Landestrachten gekleidete Mädchenschaar begrüßte
hier die hohe Frau und brachte ihr Blumen dar, worauf die Kai-
serin jedem der Mädchen die Hand reichte und für Alle freundliche
Worte des Dankes hatte. Zu demFestmahl im Hotel „Schweizer-
hof" waren 42 Theilnehmer geladen. Es war 11 Uhr, als die
Kaiserin, vom Bundespräsidenten Schenk am Arme geführt,
in dem großen Speisesaale zur Tafel erschien; dann folgte
der Kaiser allein, hierauf Vicepräsident Frey mit Gräfin