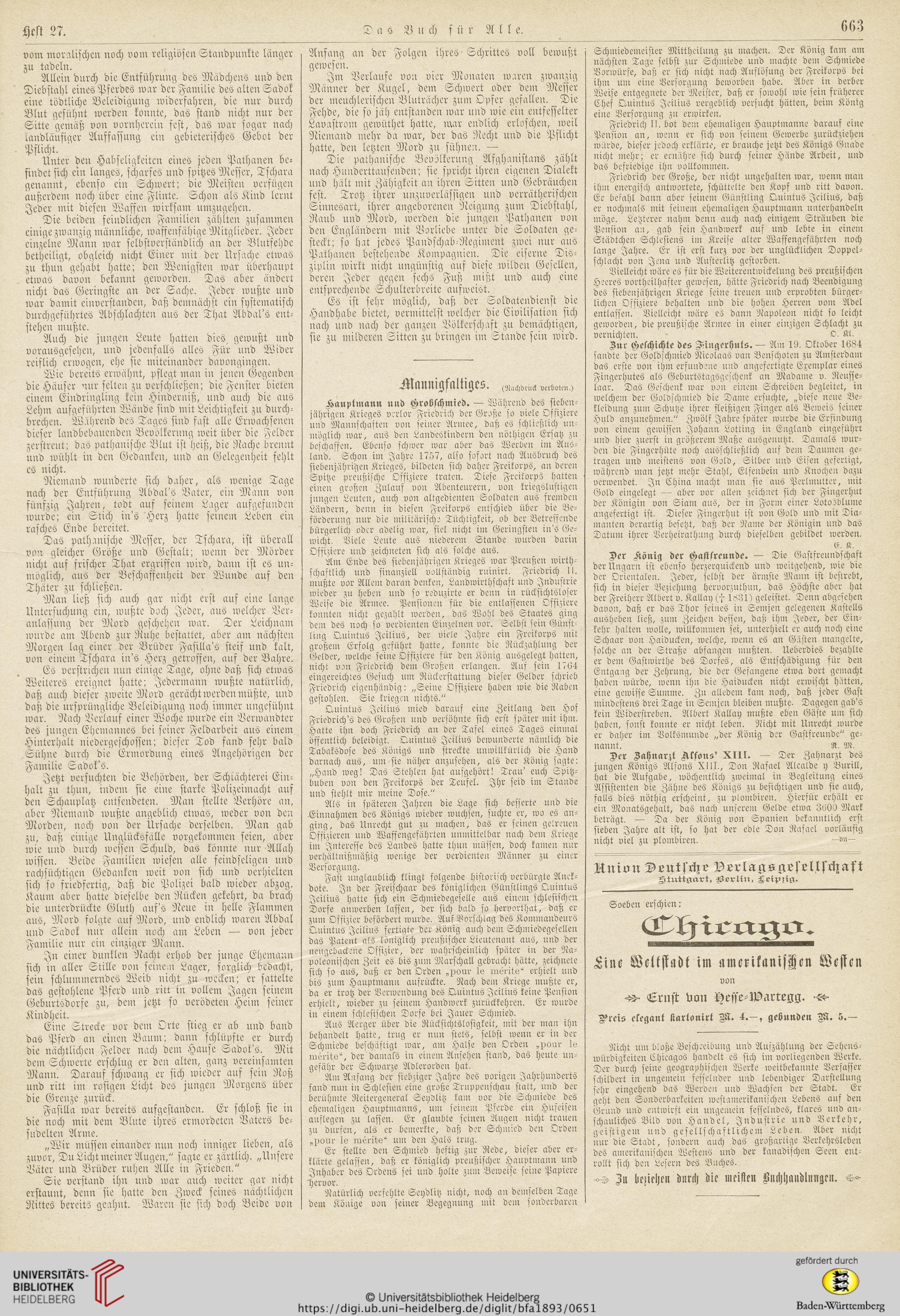663
M 27.
vom moralischen noch vom religiösen Standpunkte länger
zu tadeln.
Allein durch die Entführung des Mädchens und den
Diebstahl eines Pferdes war der Familie des alten Sadok
eine tödtliche Beleidigung widerfahren, die nur durch
Blut gesühnt werden konnte, das stand nicht nur der
Sitte gemäß von vornherein fest, das war sogar nach
landläufiger Auffassung ein gebieterisches Gebot der
Pflicht.
Unter den Habseligkeiten eines jeden Pathanen be-
findet sich ein langes, scharfes und spitzes Messer, Tschara
genannt, ebenso ein Schwert; die Meisten verfügen
außerdem noch über eine Flinte. Schon als Kind lernt
Jeder nut diesen Waffen wirksam umzugehen.
Die beiden feindlichen Familien zählten zusammen
einige zwanzig männliche, waffenfähige Mitglieder. Jeder
einzelne Mann war selbstverständlich an der Blutfehde
betheiligt, obgleich nicht Einer mit der Ursache etwas
zu thun gehabt hatte; den Wenigsten war überhaupt
etwas davon bekannt geworden. Das aber ändert
nicht das Geringste an der Sache. Jeder wußte und
war damit einverstanden, daß demnächst ein systematisch
durchgeführtes Abschlachten aus der That Abdal's ent-
stehen mußte.
Auch die jungen Leute hatten dies, gewußt und
vorausgeseheu, und jedenfalls alles Für und Wider
reiflich erwogen, ehe sie miteinander davongingen.
Wie bereits erwähnt, pflegt man in jenen Gegenden
die Häuser nur selten zu verschließen; die Fenster bieten
einem Eindringling kein Hinderniß, und auch die aus
Lehm aufgeführten Wände sind mit Leichtigkeit zu durch-
brechen. Während des Tages sind fast alle Erwachsenen
dieser landbebaucndcn Bevölkerung weit über die Felder
zerstreut; das pathanische Blut ist heiß, die Rache brennt
und wühlt in den Gedanken, und an Gelegenheit fehlt
cs nicht.
Niemand wunderte sich daher, als wenige Tage
nach der Entführung Abdal's Bater, ein Mann von
fünfzig Jahren, todt auf seinem Lager aufgefunden
wurde; ein Stich in's 'Herz hatte seinem Leben ein
rasches Ende bereitet.
Das pathanische Messer, der Tschara, ist überall
von. gleicher Größe und Gestalt; wenn der Mörder
nicht auf frischer That ergriffen wird, dann ist es un-
möglich, aus der Beschaffenheit der Wunde auf den
Thäter zu schließen.
Man ließ sich auch gar nicht erst auf eine lange
Untersuchung ein, wußte doch Jeder, aus welcher Ver-
anlassung der Mord geschehen war. Der Leichnam
wurde am Abend zur Ruhe bestattet, aber am nächsten
Morgen lag einer der Brüder Fasilla's steif und kalt,
von einem Tschara in's Herz getroffen, auf der Bahre.
Es verstrichen nun einige Tage, ohne daß sich etwas
Weiteres ereignet hatte; Jedermann wußte natürlich,
daß auch dieser zweite Mord gerächt werden müßte, und
daß die ursprüngliche Beleidigung noch immer ungesühnt
war. Nach Verlauf einer Woche wurde ein Verwandter
des jungen Ehemannes bei seiner Feldarbeit aus einem
Hinterhalt niedergeschossen; dieser Tod fand sehr bald
Sühne durch die Ermordung eines Angehörigen der
Familie Sadok's.
Jetzt versuchten die Behörden, der Schlächterei Ein-
halt zu thun, indem sie eine starke Polizeimacht auf
den Schauplatz entsendeten. Alan stellte Verhöre an,
aber Niemand wußte angeblich etwas, weder von den
Morden, noch von der Ursache derselben. Man gab
zu, daß einige Unglücksfülle vorgekommen seien, aber
wie und durch wessen Schuld, das könnte nur Allah
wissen. Beide Familien wiesen alle feindseligen und
rachsüchtigen Gedanken weit von sich und verhielten
sich so friedfertig, daß die Polizei bald wieder abzog.
Kaum aber hatte dieselbe den Rücken gekehrt, da brach
die unterdrückte Gluth auf's Neue in Helle Flammen
aus, Mord folgte auf Mord, und endlich waren Abdal
und Sadok nur allein noch am Leben — von jeder
Familie nur ein einziger Mann.
In einer dunklen Nacht erhob der junge Ehemann
sich in aller Stille von seinem Lager, sorglich bedacht,
sein schlummerndes Weib nicht zu wecken; er sattelte
das gestohlene Pferd und ritt in vollem Jagen seinem
Geburtsdorfe zu, dem jetzt so verödeten Heim seiner
Kindheit.
Eine Strecke vor dem Orte stieg er ab und band
das Pferd an einen Baum; dann schlüpfte er durch
die nächtlichen Felder nach dem Hause Sadok's. Mit
dem Schwerte erschlug er den alten, ganz vereinsamten
Mann. Darauf schwang er sich wieder auf sein Roß
und ritt im rosigen Licht des jungen Morgens über
die Grenze zurück.
Fasilla war bereits aufgestanden. Er schloß sie in
die noch mit dem Blute ihres ermordeten Vaters be-
sudelten Arme.
„Wir müssen einander nun noch inniger lieben, als
zuvor, Du Licht meiner Augen," sagte er zärtlich. „Unsere
Väter und Brüder ruhen Alle in Frieden."
Sie verstand ihn und war auch weiter gar nicht
erstaunt, denn sie hatte den Zweck seines nächtlichen
Rittes bereits geahnt. Waren sie sich doch Beide von
Das Vu ch f ü r All e.
Anfang an der Folgen ihres Schrittes voll bewußt
gewesen.
Im Verlaufe von vier Monaten waren zwanzig
Männer der Kugel, dem Schwert oder dem Messer
der meuchlerischen Blutrüchcr zum Opfer gefallen. Die
Fehde, die so jäh entstanden war und ivie ein entfesselter
Lavastrom gewüthet hatte, mar endlich erloschen, weil
Niemand mehr da war, der das Recht und die Pflicht
hatte, den letzten Mord zu sühnen. —
Die pathanische Bevölkerung Afghanistans zählt
nach Hunderttausenden; sie spricht ihren eigenen Dialekt
und hält mit Zähigkeit an ihren Sitten und Gebräuchen
fest. Trotz ihrer unzuverlässigen und verrütherischen
Sinnesart, ihrer angeborenen Neigung zum Diebstahl,
Raub und Mord, werden die jungen Pathanen von
den Engländern mit Vorliebe unter die Soldaten ge-
steckt; so hat jedes Pandschab-Regiment zwei nur aus
Pathanen bestehende Kompagnien. Die eiserne Dis-
ziplin wirkt nicht ungünstig auf diese wilden Gesellen,
deren Jeder gegen sechs Fuß mißt und auch eine
entsprechende Schulterbreite aufweist.
Es ist sehr möglich, daß der Soldatendienst die
Handhabe bietet, vermittelst welcher die Civilisation sich
nach und nach der ganzen Völkerschaft zu bemächtigen,
sie zu milderen Sitten zu bringen im Stande sein wird.
MllnmgMigcs. ^,^6
Kauptmann und Hroöschmrcd. — Während des sieben-
jährigen Krieges verlor Friedrich der Große so viele Offiziere
und Mannschaften von seiner Armee, daß es schließlich un-
möglich war, aus den Lnndeskindern den nöthigcn Ersatz zu
beschaffen. Ebenso schwer war aber das Werben im Aus-
land. Schon im Jahre 1757, also sofort nach Ausbruch des
siebenjährigen Krieges, bildeten sich daher Freikorps, au deren
Spitze preußische Offiziere traten. Diese Freikorps halten
einen großen Zulauf von Abenteurern, von kriegslustigen
jungen Leuten, auch von altgedienten Soldaten aus fremden
Ländern, denn in diesen Freikorps entschied über die Be-
förderung nur die militärische Tüchtigkeit, ob der Betreffende
bürgerlich oder adelig war, fiel nicht im Geringsten in's Ge-
wicht. Viele Leute aus niederem Stande wurden darin
Offiziere und zeichneten sich als solche aus.
Am Ende des siebenjährigen Krieges war Preußen wirth-
schaftlich und finanziell vollständig ruinirt. Friedrich U.
mußte vor Allem daran denken, Landwirthschaft und Industrie
wieder zu heben und so reduzirte er denn in rücksichtsloser
Weise die Armee. Pensionen für die entlassenen Offiziere
konnten nicht gezahlt werden, das Wohl des Staates ging
dem des noch so verdienten Einzelnen vor. Selbst sein Günst-
ling Quintus Jcilius, der viele Jahre ein Freikorps mit
großen! Erfolg geführt hatte, konnte die Rückzahlung der
Gelder, welche seine Offiziere für den König ausgelegt hatten,
nicht von Friedrich dem Großen erlangen. Auf sein 1704
eingereichteü Gesuch um Rückerstattung dieser Gelder schrieb
Friedrich eigenhändig: „Seine Offiziere haben ivie die Naben
gestohlen. Sie kriegen nichts."
Quintus Jcilius mied darauf eine Zeitlang den Hof
Friedrich'-- des Großen und versöhnte sich erst später mit ihm.
Hatte ihn doch Friedrich au der Tafel eines TageS einmal
öffentlich beleidigt. Quintus Jcilius bewunderte nämlich die
Tabaksdose des Königs und streckte unwillkürlich die Hand
darnach aus, um sie näher anzusehen, als der König sagte:
„Hand weg! Das Stehlen hat aufgehört! Trau' euch Spitz-
buben von den Freikorps der Teufel. Ihr seid iui Stande
und stehlt inir meine Dose."
Als in späteren Jahren dis Lage sich besserte und die
Einnahmen des Königs wieder wuchsen, suchte er, wo es an-
ging, das Unrecht gut zu machen, das er seinen getreuen
Offizieren und Waffengefährten unmittelbar nach dem Kriege
im Interesse des Landes hatte thun müssen, doch kamen nur
verhältnißniäßig wenige der verdienten Männer zu einer
Versorgung.
Fast unglaublich klingt folgende historisch verbürgte Anek-
dote. In der Freischaar des königlichen Günstlings Quintus
Jcilius hatte sich ein Schmiedegeselle aus einem schlesischen
Dorfe anwerben lassen, der sich bald so heroorthat, daß er
zum Offizier befördert wurde. Auf Vorschlag des Kommandeurs
Quintus Jcilius fertigte der König auch dem Schiniedegesellen
das Patent als königlich preußischer Lieutenant aus, und der
neugebackene Offizier, der wahrscheinlich später in der Na-
poleonischen Zeit es bis zum Marschall gebracht hätte, zeichnete
sich so aus, daß er den Orden „xour Io wörito" erhielt und
bis zum Hauptmann aufrückte. Nach dein Kriege mußte er,
da er trotz der Verwendung des Quintus Jcilius keine Pension
erhielt, wieder zu seinem Handwerk zurückkehren. Er wurde
in einem schlesischen Dorfe bei Jauer Schmied.
Aus Aerger über die Rücksichtslosigkeit, mit der man ihn
behandelt hatte, trug er nun stets, selbst wenn er in der
Schmiede beschäftigt war, am Halse den Orden „pcmr Is
inöritoZ der damals in einem Ansehen stand, das heute un-
gefähr der Schwarze Adlerorden hat.
Am Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
fand nun in Schlesien eine große Truppenschau statt, und der
berühmte Neitergeneral Seydlitz kant vor die Schmiede des
ehemaligen Hauptmanns, um seine»! Pferde ein Hufeisen
auflegen zu lassen. Er glaubte seinen Augen nicht trauen
zu dürfen, als er bemerkte, daß der Schniied den Orden
„pour Is nrerits" um den Hals trug.
Er stellte den Schmied heftig zur Rede, dieser aber er-
klärte gelassen, daß er königlich preußischer Hauptmann und
Inhaber des Ordens sei und holte zum Beweise seine Papiere
chervor. .
Natürlich verfehlte Seydlitz nicht, noch an demselben Tage
dem Könige von seiner Begegnung mit dein sonderbaren
Schmiedeincister Mitthcilung zu machen. Der König kam am
nächsten Tage selbst zur Schmiede und machte dem Schmiede
Vorwürfe, daß er sich nicht nach Auflösung der Freikorps bei
ihm um eine Versorgung beworben habe. Aber in derber
Weise entgegnete der Meister, daß er sowohl wie sein früherer
Chef Quintus Jcilius vergeblich versucht hätten, beim König
eine Versorgung zu erwirken.
Friedrich It. bot dem ehemaligen Hauptmanns darauf eine
Pension an, wenn er sich von seinem Gewerbe zurückziehen
würde, dieser jedoch erklärte, er brauche jetzt des Königs Gnade
nicht mehr; er ernähre sich durch seiner Hände Arbeit, und
das befriedige ihn vollkommen.
Friedrich der Große, der nicht ungehalten war, wenn man
ihm energisch antwortete, schüttelte den Kopf und ritt davon.
Er befahl dann aber seinem Günstling Quintus Jcilius, daß
er nochmals mit seinem ehemaligen Hauptmann unterhandeln
möge. Letzterer nahm denn auch nach einigem Sträuben die
Pension an, gab sein Handwerk auf und lebte in einem
Städtchen Schlesiens im Kreise alter Waffengefährten noch
lange Jahre. Er ist erst kurz vor der unglücklichen Doppel-
schlacht von Jena und Austerlitz gestorben.
Vielleicht wäre es für die Weiterentwickelung des preußischen
Heeres vortheilhafter gewesen, hätte Friedrich nach Beendigung
des siebenjährigen Kriege seine treuen und erprobten bürger-
lichen Offiziere behalten und die hohen Herren vom Adel
entlassen. Vielleicht wäre es dann Napoleon nicht so leicht
geworden, die preußische Armee in einer einzigen Schlacht zu
vernichten. - O. Kl.
Zur Geschichte des Aingerhuts.— Am 19. Oktober 1684
sandte der Goldschmied Nicolaas van Benschoten zu Amsterdam
das erste von ihm erfundene und angefertigts Exemplar eines
Fingerhutes als Geburtstagsgeschenk an Madame v. Reusse-
laar. DaS Geschenk war von einem Schreiben begleitet, in
welchem der Goldschmied die Dame ersuchte, „diese neue Be-
kleidung zum Schutze ihrer fleißigen Finger als Beweis seiner
Huld anzunehmen." Zwölf Jahrs später wurde die Erfindung
von einem gewissen Johann Lotting in England cingeführt
und hier zuerst in größerem Maße ausgenutzt. Damals wur-
den die Fingerhüte noch ausschließlich auf dein Daumen ge-
tragen und meistens von Gold, Silber und Eisen gefertigt,
während man jetzt mehr Stahl, Elfenbein und Knochen dazu
verwendet. In China macht man sie aus Perlmutter, mit
Gold eingelegt — aber vor allen zeichnet sich der Fingerhut
der Königin von Siam aus, der in Form einer Lotosblume
angefertigt ist. Dieser Fingerhut ist von Gold und mit Dia-
manten derartig besetzt, daß der Name der Königin und das
Datum ihrer Verheirathung durch dieselben gebildet werden.
s. K.
Der König der Hastfrcunde. — Die Gastfreundschaft
der Ungarn ist ebenso herzerquickend und weitgehend, wie die
der Orientalen. Jeder, selbst der ärmste Mann ist bestrebt,
sich in dieser Beziehung hervorzuthun, daS Höchste aber hat
der Freiherr Albert v. Kallay (ff 1831) geleistet. Denn abgesehen
davon, daß er das Thor seines in Semjen gelegenen Kastells
ausheben ließ, zum Zeichen dessen, daß ihm Jeder, der Ein-
kehr halten wolle, willkommen sei, unterhielt er auch noch eine
Schaar von Haiducken, welche, wenn es an Gästen mangelte,
solche an der Straße abfangen mußten. Ueberdies bezahlte
er dem Gastwirthe des Dorfes, als Entschädigung für den
Entgang der Zehrung, die der Gefangene etwa dort gemacht
haben würde, wenn ihn die Haiducken nicht erwischt hätten,
eine gewisse Summe. Zu alledem kam noch, daß jeder Gast
mindestens drei Tage in Semjen bleiben mußte. Dagegen gab's
kein Widerstreben. Albert Kallay mußte eben Gäste um sich
haben, sonst konnte er nicht leben. Nicht mit Unrecht wurde
er daher im Volksinunde „der König der Gastfreunde" ge-
nannt. R. M.
Der Zahnarzt Alfons' XIII. — Der Zahnarzt des
jungen Königs Alfons XiII., Don Rafael Alcaldo y Burill,
hat die Aufgabe, wöchentlich zweimal in Begleitung eines
Assistenten die Zähne des Königs zu besichtigen und sie auch,
falls dies nöthig erscheint, zu plombiren. Hierfür erhält er
ein Monatsgehalt, das nach unserem Gelde etwa 3600 Mark
beträgt. — Da der König von Spanien bekanntlich erst
sieben Jahre alt ist, so hat der edle Don Rafael vorläufig
nicht viel zu plombiren. --du-
Union Deutsche Verlagsgesellschast
Ktrrttgclvk, Kcr'tiu, Aeiprin-
Soeben erschien:
Line Weltstadt im amerikanisVen Westen
von
Srust von Heffe-Wartegg.
ZN'cis elegant liartonirt ZN. 4.—, gebunden ZN. 5.—
Nicht um bloße Beschreibung und Aufzählung der Sehens-
würdigkeiten Chicagos handelt es sich im vorliegenden Werke.
Der durch seine geographischen Werke weitbekannte Verfasser
schildert in ungemein fesselnder und lebendiger Darstellung
sehr eingehend das Werden und Wachsen der Stadt. Er
geht den Sonderbarkeiten westamerikanischen Lebens auf den
Grund und entwirft ein ungeinein fesselndes, klares und an-
schauliches Bild von Handel, Industrie und Verkehr,
geistigem und gesellschaftlichem Leben. Aber nicht
nur die Stadt, sondern auch das großartige Verkehrslcben
des amerikanischen Westens und der kanadischen Seen ent-
rollt sich den Lesern des Buches.
Zu bkffchcil durch dir uieiltru Kuchhaudtunzru.
M 27.
vom moralischen noch vom religiösen Standpunkte länger
zu tadeln.
Allein durch die Entführung des Mädchens und den
Diebstahl eines Pferdes war der Familie des alten Sadok
eine tödtliche Beleidigung widerfahren, die nur durch
Blut gesühnt werden konnte, das stand nicht nur der
Sitte gemäß von vornherein fest, das war sogar nach
landläufiger Auffassung ein gebieterisches Gebot der
Pflicht.
Unter den Habseligkeiten eines jeden Pathanen be-
findet sich ein langes, scharfes und spitzes Messer, Tschara
genannt, ebenso ein Schwert; die Meisten verfügen
außerdem noch über eine Flinte. Schon als Kind lernt
Jeder nut diesen Waffen wirksam umzugehen.
Die beiden feindlichen Familien zählten zusammen
einige zwanzig männliche, waffenfähige Mitglieder. Jeder
einzelne Mann war selbstverständlich an der Blutfehde
betheiligt, obgleich nicht Einer mit der Ursache etwas
zu thun gehabt hatte; den Wenigsten war überhaupt
etwas davon bekannt geworden. Das aber ändert
nicht das Geringste an der Sache. Jeder wußte und
war damit einverstanden, daß demnächst ein systematisch
durchgeführtes Abschlachten aus der That Abdal's ent-
stehen mußte.
Auch die jungen Leute hatten dies, gewußt und
vorausgeseheu, und jedenfalls alles Für und Wider
reiflich erwogen, ehe sie miteinander davongingen.
Wie bereits erwähnt, pflegt man in jenen Gegenden
die Häuser nur selten zu verschließen; die Fenster bieten
einem Eindringling kein Hinderniß, und auch die aus
Lehm aufgeführten Wände sind mit Leichtigkeit zu durch-
brechen. Während des Tages sind fast alle Erwachsenen
dieser landbebaucndcn Bevölkerung weit über die Felder
zerstreut; das pathanische Blut ist heiß, die Rache brennt
und wühlt in den Gedanken, und an Gelegenheit fehlt
cs nicht.
Niemand wunderte sich daher, als wenige Tage
nach der Entführung Abdal's Bater, ein Mann von
fünfzig Jahren, todt auf seinem Lager aufgefunden
wurde; ein Stich in's 'Herz hatte seinem Leben ein
rasches Ende bereitet.
Das pathanische Messer, der Tschara, ist überall
von. gleicher Größe und Gestalt; wenn der Mörder
nicht auf frischer That ergriffen wird, dann ist es un-
möglich, aus der Beschaffenheit der Wunde auf den
Thäter zu schließen.
Man ließ sich auch gar nicht erst auf eine lange
Untersuchung ein, wußte doch Jeder, aus welcher Ver-
anlassung der Mord geschehen war. Der Leichnam
wurde am Abend zur Ruhe bestattet, aber am nächsten
Morgen lag einer der Brüder Fasilla's steif und kalt,
von einem Tschara in's Herz getroffen, auf der Bahre.
Es verstrichen nun einige Tage, ohne daß sich etwas
Weiteres ereignet hatte; Jedermann wußte natürlich,
daß auch dieser zweite Mord gerächt werden müßte, und
daß die ursprüngliche Beleidigung noch immer ungesühnt
war. Nach Verlauf einer Woche wurde ein Verwandter
des jungen Ehemannes bei seiner Feldarbeit aus einem
Hinterhalt niedergeschossen; dieser Tod fand sehr bald
Sühne durch die Ermordung eines Angehörigen der
Familie Sadok's.
Jetzt versuchten die Behörden, der Schlächterei Ein-
halt zu thun, indem sie eine starke Polizeimacht auf
den Schauplatz entsendeten. Alan stellte Verhöre an,
aber Niemand wußte angeblich etwas, weder von den
Morden, noch von der Ursache derselben. Man gab
zu, daß einige Unglücksfülle vorgekommen seien, aber
wie und durch wessen Schuld, das könnte nur Allah
wissen. Beide Familien wiesen alle feindseligen und
rachsüchtigen Gedanken weit von sich und verhielten
sich so friedfertig, daß die Polizei bald wieder abzog.
Kaum aber hatte dieselbe den Rücken gekehrt, da brach
die unterdrückte Gluth auf's Neue in Helle Flammen
aus, Mord folgte auf Mord, und endlich waren Abdal
und Sadok nur allein noch am Leben — von jeder
Familie nur ein einziger Mann.
In einer dunklen Nacht erhob der junge Ehemann
sich in aller Stille von seinem Lager, sorglich bedacht,
sein schlummerndes Weib nicht zu wecken; er sattelte
das gestohlene Pferd und ritt in vollem Jagen seinem
Geburtsdorfe zu, dem jetzt so verödeten Heim seiner
Kindheit.
Eine Strecke vor dem Orte stieg er ab und band
das Pferd an einen Baum; dann schlüpfte er durch
die nächtlichen Felder nach dem Hause Sadok's. Mit
dem Schwerte erschlug er den alten, ganz vereinsamten
Mann. Darauf schwang er sich wieder auf sein Roß
und ritt im rosigen Licht des jungen Morgens über
die Grenze zurück.
Fasilla war bereits aufgestanden. Er schloß sie in
die noch mit dem Blute ihres ermordeten Vaters be-
sudelten Arme.
„Wir müssen einander nun noch inniger lieben, als
zuvor, Du Licht meiner Augen," sagte er zärtlich. „Unsere
Väter und Brüder ruhen Alle in Frieden."
Sie verstand ihn und war auch weiter gar nicht
erstaunt, denn sie hatte den Zweck seines nächtlichen
Rittes bereits geahnt. Waren sie sich doch Beide von
Das Vu ch f ü r All e.
Anfang an der Folgen ihres Schrittes voll bewußt
gewesen.
Im Verlaufe von vier Monaten waren zwanzig
Männer der Kugel, dem Schwert oder dem Messer
der meuchlerischen Blutrüchcr zum Opfer gefallen. Die
Fehde, die so jäh entstanden war und ivie ein entfesselter
Lavastrom gewüthet hatte, mar endlich erloschen, weil
Niemand mehr da war, der das Recht und die Pflicht
hatte, den letzten Mord zu sühnen. —
Die pathanische Bevölkerung Afghanistans zählt
nach Hunderttausenden; sie spricht ihren eigenen Dialekt
und hält mit Zähigkeit an ihren Sitten und Gebräuchen
fest. Trotz ihrer unzuverlässigen und verrütherischen
Sinnesart, ihrer angeborenen Neigung zum Diebstahl,
Raub und Mord, werden die jungen Pathanen von
den Engländern mit Vorliebe unter die Soldaten ge-
steckt; so hat jedes Pandschab-Regiment zwei nur aus
Pathanen bestehende Kompagnien. Die eiserne Dis-
ziplin wirkt nicht ungünstig auf diese wilden Gesellen,
deren Jeder gegen sechs Fuß mißt und auch eine
entsprechende Schulterbreite aufweist.
Es ist sehr möglich, daß der Soldatendienst die
Handhabe bietet, vermittelst welcher die Civilisation sich
nach und nach der ganzen Völkerschaft zu bemächtigen,
sie zu milderen Sitten zu bringen im Stande sein wird.
MllnmgMigcs. ^,^6
Kauptmann und Hroöschmrcd. — Während des sieben-
jährigen Krieges verlor Friedrich der Große so viele Offiziere
und Mannschaften von seiner Armee, daß es schließlich un-
möglich war, aus den Lnndeskindern den nöthigcn Ersatz zu
beschaffen. Ebenso schwer war aber das Werben im Aus-
land. Schon im Jahre 1757, also sofort nach Ausbruch des
siebenjährigen Krieges, bildeten sich daher Freikorps, au deren
Spitze preußische Offiziere traten. Diese Freikorps halten
einen großen Zulauf von Abenteurern, von kriegslustigen
jungen Leuten, auch von altgedienten Soldaten aus fremden
Ländern, denn in diesen Freikorps entschied über die Be-
förderung nur die militärische Tüchtigkeit, ob der Betreffende
bürgerlich oder adelig war, fiel nicht im Geringsten in's Ge-
wicht. Viele Leute aus niederem Stande wurden darin
Offiziere und zeichneten sich als solche aus.
Am Ende des siebenjährigen Krieges war Preußen wirth-
schaftlich und finanziell vollständig ruinirt. Friedrich U.
mußte vor Allem daran denken, Landwirthschaft und Industrie
wieder zu heben und so reduzirte er denn in rücksichtsloser
Weise die Armee. Pensionen für die entlassenen Offiziere
konnten nicht gezahlt werden, das Wohl des Staates ging
dem des noch so verdienten Einzelnen vor. Selbst sein Günst-
ling Quintus Jcilius, der viele Jahre ein Freikorps mit
großen! Erfolg geführt hatte, konnte die Rückzahlung der
Gelder, welche seine Offiziere für den König ausgelegt hatten,
nicht von Friedrich dem Großen erlangen. Auf sein 1704
eingereichteü Gesuch um Rückerstattung dieser Gelder schrieb
Friedrich eigenhändig: „Seine Offiziere haben ivie die Naben
gestohlen. Sie kriegen nichts."
Quintus Jcilius mied darauf eine Zeitlang den Hof
Friedrich'-- des Großen und versöhnte sich erst später mit ihm.
Hatte ihn doch Friedrich au der Tafel eines TageS einmal
öffentlich beleidigt. Quintus Jcilius bewunderte nämlich die
Tabaksdose des Königs und streckte unwillkürlich die Hand
darnach aus, um sie näher anzusehen, als der König sagte:
„Hand weg! Das Stehlen hat aufgehört! Trau' euch Spitz-
buben von den Freikorps der Teufel. Ihr seid iui Stande
und stehlt inir meine Dose."
Als in späteren Jahren dis Lage sich besserte und die
Einnahmen des Königs wieder wuchsen, suchte er, wo es an-
ging, das Unrecht gut zu machen, das er seinen getreuen
Offizieren und Waffengefährten unmittelbar nach dem Kriege
im Interesse des Landes hatte thun müssen, doch kamen nur
verhältnißniäßig wenige der verdienten Männer zu einer
Versorgung.
Fast unglaublich klingt folgende historisch verbürgte Anek-
dote. In der Freischaar des königlichen Günstlings Quintus
Jcilius hatte sich ein Schmiedegeselle aus einem schlesischen
Dorfe anwerben lassen, der sich bald so heroorthat, daß er
zum Offizier befördert wurde. Auf Vorschlag des Kommandeurs
Quintus Jcilius fertigte der König auch dem Schiniedegesellen
das Patent als königlich preußischer Lieutenant aus, und der
neugebackene Offizier, der wahrscheinlich später in der Na-
poleonischen Zeit es bis zum Marschall gebracht hätte, zeichnete
sich so aus, daß er den Orden „xour Io wörito" erhielt und
bis zum Hauptmann aufrückte. Nach dein Kriege mußte er,
da er trotz der Verwendung des Quintus Jcilius keine Pension
erhielt, wieder zu seinem Handwerk zurückkehren. Er wurde
in einem schlesischen Dorfe bei Jauer Schmied.
Aus Aerger über die Rücksichtslosigkeit, mit der man ihn
behandelt hatte, trug er nun stets, selbst wenn er in der
Schmiede beschäftigt war, am Halse den Orden „pcmr Is
inöritoZ der damals in einem Ansehen stand, das heute un-
gefähr der Schwarze Adlerorden hat.
Am Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
fand nun in Schlesien eine große Truppenschau statt, und der
berühmte Neitergeneral Seydlitz kant vor die Schmiede des
ehemaligen Hauptmanns, um seine»! Pferde ein Hufeisen
auflegen zu lassen. Er glaubte seinen Augen nicht trauen
zu dürfen, als er bemerkte, daß der Schniied den Orden
„pour Is nrerits" um den Hals trug.
Er stellte den Schmied heftig zur Rede, dieser aber er-
klärte gelassen, daß er königlich preußischer Hauptmann und
Inhaber des Ordens sei und holte zum Beweise seine Papiere
chervor. .
Natürlich verfehlte Seydlitz nicht, noch an demselben Tage
dem Könige von seiner Begegnung mit dein sonderbaren
Schmiedeincister Mitthcilung zu machen. Der König kam am
nächsten Tage selbst zur Schmiede und machte dem Schmiede
Vorwürfe, daß er sich nicht nach Auflösung der Freikorps bei
ihm um eine Versorgung beworben habe. Aber in derber
Weise entgegnete der Meister, daß er sowohl wie sein früherer
Chef Quintus Jcilius vergeblich versucht hätten, beim König
eine Versorgung zu erwirken.
Friedrich It. bot dem ehemaligen Hauptmanns darauf eine
Pension an, wenn er sich von seinem Gewerbe zurückziehen
würde, dieser jedoch erklärte, er brauche jetzt des Königs Gnade
nicht mehr; er ernähre sich durch seiner Hände Arbeit, und
das befriedige ihn vollkommen.
Friedrich der Große, der nicht ungehalten war, wenn man
ihm energisch antwortete, schüttelte den Kopf und ritt davon.
Er befahl dann aber seinem Günstling Quintus Jcilius, daß
er nochmals mit seinem ehemaligen Hauptmann unterhandeln
möge. Letzterer nahm denn auch nach einigem Sträuben die
Pension an, gab sein Handwerk auf und lebte in einem
Städtchen Schlesiens im Kreise alter Waffengefährten noch
lange Jahre. Er ist erst kurz vor der unglücklichen Doppel-
schlacht von Jena und Austerlitz gestorben.
Vielleicht wäre es für die Weiterentwickelung des preußischen
Heeres vortheilhafter gewesen, hätte Friedrich nach Beendigung
des siebenjährigen Kriege seine treuen und erprobten bürger-
lichen Offiziere behalten und die hohen Herren vom Adel
entlassen. Vielleicht wäre es dann Napoleon nicht so leicht
geworden, die preußische Armee in einer einzigen Schlacht zu
vernichten. - O. Kl.
Zur Geschichte des Aingerhuts.— Am 19. Oktober 1684
sandte der Goldschmied Nicolaas van Benschoten zu Amsterdam
das erste von ihm erfundene und angefertigts Exemplar eines
Fingerhutes als Geburtstagsgeschenk an Madame v. Reusse-
laar. DaS Geschenk war von einem Schreiben begleitet, in
welchem der Goldschmied die Dame ersuchte, „diese neue Be-
kleidung zum Schutze ihrer fleißigen Finger als Beweis seiner
Huld anzunehmen." Zwölf Jahrs später wurde die Erfindung
von einem gewissen Johann Lotting in England cingeführt
und hier zuerst in größerem Maße ausgenutzt. Damals wur-
den die Fingerhüte noch ausschließlich auf dein Daumen ge-
tragen und meistens von Gold, Silber und Eisen gefertigt,
während man jetzt mehr Stahl, Elfenbein und Knochen dazu
verwendet. In China macht man sie aus Perlmutter, mit
Gold eingelegt — aber vor allen zeichnet sich der Fingerhut
der Königin von Siam aus, der in Form einer Lotosblume
angefertigt ist. Dieser Fingerhut ist von Gold und mit Dia-
manten derartig besetzt, daß der Name der Königin und das
Datum ihrer Verheirathung durch dieselben gebildet werden.
s. K.
Der König der Hastfrcunde. — Die Gastfreundschaft
der Ungarn ist ebenso herzerquickend und weitgehend, wie die
der Orientalen. Jeder, selbst der ärmste Mann ist bestrebt,
sich in dieser Beziehung hervorzuthun, daS Höchste aber hat
der Freiherr Albert v. Kallay (ff 1831) geleistet. Denn abgesehen
davon, daß er das Thor seines in Semjen gelegenen Kastells
ausheben ließ, zum Zeichen dessen, daß ihm Jeder, der Ein-
kehr halten wolle, willkommen sei, unterhielt er auch noch eine
Schaar von Haiducken, welche, wenn es an Gästen mangelte,
solche an der Straße abfangen mußten. Ueberdies bezahlte
er dem Gastwirthe des Dorfes, als Entschädigung für den
Entgang der Zehrung, die der Gefangene etwa dort gemacht
haben würde, wenn ihn die Haiducken nicht erwischt hätten,
eine gewisse Summe. Zu alledem kam noch, daß jeder Gast
mindestens drei Tage in Semjen bleiben mußte. Dagegen gab's
kein Widerstreben. Albert Kallay mußte eben Gäste um sich
haben, sonst konnte er nicht leben. Nicht mit Unrecht wurde
er daher im Volksinunde „der König der Gastfreunde" ge-
nannt. R. M.
Der Zahnarzt Alfons' XIII. — Der Zahnarzt des
jungen Königs Alfons XiII., Don Rafael Alcaldo y Burill,
hat die Aufgabe, wöchentlich zweimal in Begleitung eines
Assistenten die Zähne des Königs zu besichtigen und sie auch,
falls dies nöthig erscheint, zu plombiren. Hierfür erhält er
ein Monatsgehalt, das nach unserem Gelde etwa 3600 Mark
beträgt. — Da der König von Spanien bekanntlich erst
sieben Jahre alt ist, so hat der edle Don Rafael vorläufig
nicht viel zu plombiren. --du-
Union Deutsche Verlagsgesellschast
Ktrrttgclvk, Kcr'tiu, Aeiprin-
Soeben erschien:
Line Weltstadt im amerikanisVen Westen
von
Srust von Heffe-Wartegg.
ZN'cis elegant liartonirt ZN. 4.—, gebunden ZN. 5.—
Nicht um bloße Beschreibung und Aufzählung der Sehens-
würdigkeiten Chicagos handelt es sich im vorliegenden Werke.
Der durch seine geographischen Werke weitbekannte Verfasser
schildert in ungemein fesselnder und lebendiger Darstellung
sehr eingehend das Werden und Wachsen der Stadt. Er
geht den Sonderbarkeiten westamerikanischen Lebens auf den
Grund und entwirft ein ungeinein fesselndes, klares und an-
schauliches Bild von Handel, Industrie und Verkehr,
geistigem und gesellschaftlichem Leben. Aber nicht
nur die Stadt, sondern auch das großartige Verkehrslcben
des amerikanischen Westens und der kanadischen Seen ent-
rollt sich den Lesern des Buches.
Zu bkffchcil durch dir uieiltru Kuchhaudtunzru.