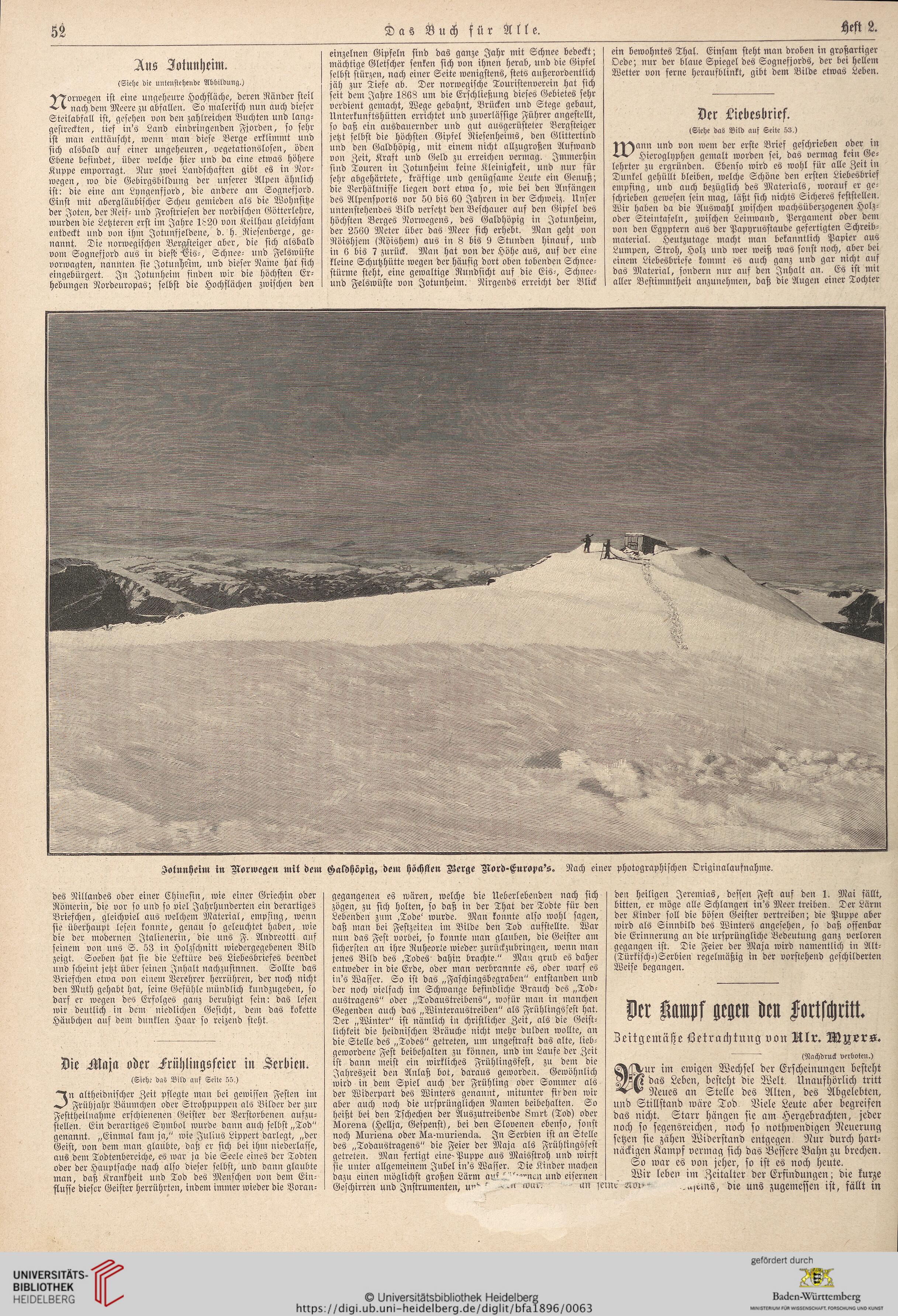59
Das Buch für Alle.
heft L.
Aus Jotunheim.
Siehe die untenſtehende Abbildung)
iſt eine ungeheure Hochfläche, deren Ränder ſteil
nach dem Meere zu abfallen. So nialeriſch nun auch dieſer
Steilabfaͤll iſt, geſehen von den zahlreichen Buchten und lang-
geſtreckten, tief in's Land eindringenden Fjorden, ſo ſehr
iſt man enttäuſcht, wenn man dieſe Berge erklimmt und
ſich alsbald auf einer ungeheuren, vegetationsloſen, öden
Ebene befindet, über welche hier und da eine etwas höhere
Kuppe emporraat. Nur zwei Landſchaften gibt es in Nor-
wegen, wo die Gebirgsbildung der unſerer Alpen ähnlich
iſt! die eine am Lyngenfjord, die andere am Sognefjord.
Einſt mit abergläubiſcher Scheu gemieden als die Wohnſitze
der Joten, der Reif- und Froſtrieſen der nordiſchen Götterlehre,
wurden die Letzteren erſt im Jahre 1520 von Keilhau gleichſam
entdeckt und don ihm Jotunfjeldene, d. h. Rieſenberge, ge-
nannt. Die norwegiſchen Bergſteiger aber, die ſich alsbald
vom Sognefjord aus in dieſe Cis:, Schnee- und Felswüſte
vorwagten, nannten ſie Jotunhétm, und dieſer Name hat ſich
eingebürgert. In Jotunheim finden wir die höchſten Er-
hebungen Nordeuropas; ſelbſt die Hochflächen zwiſchen den
einzelnen Gipfeln ſind das ganze Jahr mit Schnee bedeckt;
mächtige Gleiſcher ſenken ſich von ihnen herab, und die Gipfel
ſelbft flürzen, nach einer Seite wenigſtens, ſtets außerordentlich
jäh zur Tiefe ab. Der norwegiſche Touriſtenverein hat ſich
feit dem Jahre 1868 um die Erſchließung dieſes Gebietes ſehr
verdient gemacht, Wege gebahnt, Brücken und Stege gehaut,
Unterkunftshütlen errichtet und zuverläſſige Führer angeſtellt,
ſo daß ein ausdauernder und gut ausgerüſteter Vergſteiger
jetzt ſelbſt die höchſten Gipfel Rieſenheims, den Glittertind
und den Galdhöpig, mit einem nicht allzugroßen Aufwand
von Zeit, Kraft und Geld zu erreichen vermag. Immerhin
ſind Touren in Jotunheim keine Kleinigkeit, und nur für
fehr abgehärtete, kräftige und genügſame Leute ein Genuß;
die Verhältniſſe liegen dort etwa ſo, wie bei den Anfängen
des Alpenſports vor 50 bis 60 Jahren in der Schweiz. Unſer
untenſtehendes Bild verſetzt den Beſchauer auf den Gipfel des
höchſten Berges Norwegens, des Galdhöpig in Jotunheim,
der 2560 Meter über das Meer ſich erhebt. Man geht von
Röishjem (Röishem) aus in 8 bis 9 Stunden hinguf, und
in 6 bis 7 zurück. Man hat von der Höhe aus, auf der eine
kleine Schutzhütte wegen der häufig dort oben tobenden Schnee-
ſtürme ſteht, eine gewaltige Rundſicht auf die Eis-, Schuee-
und Felswüſte von Jotunheim. Nirgends erreicht der Blick
ein bewohntes Thal. Einſam ſteht man droben in großartiger
Oede; nur der blaue Spiegel des Sognefjords, der bei hellem
Wetter von ferne heraufblinkt, gibt dem Bilde etwas Leben.
Der Liebesbrief.
Siehe das Bild auf Seite 53.)
7 und von wem der erſte Brief geſchrieben oder in
Hieroglyphen gemalt worden ſei, daͤs bermag kein Ge-
lehrter zu ergründen. Ebenſo wird es wohl für alle Zeit in
Dunkel gehüllt bleiben, welche Schöne den erſten Liebesbrief
empfing, und auch bezüglich des Materials, worauf er ge-
ſchrieben geweſen ſein mag, läßt ſich nichts Sicheres feſtſtellen.
Wir haben da die Auswähl zwifchen wachsüberzogenen Holz-
oder Steintafeln, zwiſchen Leinwand, Pergament oder dem
von den Egyptern aus der Paphrusſtaude gefertigten Schreib-
material. Heutzutage macht man bekanntlich Papiex aus
Lumpen, Stroh, Holz und wer weiß was ſonſt noch, aber bei
einem Liebesbriefe kommt es auch ganz und gar nicht auf
das Material, ſondern nur auf den Inhalt an. Es iſt mit
aller Beſtimmtheit anzunehmen, daß die Augen einer Tochter
des Nillandes oder einer Chineſin, wie einer Griechin oder
Römerin, die vor ſo und ſo viel Jaͤhrhundexten ein derartiges
Briefchen, gleichviel aus welchem Material, empfing, wenn
ſie überhaußt leſen konnte, genau ſo geleuchtet haben, wie
die der modernen Italienerin, die uns F. Andreotti auf
ſeinem von uns S. 53 in Holzſchnitt wiedergegebenen Bild
zeigt. Soeben hat ſie die Lektüre des Liebesbriefes beendet
und ſcheint jetzt über ſeinen Inhalt nachzuſinnen. Sollte das
Briefchen etwa von einem Verehrer herrühren, der noch nicht
den Muth gehabt hat, ſeine Gefühle mündlich kundzugeben, ſo
darf er wegen des Erfolges ganz beruhigt ſein: das leſen
wir deutlich in dem niedlidhen Geſicht, dem das kokette
Häubchen auf dem dunklen Haar ſo reizend fteht.
Die Maja oder Lrühlingsfeier in Ferbien.
Siehe das Bild auf Seite 55.) 2*
n altheidniſcher Zeit pflegte man bei gewiſſen Feſten im
Frühjahr Bäumchen oder Strohpuppen als Bilder der zur
Feſttheilnahme erſchienenen Geiſter dex Verſtorbenen aufzu-
fleilen. Ein derartiges Symbol wurde dann auch ſelbſtTod“
Geiſt, von dem man glaubte, daß er ſich bei ihm niederlaſſe,
aus dem Todtenbereiche, es war ja die Seele eines der Todten
oder der Hauptſache nach alſo dieſer ſelbſt, und dann glaubte
man, daß Krankheit und Tod des Menſchen von dem Ein-
fluſſe dieſor Geiſter herrührten, indem immer wieder die Voran-
gegangenen es wären, welche die Ueberlebenden nach ſich
Lebenden zum Tode! wurde. Man konnte alſo wohl ſagen,
daß man bei Feſtzeiten im Bilde den Tod aufſtellte. War
nun das Feſt vorbei, ſo konnte man glauben, die Geiſter am
ſicherſten an ihre Ruheorte wieder zurückzubringen, wenn man
jenes Bild des ‚Todes dahin brachte“ Man grub es daher
entweder ‚in die Erde, oder man verbrannte es, oder warf es
in's Waſſer. So iſt das „Faſchingsbegraben! entſtanden und
der noch vielfach im Schwange befindliche Brauch des „Tod-
austragens“ oder „Todaustreibens“, wofür man in manchen
Gegenden auch das „Winteraustreiben“ als Frühlingsfeſt hat-
Der „Winter“ iſt nämlich in chriſtlicher Zeit, als die Geiſt-
lichkeit die heidniſchen Bräuche nicht mehr dulden wollte, an
diẽ Stelle des „Todes“ getreten, um ungeſtraft das alte, lieb-
gewordene Feſt beibehallen zu können, und im Laufe der geit
iſt dann meiſt ein wirkliches Frühlingsfeſt, zu dem die
Jahreszeit den Anlaß bot, daraus geworden. Gewöhnlich
wird in dem Spiel auch der Frühling oder Sommer als
der Widerpart des Winters genannt, mitunter firden wir
aber auch noch die urſprünglichen Namen beibehalten. So
heißt bei den Tſchechen der Tuszutreibende Smrt (Tod) oder
Morena (Hellja, Geſpenſt), bei den Slopenen ebenſo, ſonſt
noch Muriena oder Ma-murienda. In Serbien iſt an Stelle
des „Todaustragens“ die Feier der Maja als Frühlingsfeſt
getreten. Man fertigt eine Puppe aus Maisſtroh und wirft
ſie unter allgemeinem Jubel in's Waſſer. Die Kinder machen
dazu einen möglichſt großen Lärm auf X“ - ornen und eiſernen
Geſchirren und Inſtrumenten, un? * A war?
den heiligen Jeremias, deſſen Feſt auf den 1. Mai fällt,
bitten, er möge alle Schlangen in's Meer treiben Der Lärm
der Kinder ſoll die böſen Geiſter vertreiben; die Puppe aber
wird als Sinnbild des Winters angeſehen, ſo daß offenbar
die Erinnerung an die urſprüngliche Bedeutung ganz verloren
gegangen iſt. Die Feier der Maja wird namentlich in Alt-
CTürkiſch⸗)Serbien regelmäßig in der vorſtehend geſchilderten
Weiſe begangen.
der Kanpf gegen den Fortfehritt,
Beitgemäße Betrachtung von Alr. Maers.
* Nachdruck verboten.)
ur im ewigen Wechſel der Erſcheinungen beſteht
M das Leben, beſteht die Welt. Unaufhörlich tritt
Neues an Stelle des Alten, des Abgelebten,
und Stillſtand wäre Tod. Viele Leute abex begreifen
das nicht. Starr hängen ſie am Hergebrachten, jeder
noch ſo ſegensreichen, noch ſo nothwendigen Neuexung
ſetzen ſie zähen Widerſtand entgegen Nur durch hart-
näckigen Kampf vermag ſich das Beſſere Bahn zu brechen.
So war es von jeher, ſo iſt es noch heute.
Wir leben im Zeitalter der Erfindungen; die kurze
ſeins, die uns zugemeſſen iſt, fällt in
Das Buch für Alle.
heft L.
Aus Jotunheim.
Siehe die untenſtehende Abbildung)
iſt eine ungeheure Hochfläche, deren Ränder ſteil
nach dem Meere zu abfallen. So nialeriſch nun auch dieſer
Steilabfaͤll iſt, geſehen von den zahlreichen Buchten und lang-
geſtreckten, tief in's Land eindringenden Fjorden, ſo ſehr
iſt man enttäuſcht, wenn man dieſe Berge erklimmt und
ſich alsbald auf einer ungeheuren, vegetationsloſen, öden
Ebene befindet, über welche hier und da eine etwas höhere
Kuppe emporraat. Nur zwei Landſchaften gibt es in Nor-
wegen, wo die Gebirgsbildung der unſerer Alpen ähnlich
iſt! die eine am Lyngenfjord, die andere am Sognefjord.
Einſt mit abergläubiſcher Scheu gemieden als die Wohnſitze
der Joten, der Reif- und Froſtrieſen der nordiſchen Götterlehre,
wurden die Letzteren erſt im Jahre 1520 von Keilhau gleichſam
entdeckt und don ihm Jotunfjeldene, d. h. Rieſenberge, ge-
nannt. Die norwegiſchen Bergſteiger aber, die ſich alsbald
vom Sognefjord aus in dieſe Cis:, Schnee- und Felswüſte
vorwagten, nannten ſie Jotunhétm, und dieſer Name hat ſich
eingebürgert. In Jotunheim finden wir die höchſten Er-
hebungen Nordeuropas; ſelbſt die Hochflächen zwiſchen den
einzelnen Gipfeln ſind das ganze Jahr mit Schnee bedeckt;
mächtige Gleiſcher ſenken ſich von ihnen herab, und die Gipfel
ſelbft flürzen, nach einer Seite wenigſtens, ſtets außerordentlich
jäh zur Tiefe ab. Der norwegiſche Touriſtenverein hat ſich
feit dem Jahre 1868 um die Erſchließung dieſes Gebietes ſehr
verdient gemacht, Wege gebahnt, Brücken und Stege gehaut,
Unterkunftshütlen errichtet und zuverläſſige Führer angeſtellt,
ſo daß ein ausdauernder und gut ausgerüſteter Vergſteiger
jetzt ſelbſt die höchſten Gipfel Rieſenheims, den Glittertind
und den Galdhöpig, mit einem nicht allzugroßen Aufwand
von Zeit, Kraft und Geld zu erreichen vermag. Immerhin
ſind Touren in Jotunheim keine Kleinigkeit, und nur für
fehr abgehärtete, kräftige und genügſame Leute ein Genuß;
die Verhältniſſe liegen dort etwa ſo, wie bei den Anfängen
des Alpenſports vor 50 bis 60 Jahren in der Schweiz. Unſer
untenſtehendes Bild verſetzt den Beſchauer auf den Gipfel des
höchſten Berges Norwegens, des Galdhöpig in Jotunheim,
der 2560 Meter über das Meer ſich erhebt. Man geht von
Röishjem (Röishem) aus in 8 bis 9 Stunden hinguf, und
in 6 bis 7 zurück. Man hat von der Höhe aus, auf der eine
kleine Schutzhütte wegen der häufig dort oben tobenden Schnee-
ſtürme ſteht, eine gewaltige Rundſicht auf die Eis-, Schuee-
und Felswüſte von Jotunheim. Nirgends erreicht der Blick
ein bewohntes Thal. Einſam ſteht man droben in großartiger
Oede; nur der blaue Spiegel des Sognefjords, der bei hellem
Wetter von ferne heraufblinkt, gibt dem Bilde etwas Leben.
Der Liebesbrief.
Siehe das Bild auf Seite 53.)
7 und von wem der erſte Brief geſchrieben oder in
Hieroglyphen gemalt worden ſei, daͤs bermag kein Ge-
lehrter zu ergründen. Ebenſo wird es wohl für alle Zeit in
Dunkel gehüllt bleiben, welche Schöne den erſten Liebesbrief
empfing, und auch bezüglich des Materials, worauf er ge-
ſchrieben geweſen ſein mag, läßt ſich nichts Sicheres feſtſtellen.
Wir haben da die Auswähl zwifchen wachsüberzogenen Holz-
oder Steintafeln, zwiſchen Leinwand, Pergament oder dem
von den Egyptern aus der Paphrusſtaude gefertigten Schreib-
material. Heutzutage macht man bekanntlich Papiex aus
Lumpen, Stroh, Holz und wer weiß was ſonſt noch, aber bei
einem Liebesbriefe kommt es auch ganz und gar nicht auf
das Material, ſondern nur auf den Inhalt an. Es iſt mit
aller Beſtimmtheit anzunehmen, daß die Augen einer Tochter
des Nillandes oder einer Chineſin, wie einer Griechin oder
Römerin, die vor ſo und ſo viel Jaͤhrhundexten ein derartiges
Briefchen, gleichviel aus welchem Material, empfing, wenn
ſie überhaußt leſen konnte, genau ſo geleuchtet haben, wie
die der modernen Italienerin, die uns F. Andreotti auf
ſeinem von uns S. 53 in Holzſchnitt wiedergegebenen Bild
zeigt. Soeben hat ſie die Lektüre des Liebesbriefes beendet
und ſcheint jetzt über ſeinen Inhalt nachzuſinnen. Sollte das
Briefchen etwa von einem Verehrer herrühren, der noch nicht
den Muth gehabt hat, ſeine Gefühle mündlich kundzugeben, ſo
darf er wegen des Erfolges ganz beruhigt ſein: das leſen
wir deutlich in dem niedlidhen Geſicht, dem das kokette
Häubchen auf dem dunklen Haar ſo reizend fteht.
Die Maja oder Lrühlingsfeier in Ferbien.
Siehe das Bild auf Seite 55.) 2*
n altheidniſcher Zeit pflegte man bei gewiſſen Feſten im
Frühjahr Bäumchen oder Strohpuppen als Bilder der zur
Feſttheilnahme erſchienenen Geiſter dex Verſtorbenen aufzu-
fleilen. Ein derartiges Symbol wurde dann auch ſelbſtTod“
Geiſt, von dem man glaubte, daß er ſich bei ihm niederlaſſe,
aus dem Todtenbereiche, es war ja die Seele eines der Todten
oder der Hauptſache nach alſo dieſer ſelbſt, und dann glaubte
man, daß Krankheit und Tod des Menſchen von dem Ein-
fluſſe dieſor Geiſter herrührten, indem immer wieder die Voran-
gegangenen es wären, welche die Ueberlebenden nach ſich
Lebenden zum Tode! wurde. Man konnte alſo wohl ſagen,
daß man bei Feſtzeiten im Bilde den Tod aufſtellte. War
nun das Feſt vorbei, ſo konnte man glauben, die Geiſter am
ſicherſten an ihre Ruheorte wieder zurückzubringen, wenn man
jenes Bild des ‚Todes dahin brachte“ Man grub es daher
entweder ‚in die Erde, oder man verbrannte es, oder warf es
in's Waſſer. So iſt das „Faſchingsbegraben! entſtanden und
der noch vielfach im Schwange befindliche Brauch des „Tod-
austragens“ oder „Todaustreibens“, wofür man in manchen
Gegenden auch das „Winteraustreiben“ als Frühlingsfeſt hat-
Der „Winter“ iſt nämlich in chriſtlicher Zeit, als die Geiſt-
lichkeit die heidniſchen Bräuche nicht mehr dulden wollte, an
diẽ Stelle des „Todes“ getreten, um ungeſtraft das alte, lieb-
gewordene Feſt beibehallen zu können, und im Laufe der geit
iſt dann meiſt ein wirkliches Frühlingsfeſt, zu dem die
Jahreszeit den Anlaß bot, daraus geworden. Gewöhnlich
wird in dem Spiel auch der Frühling oder Sommer als
der Widerpart des Winters genannt, mitunter firden wir
aber auch noch die urſprünglichen Namen beibehalten. So
heißt bei den Tſchechen der Tuszutreibende Smrt (Tod) oder
Morena (Hellja, Geſpenſt), bei den Slopenen ebenſo, ſonſt
noch Muriena oder Ma-murienda. In Serbien iſt an Stelle
des „Todaustragens“ die Feier der Maja als Frühlingsfeſt
getreten. Man fertigt eine Puppe aus Maisſtroh und wirft
ſie unter allgemeinem Jubel in's Waſſer. Die Kinder machen
dazu einen möglichſt großen Lärm auf X“ - ornen und eiſernen
Geſchirren und Inſtrumenten, un? * A war?
den heiligen Jeremias, deſſen Feſt auf den 1. Mai fällt,
bitten, er möge alle Schlangen in's Meer treiben Der Lärm
der Kinder ſoll die böſen Geiſter vertreiben; die Puppe aber
wird als Sinnbild des Winters angeſehen, ſo daß offenbar
die Erinnerung an die urſprüngliche Bedeutung ganz verloren
gegangen iſt. Die Feier der Maja wird namentlich in Alt-
CTürkiſch⸗)Serbien regelmäßig in der vorſtehend geſchilderten
Weiſe begangen.
der Kanpf gegen den Fortfehritt,
Beitgemäße Betrachtung von Alr. Maers.
* Nachdruck verboten.)
ur im ewigen Wechſel der Erſcheinungen beſteht
M das Leben, beſteht die Welt. Unaufhörlich tritt
Neues an Stelle des Alten, des Abgelebten,
und Stillſtand wäre Tod. Viele Leute abex begreifen
das nicht. Starr hängen ſie am Hergebrachten, jeder
noch ſo ſegensreichen, noch ſo nothwendigen Neuexung
ſetzen ſie zähen Widerſtand entgegen Nur durch hart-
näckigen Kampf vermag ſich das Beſſere Bahn zu brechen.
So war es von jeher, ſo iſt es noch heute.
Wir leben im Zeitalter der Erfindungen; die kurze
ſeins, die uns zugemeſſen iſt, fällt in