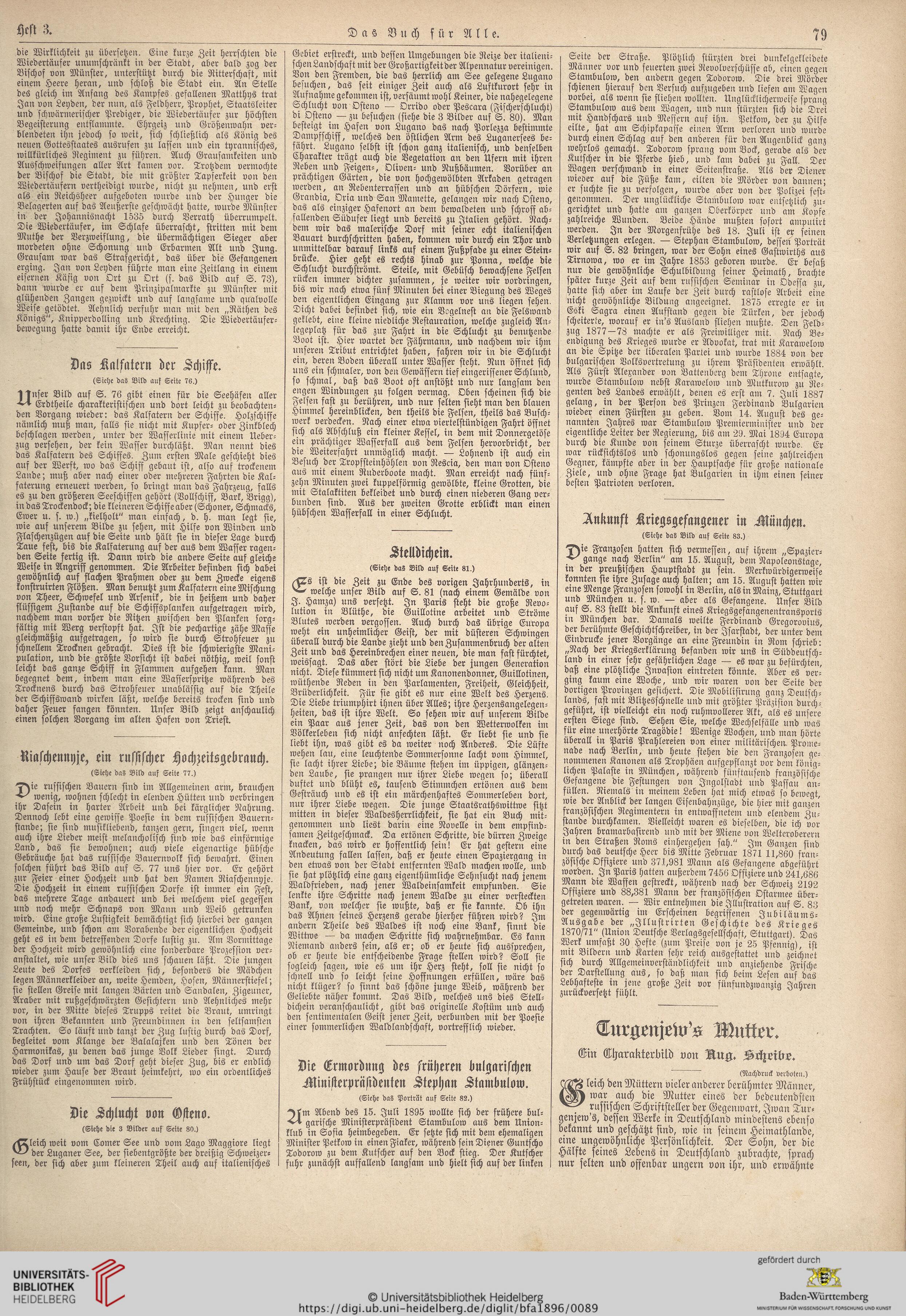geſt 3.
Das Buch für Alle.
79
die Wirklichkeit zu überſetzen. Eine kurze Zeit herrſchten die
Wiedertäufer unumſchränkt in der Stadt, aber bald zog der
Biſchof von Münſter, unterſtützt durch die Ritterſchaft, mit
einem Heere heran, und ſchloß die Stadt ein. An Stelle
des gleich im Anfang des Kampfes gefallenen Matthys trat
Jan von Leyden, der nun, als Feldherr, Prophet, Staatsleiter
und ſchwärmeriſcher Prediger, die Wiedertäufer zur höchſten
Begeiſterung entflammte. Ehrgeiz und Größenwahn ver-
blendeten ihn jedoch ſo weit, ſich ſchließlich als König des
neuen Gottesſtaates ausrufen zu laſſen und ein tyranniſches,
willkürliches Regiment zu führen. Auch Grauſamkeiten und
Ausſchweifungen aller Art kamen vor. Trotzdem vermochte
der Biſchof die Stadt, die mit größter Tapferkeit von den
Wiedertaͤufern vertheidigt wurde, nicht zu nehmen, und erſt
als ein Reichsheer aufgeboten wurdé und der Hunger die
Belagerten auf das Aeußerſte geſchwächt hatte, wurde Münfter
in der Johaͤnnisnacht 1535 durch Verrath überrumpelt.
Die Wiedertäufer, im Schlafe überraſcht, ſiritten mit dem
Muthe der Verzweiflung, die übermächtigen Sieger aber
mordeten ohne Schonung und Erbarmen Alt und Jung.
Grauſam war das Strafgericht, das über die Gefangenen
erging. Jan von Leyden führte man eine Zeitlang in einem
eiſernen Käfig von Ort zu Ort (ſ. das Bild auf S. 73),
dann wurde er auf dem Prinzipalmarkte zu Münſter mit
gläͤhenden Zangen gezwickt und auf langſame und qualvolle
Veiſe getoͤdtet. Aehnlich verfuhr man mit den „Räthen des
Königs“, Knipperdolling und Krechting. Die Wiedertäufer-
bewegung hatte damit ihr Ende erreichl.
Das Kalfakern der Schiffe.
(Siche das Bild auf Seite 76.)
1 Bild auf S. 76 gibt einen für die Seehäfen aller
Erdtheile charakteriſtiſchen und dort leicht zu beobachten-
den Vorgang wieder: das Kalfatern der Schiffe. Holzſchiffe
nämlich muß man, falls ſie nicht mit Kupfer- oder Zinkblech
beſchlagen werden, unter der Waſſerlinie mit einem Ueber?
zug verſehen, der kein Waſſer durchläßt. Man nennt dies
das Kalfatern des Schiffes. Zum erſten Male geſchieht dies
auf der Werft, wo das Schiff gebaut iſt, alſo auf trockenem
Lande; muß aber nach einer oder mehreren Fahrten die Kal-
faterung erneuert werden, ſo bringt man das Faͤhrzeug, falls
es zu den größeren Seeſchiffen gehoͤrt Gollſchiff, Bark, Brigg),
in das Trockendock; die kleineren Schiffe aber Schoner, Schmaͤcks,
Ewer u. ſ. w.) „kielholt“ man einfach, d. h. man legt ſie,
wie auf unſerem Bilde zu ſehen, mit Hilfe von Winden und
Flaſchenzügen auf die Seite und hält ſie in dieſer Lage durch
Taue feſt, bis die Kalfaterung auf der aus dem Waſſer ragen-
den Seite fertig iſt. Dann wird die andere Seite auf gleiche
Weiſe in Angriff genommen Die Arbeiter befinden ſich dabei
gewohnlich auf flachen Prahmen oder zu dem Zwecke eigens
konſtruirten Flößen. Man benutzt zum Kalfatern eine Miſchung
von Theer, Schwefel und Arſenil, die in heißem und daher
flüſſigem Zuſtande auf die Schiffsplanken aufgetragen wird,
nachdem man vorher die Ritzen zwiſchen den Planken ſorg-
fältig mit Werg verſtopft hat. Iſt die pechartige zähe Maffe
gleichmäßig aufgetragen, ſo wird ſie durch Strohfeuer zu
ſchnellem Trocknen gebracht. Dies iſt die ſchwierigfte Mani-
pulation, und die größte Vorſicht iſt dabei nöthig, weil ſonſt
leicht das ganze Schiff in Flammen aufgehen kann. Man
begegnet dem, indem man eine Waſſerſpritze während des
Trocknens durch das Strohfeuer unabläſſig auf die Theile
der Schiffswand wirken läßt, welche bereits trocken ſind und
daher Feuer fangen könnten. Unſer Bild zeigt anſchaulich
einen ſolchen Vorgang im alten Hafen von Trieſt.
Niaſchennyje, ein ruſſiſcher Hochzeitsgebrauch.
Siehe das Bild auf Seite 77.)
ie ruſſiſchen Bauern ſind im Allgemeinen arm, brauchen
wenig, wohnen ſchlecht in elenden Hütten und verbringen
ihr Daſein in harter Arbeit und bei kärglicher Nahrung.
Dennoch lebt eine gewiſſe Poeſie in dem ruſſiſchen Bauern-
ſtande; ſie ſind muſikliebend, kanzen gern, ſingen viel, wenn
auch ihre Lieder meiſt melancholiſch ſind wie das einförmige
Land, das ſie bewohnen; auch viele eigenartige hübſche
Bebräuche hat das ruſſiſche Bauernvolk ſich bewahrt. Einen
ſolchen führt das Bild auf S. 77 uns hier vor. Er gehört
zur Feier einer Hochzeit und hat den Namen Riaſchennyje.
Die Hochzeit in einem ruſſiſchen Dorfe iſt immer ein Feſt,
das mehrere Tage andauert und bei welchem viel gegeſſen
und noch mehr Schnaps von Mann und Weib getrunken
wird. Eine große Luſtigkeit bemächtigt ſich hierbei der ganzen
Gemeinde, und ſchon am Vorabende der eigentlichen Hochzeit
geht es in dem betreffenden Dorfe luſtig zu. Am Vormittage
der Hochzeit wird gewöhnlich eine ſonderbare Prozeſſion ver-
anſtaltet, wie unſer Bild dies uns ſchauen läßt. Die jungen
Leute des Dorfes verkleiden ſich, beſonders die Mädchen
legen Nännerkleider an, weite Hemden, Hoſen, Männerſtiefel;
ſie ſtellen Greiſe mit langen Bärten und Sandalen, Zigeuner,
Araber mit rußgeſchwärzten Geſichtern und Aehnliches mehr
vor, in der Mitte dieſes Trupps reitet die Braut, umringt
von ihren Bekannten und Freundinnen in den ſeltſamſten
Trachten. So läuft und tanzt der Zug luſtig durch das Dorf,
begleitet vom Klange der Balalafken und den Tönen der
Harmonikas, zu denen das junge Volk Lieder ſingt. Durch
das Dorf und um das Dorf geht dieſer Zug, bis er endlich
vieder zum Hauſe der Braut heimkehrt, wo ein ordentliches
Frühſtück eingenommen wird. ;
Die Schlucht von Gſteno.
(Siehe die 3 Bilder auf Seite 80.)
GF5 weit vom Comer See und vom Lago Maggiore liegt
der Luganer See, der ſiebentgrößte der dreißig Schweizer-
ſeen, der ſich aber zum kleineren Theil auch auf ĩtalieniſches
Gebiet erſtreckt, und deſſen Umgebungen die Reize der italieni-
ſchen Landſchaft mit der Großartigkeit der Alpennatur vereinigen.
Von den Fremden, die das herklich am See gelegene Lugaͤno
Lſuchen, das ſeit einiger Zeit auch als Luftkurort fehr in
Lufnahme gekonimen iſt, verfäumt wohl Keiner, die nahegelegene
Schlucht von Oſteno Orrido oder Pescara Giſcherſchluͤchh;
di Oſteno — zu beſuchen (fiehe die 3 Buͤder auf S. 80). Man
keſteigt im Hafen voͤn Lugaͤno das nach Porlezza beſtimmte
Dampfſchiff, welches den oͤſtlichen Arm des Luganerſees be:
fährt. Lugano ſelbſt iſt ſchon ganz italieniſch, und denſelben
Chgrakter trägt auch die Vegetätion an den Ufern mit ihren
Reben und Feigen-, Oliven! und Nußbäumen! Vorüber an
prächtigen Gärten, die von hochgewölbten Arkaden getragen
werden, an Rebenterraſſen und an hübſchen Dörfern, wie
Grandia, Oria und San Mamette, gelangen wir nach Oſteno,
das als einziger Hafenort an dem dewaldeten und ſchroff ab-
fallenden Südufer liegt und bereits zu Italien gehört. Hach-
dem wir das maleriſche Dorf mit' ſeiner echi italieniſchen
Bauart durchſchritten haben, kommen wir durch ein Thor und
unmittelbar darauf links auf einem Fußpfade zu einer Stein-
hrücke. Hier geht es rechts hinab zur Ponna, welche die
Schlucht durchſtrömt. Steile, mit Gebüſch bewachſene Felſen
rücken immer dichter zuſammen, je weiter wir vordringen,
bis wir nach etwa fünf Minuten bei einer Biegung des Weges
den eigentlichen Eingang zur Klamm vor uns üegen ſeheẽn.
Dicht dabei befindet fich, wie ein Vogelneſt an die Felswand
geklebt, eine kleine niedliche Reſtauration, welche zugleich An-
Egeplatz für das zur Fahrt in die Schlucht zu benutzende
Boot iſt. Hier wartet der Fährmann, und nachdem wir ihm
unſeren Tribut entrichtet häben, fahren wir in die Schlucht
ein, deren Boden überall unter Waffer ſteht. Nun öffnet ſich
uns ein ſchmaler, von den Gewäſſern kief eingeriſſener Schlund,
ſo ſchmal, daß das Boot oft änſtößt und nur langfam den
engen Windungen zu folgen vermag. Oben ſcheinen ſich die
Felſen faſt zu berühren, und nur ſelten ſieht man den blauen
Himmel hereinblicken, den theils die Felſen, theils das Buſch-
werk verdecken. Nach einer etwa vierlelſtündigen Fahrt öffnet
ſich als Abſchluß ein kleiner Keſſel, in dem mit Donnergetöſe
ein prächtiger Waſſerfall aus dem Felſen hervorbricht, der
die Weiterfahrt unmöglich macht. — Lohnend iſt auch ein
Beſuch der Tropfſteinhoͤhlen von Rescia, den man von Oſteno
aus mit einem Ruderboote macht. Man erreicht nach fünf-
zehn Winuten zwei kuppelförmig gewölbte, kleine Grotten, die
mit Stalaktiten hekleidet und durch einen niederen Gang ver-
bunden ſind. Aus der zweiten Grotte erblickt man einen
hübſchen Waſſerfall in einer Schlucht.
Stelldichein.
Siehe das Bild auf Seite 81.)
— iſt die Zeit zu Ende des vorigen Jahrhunderts, in
welche unſer Bild auf S. 81 (nach einem Gemälde von
J. Hamza) uns verſetzt. In Paris ſteht die große Revo-
lution in Blüthe, die Guillotine arbeitet und Ströme
Blutes werden vergoſſen. Auch durch das übrige Europa
weht ein unheimlicher Geiſt, der mit düſteren Schwingen
überall durch die Lande zieht und den Zuſammenbruch der alten
Zeit und das Hereinbrechen einer neuen, die man faſt fürchtet,
weisſagt. Das aber ſtört die Liebe der jungen Generation
nicht. Dieſe kümmert ſich nicht um Kanonendonner, Guillotinen,
wüthende Reden in den Farlamenten, Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit. Für ſie gibt es nur eine Welt des Herzens.
Die Liehe triumphirt ihnen über Alles; ihre Herzensangelegen-
heiten, das iſt ihre Welt. So ſehen wir auf unferem Bilde
ein Paar aus jener Zeit, das von den Wetterwolken im
Völkerleben ſich nicht anfechten läßt. Er liebt ſie und ſie
lieht ihn, was gibt es da weiter noch Anderes. Die Lüfte
wehen lau, eine leuchtende Sommerſonne lacht vom Himmel,
ſie lacht ihrer Liebe; die Bäume ſtehen im üppigen, glänzen:
den Laube, ſie prangen nur ihrer Liebe wegen ſo; überall
duftet und blüht es, tauſend Stimmchen erlönen aus dem
Geſträuch und es iſt ein märchenhaftes Sommerleben dort,
nur ihrer Liebe wegen. Die junge Staatsrathswittwe ſitzt
mitten in dieſer Waldesherrlichkeit, ſie hat ein Buch mit-
genommen und liest darin eine Novelle in dem empfind-
ſamen Zeitgeſchmack. Da ertönen Schritte, die dürren Zweige
knacken, das wird er hoffentlich ſein! Er hat geſtern eine
Andeutung fallen laſſen, daß er heute einen Spaͤziergang in
den etwas von der Stadt entfernten Wald machen wolle, Und
ſie hat plötzlich eine ganz eigenthümliche Sehnſucht nach jenem
Waldfrieden, nach jener Waldeinſamkeit empfunden. Sie
lenkte ihre Schritte nach jenem Walde zu einer verſteckten
Bank, von welcher ſie wußte, daß er ſie kannte. Ob ihn
das Ahnen ſeines Herzens gerade hierher führen wird? Im
andern Theile des Waldes iſt noch eine Bank, ſinnt die
Wittwe — da machen Schritte ſich wahrnehmbar. Es kann
Niemand anders ſein, als er; ob er heute ſich ausſprechen,
ob er heute die entſcheidende Frage ſtellen wird? Soll ſie
ſogleich ſagen, wie es um ihr Herz ſteht, ſoll ſie nicht ſo
ſchnell und ſo leicht ſeine Hoffnungen erfüllen, wäre das
nicht klüger? ſo ſinnt das ſchöne junge Weib, während der
Geliebte näher kommt. Das Bild, welches uns dies Stell-
dichein veranſchaulicht, gibt das originelle Koſtüm und auch
den ſentimentalen Geiſt jener Zeit, verbunden mit der Poeſie
einer ſommerlichen Waldlandſchaft, vortrefflich wieder.
Die Ermordung des früheren bulgariſchen
Miniſterpräſidenten Skephan Stambulow.
Siehe das Porträt auf Seite 82.)
A Abend des 15. Juli 1895 wollte ſich der frühere bul-
gariſche Miniſterpräſident Stambulow aus dem Union-
klub in Sofia heimbegeben. Er ſetzte ſich mit dem ehemaligen
Miniſter Petkow in einen Fiaker, während ſein Diener Guntſcho
Todorow zu dem Kutſcher auf den Bock ſtieg. Der Kutſcher
fuhr zunächſt auffallend langſam und hielt ſich auf der linken
Seite der Straße. Plötzlich ſtürzten drei dunkelgekleidete
Vänner vor und feuerten zwei Revolverſchüſſe ab, einen gegen
Stambulow, den andern gegen Todorow. Die drei Mörder
ſchienen hierauf den Verſuch aufzugeben und liefen am Wagen
vorbei, als wenn ſie fliehen wollten. Unglücklicherweiſe ſpraͤng
Stambulow aus dem Wagen, und nun ſtürzten ſich die Drei
mit Handſchars und Meſſern auf ihn. Petkow, der zu Hilfe
eilte, hat am Schipkapaſſe einen Arm verlorén und wurde
durch einen Schlag auf den anderen für den Augenblick ganz
wehrlos gemacht. Todorow ſprang vom Bock, gerade als der
Lutſcher in die Pferde hieb, und kam dabei zu Fal. Der
Wagen verſchwand in einer Seitenſtraße. Als der Diener
wieder auf die Füße kam, eilten die Mörder von dannen;
er ſuchte ſie zu verfolgen, wurde aber von der Polizei feſt-
genommen. Der unglückliche Stambulow war entſetzüch zu-
gerichtet und hatte am ganzen Oberkörper und am Kobfe
zahlreiche Wunden. Beide Hände mußten ſofort amputirt
werden. In der Morgenfrühe des 18. Juli iſt er feinen
Verletzungen erlegen. — Stephan Stambulow, deſſen Borträt
wir auf S. 82 bringen, war der Sohn eines Gaſtwirths aus
Tirnowa, wo er im Jahre 1853 geboren wurde. Er befaß
nur die gewöhnliche Schulbildung ſeiner Heimath, bracht?
ſpäter kurze Zeit auf dem ruſſiſchen Seminar in Odeſſa zu,
hatte ſich aber im Laufe der Zeit durch raſtloſe Arbeit eine
nicht Lwöhnliche Bildung angeeignet. 1875 erregte er in
Ssfi Sagra einen Aufſtand gegen die Türken, der jedoch
ſcheiterte, worauf er ins Ausland fliehen mußte! Den Feld-
zug 1877—73 machte er als Freiwilliger mit. Nach Be-
endigung des Krieges wurde er Advokat, trat mit Karawelow
an die Spitze der liberalen Partei und wurde 1884 von der
bulgarifchen Volkspertretung zu ihrem Präſidenten erwählt.
Als Füxſt Alexander von Battenberg dem Throne entfagte,
wurde Stambulow nebſt Karawelow und Mutkurow zu Ne-
genten des Landes erwählt, denen es erſt am 7. Suli 1887
gelang, in der Perſon des Prinzen Ferdinand Bulgarien
wieder einen Fürſten zu geben. Vom 14. Auguſt des ge-
nannten Jahres war Stambulow Premierminifter und der
eigentliche Leiter der Regierung, bis am 29. Mai 1894 Europa
durch die Kunde von ſeinem Sturze überraſcht wurde Er
war rückſichtslos und ſchonungslos gegen ſeine zahlreichen
Gegner, kämpfte aber in der Hauptſache für große nationale
beſten Patrioten verloren.
Ankunft Kriegsgefangener in Münthen.
Siehe das Bild auf Seite 83.)
Di Franzoſen hatten ſich vermeſſen, auf ihrem „Spazier-
gange nach Berlin“ am 15. Auguſt, dem Napoleonstage,
in der preußiſchen Hauptſtadt zu fein. Nerkwürdigerweiſe
konnten ſie ihre Zuſage auch halten; am 15. Auguſt halten wir
eine Menge Franzofen ſowohl in Berlin, als in Mainz, Stuttgart
und München u ſ. w. — aber als Gefangene. Unſer Bild
auf S. 83 ſtellt die Ankunft eines Kriegsgefangenentransports
in Nünchen dar. Damals weilte Ferdinand Gregorovius,
der berühmte Geſchichtſchreiber, in der Iſarſtadt, der unter dem
Eindrucke jener Vorgänge an eine Freundin in Rom ſchrieb:
„Nach der Kriegserklärung befanden wir uns in Süddeutſch-
land in einer ſehr gefährlichen Lage — es war zu befürchten,
daß eine plötzliche Invaſion eintreten könnte. Aber e& ver-
ging kaum eine Woche, und wir waren von der Seite der
dortigen Provinzen geſichert. Die Mobiliſirung ganz Deutſch-
landz, faſt mit Blitzesſchnelle und mit größter Präziſion durch-
geführt, iſt vielleicht ein noch ruhmvolerer Akt, als es unſere
erſten Siege ſind. Sehen Sie, welche Wechfelfälle und was
für eine unerhörte Tragödie! Wenigẽ Wochen, und man hörte
überall in Paris Prahlereien von einer militäriſchen Prome-
nade nach Berlin, und heute ſtehen die den Franzofen ge-
nommenen Fanonen als Trophäen aufgepflanzt vor dem könig-
lichen Palaſte in München, während fünftauſend franzöſiſche
Gefangene die Feſtungen von Ingolſtadt und Paſſau an-
füllen. Liemals in meinem Leben hat mich etwas ſo bewegt,
wie der Anblick der langen Eiſenbahnzüge, die hier mit ganzen
franzöſiſchen Regimentern in entwaͤffnetem und elendem Zu-
Jahren hramarbaſirend und mit der Miene von Welteroberern
in den Straßen Roms einhergehen ſah.“ Im Ganzen ſind
durch das deutſche Heer bis Mitte Februar 1871 11,860 fran-
zöſiſche Offiziere und 371,981 Mann als Gefangene abgeführt
worden, In Paris hatten außerdem 7456 Offiziere und 241,686
Mann die Waffen geſtreckt, während nach der Schweiz 2192
Offiztere und 88,381 Mann der franzöſiſchen Oftarmee über-
getreten waren. — Wir entnehmen die Illuſtration auf S, 83
der gegenwärtig im Erſcheinen begriffenen Subiläums:
Ausgahe der „Illuſtrirten Gefchichte des Krieges
1870/71” (Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft, Stuttgart). Das
mit Bildern und Karten ſehr reich ausgeftattet und zeichnet
ſich Ddurch Allgemeinverſtändlichkeit und anziehende Friſche
der Darſtellung aus, ſa daß man ſich beim Leſen auf das
Lebhafteſte in jene große Zeit vor fünfundzwanzig Jaͤhren
zurückverſetzt fühlt.
Turgenjew's Mutter.
Ein Charakkerbild von Kug. Scheibe.
Nachdruck verboten)
leich den Müttern vieler anderer berühmter Männer,
war auch die Mutter eines der bedeutendſten
ruſſiſchen Schriftſteller der Gegenwart, Iwan Tur-
ekannt und geſchätzt ſind, wie in ſeinem Heimathlande,
eine ungewöhnliche Perſönlichkeit. Der Sohn, der die
Hälfte ſeines Lebens in Deutſchland zubrachte, ſpraͤch
nur ſelten und offenbar ungern von ihr, und erwähntẽ
Das Buch für Alle.
79
die Wirklichkeit zu überſetzen. Eine kurze Zeit herrſchten die
Wiedertäufer unumſchränkt in der Stadt, aber bald zog der
Biſchof von Münſter, unterſtützt durch die Ritterſchaft, mit
einem Heere heran, und ſchloß die Stadt ein. An Stelle
des gleich im Anfang des Kampfes gefallenen Matthys trat
Jan von Leyden, der nun, als Feldherr, Prophet, Staatsleiter
und ſchwärmeriſcher Prediger, die Wiedertäufer zur höchſten
Begeiſterung entflammte. Ehrgeiz und Größenwahn ver-
blendeten ihn jedoch ſo weit, ſich ſchließlich als König des
neuen Gottesſtaates ausrufen zu laſſen und ein tyranniſches,
willkürliches Regiment zu führen. Auch Grauſamkeiten und
Ausſchweifungen aller Art kamen vor. Trotzdem vermochte
der Biſchof die Stadt, die mit größter Tapferkeit von den
Wiedertaͤufern vertheidigt wurde, nicht zu nehmen, und erſt
als ein Reichsheer aufgeboten wurdé und der Hunger die
Belagerten auf das Aeußerſte geſchwächt hatte, wurde Münfter
in der Johaͤnnisnacht 1535 durch Verrath überrumpelt.
Die Wiedertäufer, im Schlafe überraſcht, ſiritten mit dem
Muthe der Verzweiflung, die übermächtigen Sieger aber
mordeten ohne Schonung und Erbarmen Alt und Jung.
Grauſam war das Strafgericht, das über die Gefangenen
erging. Jan von Leyden führte man eine Zeitlang in einem
eiſernen Käfig von Ort zu Ort (ſ. das Bild auf S. 73),
dann wurde er auf dem Prinzipalmarkte zu Münſter mit
gläͤhenden Zangen gezwickt und auf langſame und qualvolle
Veiſe getoͤdtet. Aehnlich verfuhr man mit den „Räthen des
Königs“, Knipperdolling und Krechting. Die Wiedertäufer-
bewegung hatte damit ihr Ende erreichl.
Das Kalfakern der Schiffe.
(Siche das Bild auf Seite 76.)
1 Bild auf S. 76 gibt einen für die Seehäfen aller
Erdtheile charakteriſtiſchen und dort leicht zu beobachten-
den Vorgang wieder: das Kalfatern der Schiffe. Holzſchiffe
nämlich muß man, falls ſie nicht mit Kupfer- oder Zinkblech
beſchlagen werden, unter der Waſſerlinie mit einem Ueber?
zug verſehen, der kein Waſſer durchläßt. Man nennt dies
das Kalfatern des Schiffes. Zum erſten Male geſchieht dies
auf der Werft, wo das Schiff gebaut iſt, alſo auf trockenem
Lande; muß aber nach einer oder mehreren Fahrten die Kal-
faterung erneuert werden, ſo bringt man das Faͤhrzeug, falls
es zu den größeren Seeſchiffen gehoͤrt Gollſchiff, Bark, Brigg),
in das Trockendock; die kleineren Schiffe aber Schoner, Schmaͤcks,
Ewer u. ſ. w.) „kielholt“ man einfach, d. h. man legt ſie,
wie auf unſerem Bilde zu ſehen, mit Hilfe von Winden und
Flaſchenzügen auf die Seite und hält ſie in dieſer Lage durch
Taue feſt, bis die Kalfaterung auf der aus dem Waſſer ragen-
den Seite fertig iſt. Dann wird die andere Seite auf gleiche
Weiſe in Angriff genommen Die Arbeiter befinden ſich dabei
gewohnlich auf flachen Prahmen oder zu dem Zwecke eigens
konſtruirten Flößen. Man benutzt zum Kalfatern eine Miſchung
von Theer, Schwefel und Arſenil, die in heißem und daher
flüſſigem Zuſtande auf die Schiffsplanken aufgetragen wird,
nachdem man vorher die Ritzen zwiſchen den Planken ſorg-
fältig mit Werg verſtopft hat. Iſt die pechartige zähe Maffe
gleichmäßig aufgetragen, ſo wird ſie durch Strohfeuer zu
ſchnellem Trocknen gebracht. Dies iſt die ſchwierigfte Mani-
pulation, und die größte Vorſicht iſt dabei nöthig, weil ſonſt
leicht das ganze Schiff in Flammen aufgehen kann. Man
begegnet dem, indem man eine Waſſerſpritze während des
Trocknens durch das Strohfeuer unabläſſig auf die Theile
der Schiffswand wirken läßt, welche bereits trocken ſind und
daher Feuer fangen könnten. Unſer Bild zeigt anſchaulich
einen ſolchen Vorgang im alten Hafen von Trieſt.
Niaſchennyje, ein ruſſiſcher Hochzeitsgebrauch.
Siehe das Bild auf Seite 77.)
ie ruſſiſchen Bauern ſind im Allgemeinen arm, brauchen
wenig, wohnen ſchlecht in elenden Hütten und verbringen
ihr Daſein in harter Arbeit und bei kärglicher Nahrung.
Dennoch lebt eine gewiſſe Poeſie in dem ruſſiſchen Bauern-
ſtande; ſie ſind muſikliebend, kanzen gern, ſingen viel, wenn
auch ihre Lieder meiſt melancholiſch ſind wie das einförmige
Land, das ſie bewohnen; auch viele eigenartige hübſche
Bebräuche hat das ruſſiſche Bauernvolk ſich bewahrt. Einen
ſolchen führt das Bild auf S. 77 uns hier vor. Er gehört
zur Feier einer Hochzeit und hat den Namen Riaſchennyje.
Die Hochzeit in einem ruſſiſchen Dorfe iſt immer ein Feſt,
das mehrere Tage andauert und bei welchem viel gegeſſen
und noch mehr Schnaps von Mann und Weib getrunken
wird. Eine große Luſtigkeit bemächtigt ſich hierbei der ganzen
Gemeinde, und ſchon am Vorabende der eigentlichen Hochzeit
geht es in dem betreffenden Dorfe luſtig zu. Am Vormittage
der Hochzeit wird gewöhnlich eine ſonderbare Prozeſſion ver-
anſtaltet, wie unſer Bild dies uns ſchauen läßt. Die jungen
Leute des Dorfes verkleiden ſich, beſonders die Mädchen
legen Nännerkleider an, weite Hemden, Hoſen, Männerſtiefel;
ſie ſtellen Greiſe mit langen Bärten und Sandalen, Zigeuner,
Araber mit rußgeſchwärzten Geſichtern und Aehnliches mehr
vor, in der Mitte dieſes Trupps reitet die Braut, umringt
von ihren Bekannten und Freundinnen in den ſeltſamſten
Trachten. So läuft und tanzt der Zug luſtig durch das Dorf,
begleitet vom Klange der Balalafken und den Tönen der
Harmonikas, zu denen das junge Volk Lieder ſingt. Durch
das Dorf und um das Dorf geht dieſer Zug, bis er endlich
vieder zum Hauſe der Braut heimkehrt, wo ein ordentliches
Frühſtück eingenommen wird. ;
Die Schlucht von Gſteno.
(Siehe die 3 Bilder auf Seite 80.)
GF5 weit vom Comer See und vom Lago Maggiore liegt
der Luganer See, der ſiebentgrößte der dreißig Schweizer-
ſeen, der ſich aber zum kleineren Theil auch auf ĩtalieniſches
Gebiet erſtreckt, und deſſen Umgebungen die Reize der italieni-
ſchen Landſchaft mit der Großartigkeit der Alpennatur vereinigen.
Von den Fremden, die das herklich am See gelegene Lugaͤno
Lſuchen, das ſeit einiger Zeit auch als Luftkurort fehr in
Lufnahme gekonimen iſt, verfäumt wohl Keiner, die nahegelegene
Schlucht von Oſteno Orrido oder Pescara Giſcherſchluͤchh;
di Oſteno — zu beſuchen (fiehe die 3 Buͤder auf S. 80). Man
keſteigt im Hafen voͤn Lugaͤno das nach Porlezza beſtimmte
Dampfſchiff, welches den oͤſtlichen Arm des Luganerſees be:
fährt. Lugano ſelbſt iſt ſchon ganz italieniſch, und denſelben
Chgrakter trägt auch die Vegetätion an den Ufern mit ihren
Reben und Feigen-, Oliven! und Nußbäumen! Vorüber an
prächtigen Gärten, die von hochgewölbten Arkaden getragen
werden, an Rebenterraſſen und an hübſchen Dörfern, wie
Grandia, Oria und San Mamette, gelangen wir nach Oſteno,
das als einziger Hafenort an dem dewaldeten und ſchroff ab-
fallenden Südufer liegt und bereits zu Italien gehört. Hach-
dem wir das maleriſche Dorf mit' ſeiner echi italieniſchen
Bauart durchſchritten haben, kommen wir durch ein Thor und
unmittelbar darauf links auf einem Fußpfade zu einer Stein-
hrücke. Hier geht es rechts hinab zur Ponna, welche die
Schlucht durchſtrömt. Steile, mit Gebüſch bewachſene Felſen
rücken immer dichter zuſammen, je weiter wir vordringen,
bis wir nach etwa fünf Minuten bei einer Biegung des Weges
den eigentlichen Eingang zur Klamm vor uns üegen ſeheẽn.
Dicht dabei befindet fich, wie ein Vogelneſt an die Felswand
geklebt, eine kleine niedliche Reſtauration, welche zugleich An-
Egeplatz für das zur Fahrt in die Schlucht zu benutzende
Boot iſt. Hier wartet der Fährmann, und nachdem wir ihm
unſeren Tribut entrichtet häben, fahren wir in die Schlucht
ein, deren Boden überall unter Waffer ſteht. Nun öffnet ſich
uns ein ſchmaler, von den Gewäſſern kief eingeriſſener Schlund,
ſo ſchmal, daß das Boot oft änſtößt und nur langfam den
engen Windungen zu folgen vermag. Oben ſcheinen ſich die
Felſen faſt zu berühren, und nur ſelten ſieht man den blauen
Himmel hereinblicken, den theils die Felſen, theils das Buſch-
werk verdecken. Nach einer etwa vierlelſtündigen Fahrt öffnet
ſich als Abſchluß ein kleiner Keſſel, in dem mit Donnergetöſe
ein prächtiger Waſſerfall aus dem Felſen hervorbricht, der
die Weiterfahrt unmöglich macht. — Lohnend iſt auch ein
Beſuch der Tropfſteinhoͤhlen von Rescia, den man von Oſteno
aus mit einem Ruderboote macht. Man erreicht nach fünf-
zehn Winuten zwei kuppelförmig gewölbte, kleine Grotten, die
mit Stalaktiten hekleidet und durch einen niederen Gang ver-
bunden ſind. Aus der zweiten Grotte erblickt man einen
hübſchen Waſſerfall in einer Schlucht.
Stelldichein.
Siehe das Bild auf Seite 81.)
— iſt die Zeit zu Ende des vorigen Jahrhunderts, in
welche unſer Bild auf S. 81 (nach einem Gemälde von
J. Hamza) uns verſetzt. In Paris ſteht die große Revo-
lution in Blüthe, die Guillotine arbeitet und Ströme
Blutes werden vergoſſen. Auch durch das übrige Europa
weht ein unheimlicher Geiſt, der mit düſteren Schwingen
überall durch die Lande zieht und den Zuſammenbruch der alten
Zeit und das Hereinbrechen einer neuen, die man faſt fürchtet,
weisſagt. Das aber ſtört die Liebe der jungen Generation
nicht. Dieſe kümmert ſich nicht um Kanonendonner, Guillotinen,
wüthende Reden in den Farlamenten, Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit. Für ſie gibt es nur eine Welt des Herzens.
Die Liehe triumphirt ihnen über Alles; ihre Herzensangelegen-
heiten, das iſt ihre Welt. So ſehen wir auf unferem Bilde
ein Paar aus jener Zeit, das von den Wetterwolken im
Völkerleben ſich nicht anfechten läßt. Er liebt ſie und ſie
lieht ihn, was gibt es da weiter noch Anderes. Die Lüfte
wehen lau, eine leuchtende Sommerſonne lacht vom Himmel,
ſie lacht ihrer Liebe; die Bäume ſtehen im üppigen, glänzen:
den Laube, ſie prangen nur ihrer Liebe wegen ſo; überall
duftet und blüht es, tauſend Stimmchen erlönen aus dem
Geſträuch und es iſt ein märchenhaftes Sommerleben dort,
nur ihrer Liebe wegen. Die junge Staatsrathswittwe ſitzt
mitten in dieſer Waldesherrlichkeit, ſie hat ein Buch mit-
genommen und liest darin eine Novelle in dem empfind-
ſamen Zeitgeſchmack. Da ertönen Schritte, die dürren Zweige
knacken, das wird er hoffentlich ſein! Er hat geſtern eine
Andeutung fallen laſſen, daß er heute einen Spaͤziergang in
den etwas von der Stadt entfernten Wald machen wolle, Und
ſie hat plötzlich eine ganz eigenthümliche Sehnſucht nach jenem
Waldfrieden, nach jener Waldeinſamkeit empfunden. Sie
lenkte ihre Schritte nach jenem Walde zu einer verſteckten
Bank, von welcher ſie wußte, daß er ſie kannte. Ob ihn
das Ahnen ſeines Herzens gerade hierher führen wird? Im
andern Theile des Waldes iſt noch eine Bank, ſinnt die
Wittwe — da machen Schritte ſich wahrnehmbar. Es kann
Niemand anders ſein, als er; ob er heute ſich ausſprechen,
ob er heute die entſcheidende Frage ſtellen wird? Soll ſie
ſogleich ſagen, wie es um ihr Herz ſteht, ſoll ſie nicht ſo
ſchnell und ſo leicht ſeine Hoffnungen erfüllen, wäre das
nicht klüger? ſo ſinnt das ſchöne junge Weib, während der
Geliebte näher kommt. Das Bild, welches uns dies Stell-
dichein veranſchaulicht, gibt das originelle Koſtüm und auch
den ſentimentalen Geiſt jener Zeit, verbunden mit der Poeſie
einer ſommerlichen Waldlandſchaft, vortrefflich wieder.
Die Ermordung des früheren bulgariſchen
Miniſterpräſidenten Skephan Stambulow.
Siehe das Porträt auf Seite 82.)
A Abend des 15. Juli 1895 wollte ſich der frühere bul-
gariſche Miniſterpräſident Stambulow aus dem Union-
klub in Sofia heimbegeben. Er ſetzte ſich mit dem ehemaligen
Miniſter Petkow in einen Fiaker, während ſein Diener Guntſcho
Todorow zu dem Kutſcher auf den Bock ſtieg. Der Kutſcher
fuhr zunächſt auffallend langſam und hielt ſich auf der linken
Seite der Straße. Plötzlich ſtürzten drei dunkelgekleidete
Vänner vor und feuerten zwei Revolverſchüſſe ab, einen gegen
Stambulow, den andern gegen Todorow. Die drei Mörder
ſchienen hierauf den Verſuch aufzugeben und liefen am Wagen
vorbei, als wenn ſie fliehen wollten. Unglücklicherweiſe ſpraͤng
Stambulow aus dem Wagen, und nun ſtürzten ſich die Drei
mit Handſchars und Meſſern auf ihn. Petkow, der zu Hilfe
eilte, hat am Schipkapaſſe einen Arm verlorén und wurde
durch einen Schlag auf den anderen für den Augenblick ganz
wehrlos gemacht. Todorow ſprang vom Bock, gerade als der
Lutſcher in die Pferde hieb, und kam dabei zu Fal. Der
Wagen verſchwand in einer Seitenſtraße. Als der Diener
wieder auf die Füße kam, eilten die Mörder von dannen;
er ſuchte ſie zu verfolgen, wurde aber von der Polizei feſt-
genommen. Der unglückliche Stambulow war entſetzüch zu-
gerichtet und hatte am ganzen Oberkörper und am Kobfe
zahlreiche Wunden. Beide Hände mußten ſofort amputirt
werden. In der Morgenfrühe des 18. Juli iſt er feinen
Verletzungen erlegen. — Stephan Stambulow, deſſen Borträt
wir auf S. 82 bringen, war der Sohn eines Gaſtwirths aus
Tirnowa, wo er im Jahre 1853 geboren wurde. Er befaß
nur die gewöhnliche Schulbildung ſeiner Heimath, bracht?
ſpäter kurze Zeit auf dem ruſſiſchen Seminar in Odeſſa zu,
hatte ſich aber im Laufe der Zeit durch raſtloſe Arbeit eine
nicht Lwöhnliche Bildung angeeignet. 1875 erregte er in
Ssfi Sagra einen Aufſtand gegen die Türken, der jedoch
ſcheiterte, worauf er ins Ausland fliehen mußte! Den Feld-
zug 1877—73 machte er als Freiwilliger mit. Nach Be-
endigung des Krieges wurde er Advokat, trat mit Karawelow
an die Spitze der liberalen Partei und wurde 1884 von der
bulgarifchen Volkspertretung zu ihrem Präſidenten erwählt.
Als Füxſt Alexander von Battenberg dem Throne entfagte,
wurde Stambulow nebſt Karawelow und Mutkurow zu Ne-
genten des Landes erwählt, denen es erſt am 7. Suli 1887
gelang, in der Perſon des Prinzen Ferdinand Bulgarien
wieder einen Fürſten zu geben. Vom 14. Auguſt des ge-
nannten Jahres war Stambulow Premierminifter und der
eigentliche Leiter der Regierung, bis am 29. Mai 1894 Europa
durch die Kunde von ſeinem Sturze überraſcht wurde Er
war rückſichtslos und ſchonungslos gegen ſeine zahlreichen
Gegner, kämpfte aber in der Hauptſache für große nationale
beſten Patrioten verloren.
Ankunft Kriegsgefangener in Münthen.
Siehe das Bild auf Seite 83.)
Di Franzoſen hatten ſich vermeſſen, auf ihrem „Spazier-
gange nach Berlin“ am 15. Auguſt, dem Napoleonstage,
in der preußiſchen Hauptſtadt zu fein. Nerkwürdigerweiſe
konnten ſie ihre Zuſage auch halten; am 15. Auguſt halten wir
eine Menge Franzofen ſowohl in Berlin, als in Mainz, Stuttgart
und München u ſ. w. — aber als Gefangene. Unſer Bild
auf S. 83 ſtellt die Ankunft eines Kriegsgefangenentransports
in Nünchen dar. Damals weilte Ferdinand Gregorovius,
der berühmte Geſchichtſchreiber, in der Iſarſtadt, der unter dem
Eindrucke jener Vorgänge an eine Freundin in Rom ſchrieb:
„Nach der Kriegserklärung befanden wir uns in Süddeutſch-
land in einer ſehr gefährlichen Lage — es war zu befürchten,
daß eine plötzliche Invaſion eintreten könnte. Aber e& ver-
ging kaum eine Woche, und wir waren von der Seite der
dortigen Provinzen geſichert. Die Mobiliſirung ganz Deutſch-
landz, faſt mit Blitzesſchnelle und mit größter Präziſion durch-
geführt, iſt vielleicht ein noch ruhmvolerer Akt, als es unſere
erſten Siege ſind. Sehen Sie, welche Wechfelfälle und was
für eine unerhörte Tragödie! Wenigẽ Wochen, und man hörte
überall in Paris Prahlereien von einer militäriſchen Prome-
nade nach Berlin, und heute ſtehen die den Franzofen ge-
nommenen Fanonen als Trophäen aufgepflanzt vor dem könig-
lichen Palaſte in München, während fünftauſend franzöſiſche
Gefangene die Feſtungen von Ingolſtadt und Paſſau an-
füllen. Liemals in meinem Leben hat mich etwas ſo bewegt,
wie der Anblick der langen Eiſenbahnzüge, die hier mit ganzen
franzöſiſchen Regimentern in entwaͤffnetem und elendem Zu-
Jahren hramarbaſirend und mit der Miene von Welteroberern
in den Straßen Roms einhergehen ſah.“ Im Ganzen ſind
durch das deutſche Heer bis Mitte Februar 1871 11,860 fran-
zöſiſche Offiziere und 371,981 Mann als Gefangene abgeführt
worden, In Paris hatten außerdem 7456 Offiziere und 241,686
Mann die Waffen geſtreckt, während nach der Schweiz 2192
Offiztere und 88,381 Mann der franzöſiſchen Oftarmee über-
getreten waren. — Wir entnehmen die Illuſtration auf S, 83
der gegenwärtig im Erſcheinen begriffenen Subiläums:
Ausgahe der „Illuſtrirten Gefchichte des Krieges
1870/71” (Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft, Stuttgart). Das
mit Bildern und Karten ſehr reich ausgeftattet und zeichnet
ſich Ddurch Allgemeinverſtändlichkeit und anziehende Friſche
der Darſtellung aus, ſa daß man ſich beim Leſen auf das
Lebhafteſte in jene große Zeit vor fünfundzwanzig Jaͤhren
zurückverſetzt fühlt.
Turgenjew's Mutter.
Ein Charakkerbild von Kug. Scheibe.
Nachdruck verboten)
leich den Müttern vieler anderer berühmter Männer,
war auch die Mutter eines der bedeutendſten
ruſſiſchen Schriftſteller der Gegenwart, Iwan Tur-
ekannt und geſchätzt ſind, wie in ſeinem Heimathlande,
eine ungewöhnliche Perſönlichkeit. Der Sohn, der die
Hälfte ſeines Lebens in Deutſchland zubrachte, ſpraͤch
nur ſelten und offenbar ungern von ihr, und erwähntẽ