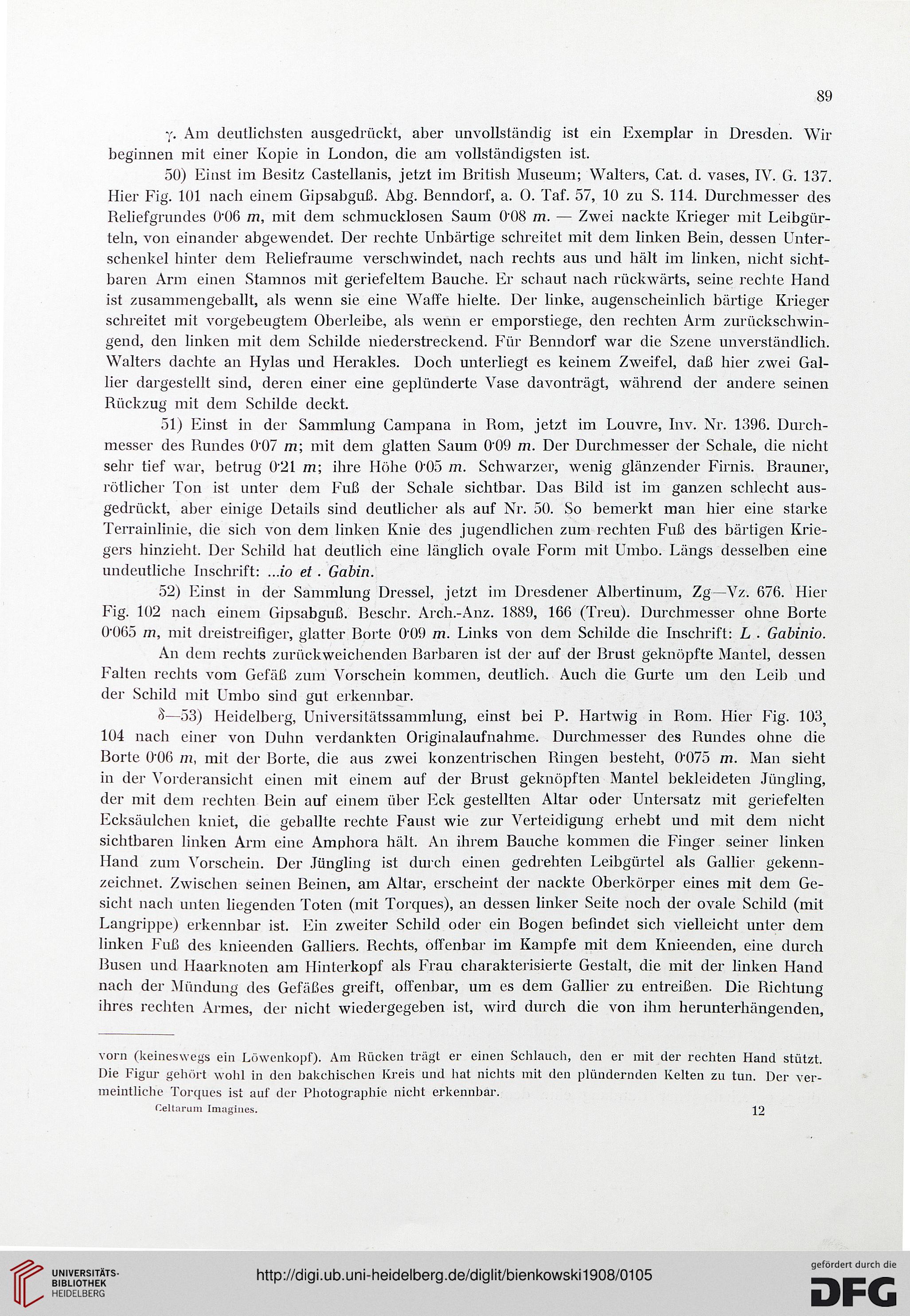89
v. Am deutlichsten ausgedrückt, aber unvollständig ist ein Exemplar in Dresden. Wir
beginnen mit einer Kopie in London, die am vollständigsten ist.
50) Einst im Besitz Castellanis, jetzt im British Museum; Walters, Cat. d. vases, IV. G. 137.
Hier Fig. 101 nach einem Gipsabguß. Abg. Benndorf, a. 0. Taf. 57, 10 zu S. 114. Durchmesser des
Reliefgrundes 0'06 m, mit dem schmucklosen Saum 0'08 m. — Zwei nackte Krieger mit Leibgür-
teln, von einander abgewendet. Der rechte Unbärtige schreitet mit dem linken Bein, dessen Unter-
schenkel hinter dem Reliefraume verschwindet, nach rechts aus und hält im linken, nicht sicht-
baren Arm einen Stamnos mit geriefeltem Bauche. Er schaut nach rückwärts, seine rechte Hand
ist zusammengeballt, als wenn sie eine Waffe hielte. Der linke, augenscheinlich bärtige Krieger
schreitet mit vorgebeugtem Oberleibe, als wenn er emporstiege, den rechten Arm zurückschwin-
gend, den linken mit dem Schilde niederstreckend. Für Benndorf war die Szene unverständlich.
Walters dachte an Hylas und Herakles. Doch unterliegt es keinem Zweifel, daß hier zwei Gal-
lier dargestellt sind, deren einer eine geplünderte Vase davonträgt, während der andere seinen
Bückzug mit dem Schilde deckt.
51) Einst in der Sammlung Campana in Rom, jetzt im Louvre, Inv. Nr. 1396. Durch-
messer des Rundes 0'07 m; mit dem glatten Saum 0 09 m. Der Durchmesser der Schale, die nicht
sehr tief war, betrug 0'21 m; ihre Höhe 0"05 in. Schwarzer, wenig glänzender Firnis. Brauner,
rötlicher Ton ist unter dem Fuß der Schale sichtbar. Das Bild ist im ganzen schlecht aus-
gedrückt, aber einige Details sind deutlicher als auf Nr. 50. So bemerkt man hier eine starke
Terrainlinie, die sich von dem linken Knie des jugendlichen zum rechten Fuß des bärtigen Krie-
gers hinzieht. Der Schild hat deutlich eine länglich ovale Form mit Umbo. Längs desselben eine
undeutliche Inschrift: ...io et . Gabin.
52) Einst in der Sammlung Dressel, jetzt im Dresdener Albertinum, Zg Vz. 676. Hier
Fig. 102 nach einem Gipsabguß. Beschr. Arch.-Anz. 1889, 166 (Treu). Durchmesser ohne Borte
0'065 m, mit dreistreifiger, glatter Borte 0'09 m. Links von dem Schilde die Inschrift: L . Gabinio.
An dem rechts zurückweichenden Barbaren ist der auf der Brust geknöpfte Mantel, dessen
Falten rechts vom Gefäß zum Vorschein kommen, deutlich. Auch die Gurte um den Leib und
der Schild mit Umbo sind gut erkennbar.
S—53) Heidelberg, Universitätssammlung, einst bei P. Hartwig in Born. Hier Fig. 103^
104 nach einer von Duhn verdankten Originalaufnahme. Durchmesser des Rundes ohne die
Borte 0"06 m, mit der Borte, die aus zwei konzentrischen Ringen besteht, 0-075 m. Man sieht
in der Vorderansicht einen mit einem auf der Brust geknöpften Mantel bekleideten Jüngling,
der mit dem rechten Bein auf einem über Eck gestellten Altar oder Untersatz mit geriefelten
Ecksäulchen kniet, die geballte rechte Faust wie zur Verteidigung erhebt und mit dem nicht
sichtbaren linken Arm eine Amphora hält. An ihrem Bauche kommen die Finger seiner linken
Hand zum Vorschein. Der Jüngling ist durch einen gedrehten Leibgürtel als Gallier gekenn-
zeichnet. Zwischen seinen Beinen, am Altar, erscheint der nackte Oberkörper eines mit dem Ge-
sicht nach unten liegenden Toten (mit Torques), an dessen linker Seite noch der ovale Schild (mit
Langrippe) erkennbar ist. Ein zweiter Schild oder ein Bogen befindet sich vielleicht unter dem
linken Fuß des knieenden Galliers. Rechts, olfenbar im Kampfe mit dem Knieenden, eine durch
Busen und Haarknoten am Hinterkopf als Frau charakterisierte Gestalt, die mit der linken Hand
nach der Mündung des Gefäßes greift, offenbar, um es dem Gallier zu entreißen. Die Richtung
ihres rechten Armes, der nicht wiedergegeben ist, wird durch die von ihm herunterhängenden,
vorn (keineswegs ein Löwenkopf'). Am Rücken trägt er einen Schlauch, den er mit der rechten Hand stützt.
Die Figur gehört wohl in den bakchischen Kreis und hat nichts mit den plündernden Kelten zu tun. Der ver-
meintliche Torques ist auf der Photographie nicht erkennbar.
Celtaruni Imagiues. 12
v. Am deutlichsten ausgedrückt, aber unvollständig ist ein Exemplar in Dresden. Wir
beginnen mit einer Kopie in London, die am vollständigsten ist.
50) Einst im Besitz Castellanis, jetzt im British Museum; Walters, Cat. d. vases, IV. G. 137.
Hier Fig. 101 nach einem Gipsabguß. Abg. Benndorf, a. 0. Taf. 57, 10 zu S. 114. Durchmesser des
Reliefgrundes 0'06 m, mit dem schmucklosen Saum 0'08 m. — Zwei nackte Krieger mit Leibgür-
teln, von einander abgewendet. Der rechte Unbärtige schreitet mit dem linken Bein, dessen Unter-
schenkel hinter dem Reliefraume verschwindet, nach rechts aus und hält im linken, nicht sicht-
baren Arm einen Stamnos mit geriefeltem Bauche. Er schaut nach rückwärts, seine rechte Hand
ist zusammengeballt, als wenn sie eine Waffe hielte. Der linke, augenscheinlich bärtige Krieger
schreitet mit vorgebeugtem Oberleibe, als wenn er emporstiege, den rechten Arm zurückschwin-
gend, den linken mit dem Schilde niederstreckend. Für Benndorf war die Szene unverständlich.
Walters dachte an Hylas und Herakles. Doch unterliegt es keinem Zweifel, daß hier zwei Gal-
lier dargestellt sind, deren einer eine geplünderte Vase davonträgt, während der andere seinen
Bückzug mit dem Schilde deckt.
51) Einst in der Sammlung Campana in Rom, jetzt im Louvre, Inv. Nr. 1396. Durch-
messer des Rundes 0'07 m; mit dem glatten Saum 0 09 m. Der Durchmesser der Schale, die nicht
sehr tief war, betrug 0'21 m; ihre Höhe 0"05 in. Schwarzer, wenig glänzender Firnis. Brauner,
rötlicher Ton ist unter dem Fuß der Schale sichtbar. Das Bild ist im ganzen schlecht aus-
gedrückt, aber einige Details sind deutlicher als auf Nr. 50. So bemerkt man hier eine starke
Terrainlinie, die sich von dem linken Knie des jugendlichen zum rechten Fuß des bärtigen Krie-
gers hinzieht. Der Schild hat deutlich eine länglich ovale Form mit Umbo. Längs desselben eine
undeutliche Inschrift: ...io et . Gabin.
52) Einst in der Sammlung Dressel, jetzt im Dresdener Albertinum, Zg Vz. 676. Hier
Fig. 102 nach einem Gipsabguß. Beschr. Arch.-Anz. 1889, 166 (Treu). Durchmesser ohne Borte
0'065 m, mit dreistreifiger, glatter Borte 0'09 m. Links von dem Schilde die Inschrift: L . Gabinio.
An dem rechts zurückweichenden Barbaren ist der auf der Brust geknöpfte Mantel, dessen
Falten rechts vom Gefäß zum Vorschein kommen, deutlich. Auch die Gurte um den Leib und
der Schild mit Umbo sind gut erkennbar.
S—53) Heidelberg, Universitätssammlung, einst bei P. Hartwig in Born. Hier Fig. 103^
104 nach einer von Duhn verdankten Originalaufnahme. Durchmesser des Rundes ohne die
Borte 0"06 m, mit der Borte, die aus zwei konzentrischen Ringen besteht, 0-075 m. Man sieht
in der Vorderansicht einen mit einem auf der Brust geknöpften Mantel bekleideten Jüngling,
der mit dem rechten Bein auf einem über Eck gestellten Altar oder Untersatz mit geriefelten
Ecksäulchen kniet, die geballte rechte Faust wie zur Verteidigung erhebt und mit dem nicht
sichtbaren linken Arm eine Amphora hält. An ihrem Bauche kommen die Finger seiner linken
Hand zum Vorschein. Der Jüngling ist durch einen gedrehten Leibgürtel als Gallier gekenn-
zeichnet. Zwischen seinen Beinen, am Altar, erscheint der nackte Oberkörper eines mit dem Ge-
sicht nach unten liegenden Toten (mit Torques), an dessen linker Seite noch der ovale Schild (mit
Langrippe) erkennbar ist. Ein zweiter Schild oder ein Bogen befindet sich vielleicht unter dem
linken Fuß des knieenden Galliers. Rechts, olfenbar im Kampfe mit dem Knieenden, eine durch
Busen und Haarknoten am Hinterkopf als Frau charakterisierte Gestalt, die mit der linken Hand
nach der Mündung des Gefäßes greift, offenbar, um es dem Gallier zu entreißen. Die Richtung
ihres rechten Armes, der nicht wiedergegeben ist, wird durch die von ihm herunterhängenden,
vorn (keineswegs ein Löwenkopf'). Am Rücken trägt er einen Schlauch, den er mit der rechten Hand stützt.
Die Figur gehört wohl in den bakchischen Kreis und hat nichts mit den plündernden Kelten zu tun. Der ver-
meintliche Torques ist auf der Photographie nicht erkennbar.
Celtaruni Imagiues. 12