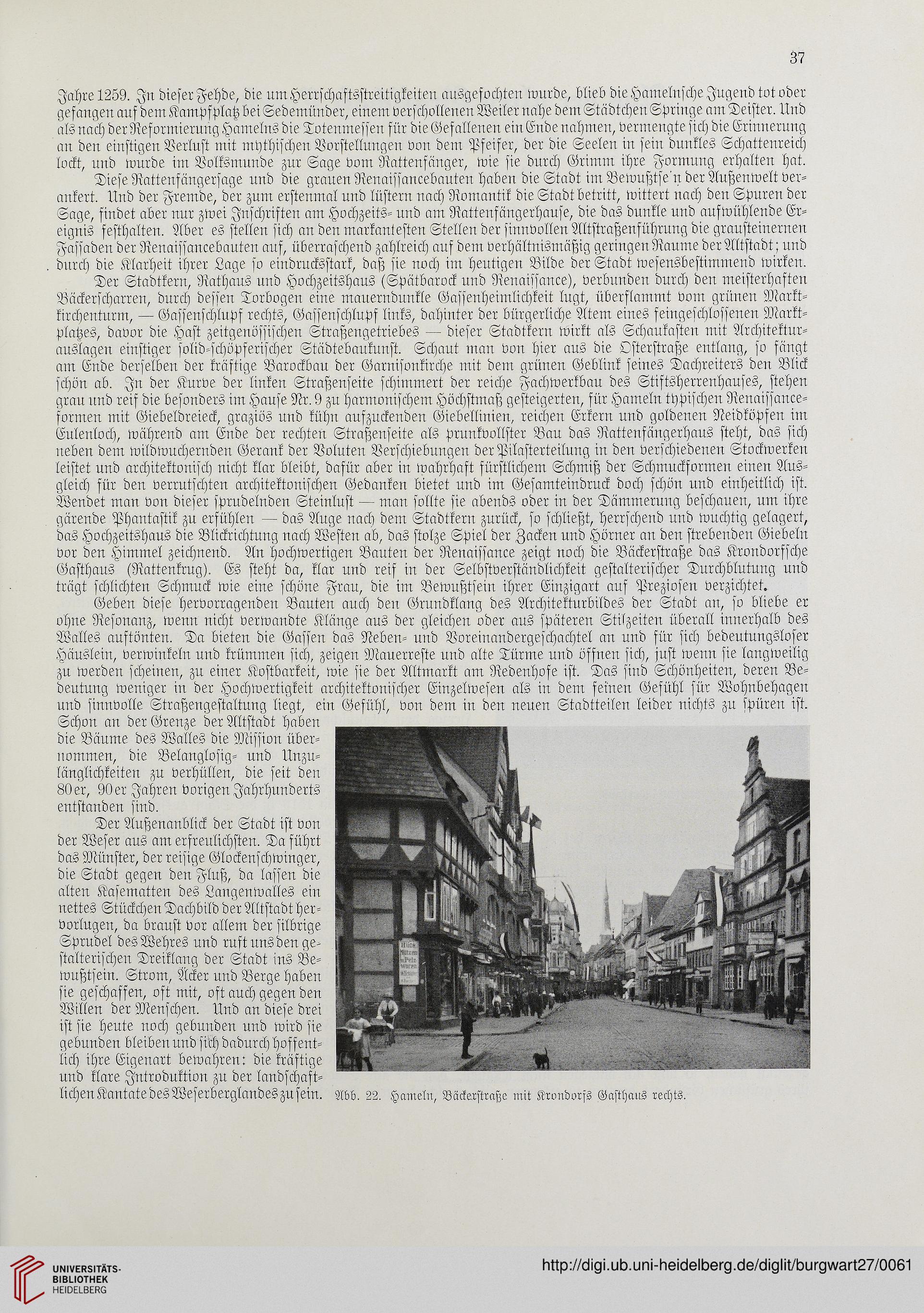37
Jahre 1259. In dieser Fehde, die um Herrschaftsstreitigkeiten ausgesuchten wurde, blieb die Hamelnsche Jugend tot oder
gefangen auf dem Kampfplatz bei Sedemünder, einem verschollenen Weiler nahe dem Städtchen Springe am Deister. Und
als nach der Reformierung Hamelns die Totenmessen für die Gefallenen ein Ende nahinen, vermengte sich die Erinnerung
an den einstigen Verlust mit mythischen Vorstellungen von dem Pfeifer, der die Seelen in sein dunkles Schattenreich
lockt, und wurde im Volksmunde zur Sage vom Rattenfänger, wie sie durch Grimm ihre Formung erhalten hat.
Diese Rattenfängersage und die grauen Renaissancebauten haben die Stadt im Bewußtse n der Außenwelt ver-
ankert. Und der Fremde, der zum erstenmal und lüstern nach Romantik die Stadt betritt, wittert nach den Spuren der
Sage, findet aber nur zwei Inschriften am Hochzeits- und am Rattenfängerhause, die das dunkle und aufwühlende Er-
eignis festhalten. Aber es stellen sich an den markantesten Stellen der sinnvollen Altstraßensührung die grausteinernen
Fassaden der Renaissancebauten auf, überraschend zahlreich auf dein verhältnismäßig geringen Raume der Altstadt; und
. durch die Klarheit ihrer Lage so eindrucksstark, daß sie noch im heutigen Bilde der Stadt wesensbestimmend wirken.
Der Stadtkern, Rathaus und Hochzeitshaus (Spätbarock und Renaissance), verbunden durch den meisterhaften
Bäckerscharren, durch dessen Torbogen eine mauerndunkle Gassenheimlichkeit lugt, tiberflammt vom grünen Markt-
kirchenturm, — Gassenschlupf rechts, Gassenschlupf links, dahinter der bürgerliche Atem eines feingeschlossenen Markt-
platzes, davor die Hast zeitgenössischen Straßengetriebes — dieser Stadtkern wirkt als Schaukasten mit Architektur-
auslagen einstiger solid-schöpferischer Städtebaukunst. Schaut man von hier aus die Osterstraße entlang, so fängt
am Ende derselben der kräftige Barockbau der Garnisonkirche mit dem grünen Geblink seines Dachreiters den Blick
schön ab. In der Kurve der linken Straßenseite schimmert der reiche Fachwerkbau des Stiftsherrenhauses, stehen
grau und reif die besonders im Hause Nr. 9 zu harmonischem Höchstmaß gesteigerten, für Hameln typischen Renaissance-
sormen mit Giebeldreieck, graziös und kühn aufzuckenden Giebellinien, reichen Erkern und goldenen Neidköpfen im
Eulenloch, während am Ende der rechten Straßenseite als prunkvollster Bau das Rattenfängerhaus steht, das sich
lieben dem wildwuchernden Gerank der Voluten Verschiebungen der Pilasterteilung in den verschiedenen Stockwerken
leistet und architektonisch nicht klar bleibt, dafür aber in wahrhaft fürstlichem Schmiß der Schmuckformen einen Aus-
gleich für den verrutschten architektonischen Gedanken bietet und im Gesamteindruck doch schön und einheitlich ist.
Wendet man von dieser sprudelnden Steinlust — man sollte sie abends oder in der Dämmerung beschauen, um ihre
gärende Phantastik zu erfühlen — das Auge nach dem Stadtkern zurück, so schließt, herrschend und wuchtig gelagert,
das Hochzeitshaus die Blickrichtung nach Westen ab, das stolze Spiel der Zacken und Hörner an den strebenden Giebeln
vor den Himmel zeichnend. An hochwertigen Bauten der Renaissance zeigt noch die Bäckerstraße das Krondorssche
Gasthaus (Rattenkrug). Es steht da, klar und reif in der Selbstverständlichkeit gestalterischer Durchblutung und
trägt schlichten Schmuck wie eine schöne Frau, die im Bewußtsein ihrer Einzigart auf Preziosen verzichtet.
Geben diese hervorragenden Bauten auch den Grundklang des Architekturbildes der Stadt an, so bliebe er
ohne Resonanz, wenn nicht verwandte Klänge aus der gleichen oder ans späteren Stilzeiten überall innerhalb des
Walles auftönten. Da bieten die Gassen das Neben- und Boreinandergeschachtel an und für sich bedeutungsloser
Häuslein, verwinkeln und krümmen sich, zeigen Mauerreste und alte Türme und öffnen sich, just wenn sie langweilig
zu werden scheinen, zu einer Kostbarkeit, wie sie der Altmarkt am Redenhofe ist. Das sind Schönheiten, deren Be-
deutung weniger in der Hochwertigkeit architektonischer Einzelwesen als in dem feinen Gefühl für Wohnbehagen
und sinnvolle Straßengestaltung liegt, ein Gefühl, von dem in den neuen Stadtteilen leider nichts zu spüren ist.
Schon an der Grenze der Altstadt haben
die Bäume des Walles die Mission über-
nommen, die Belanglosig- und Unzu-
länglichkeiten zu verhüllen, die seit den
80 er, 90 er Jahren vorigen Jahrhunderts
entstanden sind.
Der Außenanblick der Stadt ist von
der Weser aus am erfreulichsten. Da führt
das Münster, der reisige Glockenschwinger,
die Stadt gegen den Fluß, da lassen die
alten Kasematten des Langenwalles ein
nettes Stückchen Dachbild der Altstadt her-
vorlugen, da braust vor allem der silbrige
Sprudel des Wehres und ruft uns den ge-
stalterischen Dreiklang der Stadt ins Be-
wußtsein. Strom, Äcker und Berge haben
sie geschaffen, oft mit, oft auch gegen den
Willen der Menschen. Und an diese drei
ist sie heute noch gebunden und wird sie
gebunden bleiben und sich dadurch hoffent-
lich ihre Eigenart bewahren: die kräftige
und klare Introduktion zu der landschaft-
lichenKantatedesWeserberglandeszusein. Abb. 22. Hameln, Bäckerstraße mit Krondorfs Gasthaus rechts.
Jahre 1259. In dieser Fehde, die um Herrschaftsstreitigkeiten ausgesuchten wurde, blieb die Hamelnsche Jugend tot oder
gefangen auf dem Kampfplatz bei Sedemünder, einem verschollenen Weiler nahe dem Städtchen Springe am Deister. Und
als nach der Reformierung Hamelns die Totenmessen für die Gefallenen ein Ende nahinen, vermengte sich die Erinnerung
an den einstigen Verlust mit mythischen Vorstellungen von dem Pfeifer, der die Seelen in sein dunkles Schattenreich
lockt, und wurde im Volksmunde zur Sage vom Rattenfänger, wie sie durch Grimm ihre Formung erhalten hat.
Diese Rattenfängersage und die grauen Renaissancebauten haben die Stadt im Bewußtse n der Außenwelt ver-
ankert. Und der Fremde, der zum erstenmal und lüstern nach Romantik die Stadt betritt, wittert nach den Spuren der
Sage, findet aber nur zwei Inschriften am Hochzeits- und am Rattenfängerhause, die das dunkle und aufwühlende Er-
eignis festhalten. Aber es stellen sich an den markantesten Stellen der sinnvollen Altstraßensührung die grausteinernen
Fassaden der Renaissancebauten auf, überraschend zahlreich auf dein verhältnismäßig geringen Raume der Altstadt; und
. durch die Klarheit ihrer Lage so eindrucksstark, daß sie noch im heutigen Bilde der Stadt wesensbestimmend wirken.
Der Stadtkern, Rathaus und Hochzeitshaus (Spätbarock und Renaissance), verbunden durch den meisterhaften
Bäckerscharren, durch dessen Torbogen eine mauerndunkle Gassenheimlichkeit lugt, tiberflammt vom grünen Markt-
kirchenturm, — Gassenschlupf rechts, Gassenschlupf links, dahinter der bürgerliche Atem eines feingeschlossenen Markt-
platzes, davor die Hast zeitgenössischen Straßengetriebes — dieser Stadtkern wirkt als Schaukasten mit Architektur-
auslagen einstiger solid-schöpferischer Städtebaukunst. Schaut man von hier aus die Osterstraße entlang, so fängt
am Ende derselben der kräftige Barockbau der Garnisonkirche mit dem grünen Geblink seines Dachreiters den Blick
schön ab. In der Kurve der linken Straßenseite schimmert der reiche Fachwerkbau des Stiftsherrenhauses, stehen
grau und reif die besonders im Hause Nr. 9 zu harmonischem Höchstmaß gesteigerten, für Hameln typischen Renaissance-
sormen mit Giebeldreieck, graziös und kühn aufzuckenden Giebellinien, reichen Erkern und goldenen Neidköpfen im
Eulenloch, während am Ende der rechten Straßenseite als prunkvollster Bau das Rattenfängerhaus steht, das sich
lieben dem wildwuchernden Gerank der Voluten Verschiebungen der Pilasterteilung in den verschiedenen Stockwerken
leistet und architektonisch nicht klar bleibt, dafür aber in wahrhaft fürstlichem Schmiß der Schmuckformen einen Aus-
gleich für den verrutschten architektonischen Gedanken bietet und im Gesamteindruck doch schön und einheitlich ist.
Wendet man von dieser sprudelnden Steinlust — man sollte sie abends oder in der Dämmerung beschauen, um ihre
gärende Phantastik zu erfühlen — das Auge nach dem Stadtkern zurück, so schließt, herrschend und wuchtig gelagert,
das Hochzeitshaus die Blickrichtung nach Westen ab, das stolze Spiel der Zacken und Hörner an den strebenden Giebeln
vor den Himmel zeichnend. An hochwertigen Bauten der Renaissance zeigt noch die Bäckerstraße das Krondorssche
Gasthaus (Rattenkrug). Es steht da, klar und reif in der Selbstverständlichkeit gestalterischer Durchblutung und
trägt schlichten Schmuck wie eine schöne Frau, die im Bewußtsein ihrer Einzigart auf Preziosen verzichtet.
Geben diese hervorragenden Bauten auch den Grundklang des Architekturbildes der Stadt an, so bliebe er
ohne Resonanz, wenn nicht verwandte Klänge aus der gleichen oder ans späteren Stilzeiten überall innerhalb des
Walles auftönten. Da bieten die Gassen das Neben- und Boreinandergeschachtel an und für sich bedeutungsloser
Häuslein, verwinkeln und krümmen sich, zeigen Mauerreste und alte Türme und öffnen sich, just wenn sie langweilig
zu werden scheinen, zu einer Kostbarkeit, wie sie der Altmarkt am Redenhofe ist. Das sind Schönheiten, deren Be-
deutung weniger in der Hochwertigkeit architektonischer Einzelwesen als in dem feinen Gefühl für Wohnbehagen
und sinnvolle Straßengestaltung liegt, ein Gefühl, von dem in den neuen Stadtteilen leider nichts zu spüren ist.
Schon an der Grenze der Altstadt haben
die Bäume des Walles die Mission über-
nommen, die Belanglosig- und Unzu-
länglichkeiten zu verhüllen, die seit den
80 er, 90 er Jahren vorigen Jahrhunderts
entstanden sind.
Der Außenanblick der Stadt ist von
der Weser aus am erfreulichsten. Da führt
das Münster, der reisige Glockenschwinger,
die Stadt gegen den Fluß, da lassen die
alten Kasematten des Langenwalles ein
nettes Stückchen Dachbild der Altstadt her-
vorlugen, da braust vor allem der silbrige
Sprudel des Wehres und ruft uns den ge-
stalterischen Dreiklang der Stadt ins Be-
wußtsein. Strom, Äcker und Berge haben
sie geschaffen, oft mit, oft auch gegen den
Willen der Menschen. Und an diese drei
ist sie heute noch gebunden und wird sie
gebunden bleiben und sich dadurch hoffent-
lich ihre Eigenart bewahren: die kräftige
und klare Introduktion zu der landschaft-
lichenKantatedesWeserberglandeszusein. Abb. 22. Hameln, Bäckerstraße mit Krondorfs Gasthaus rechts.