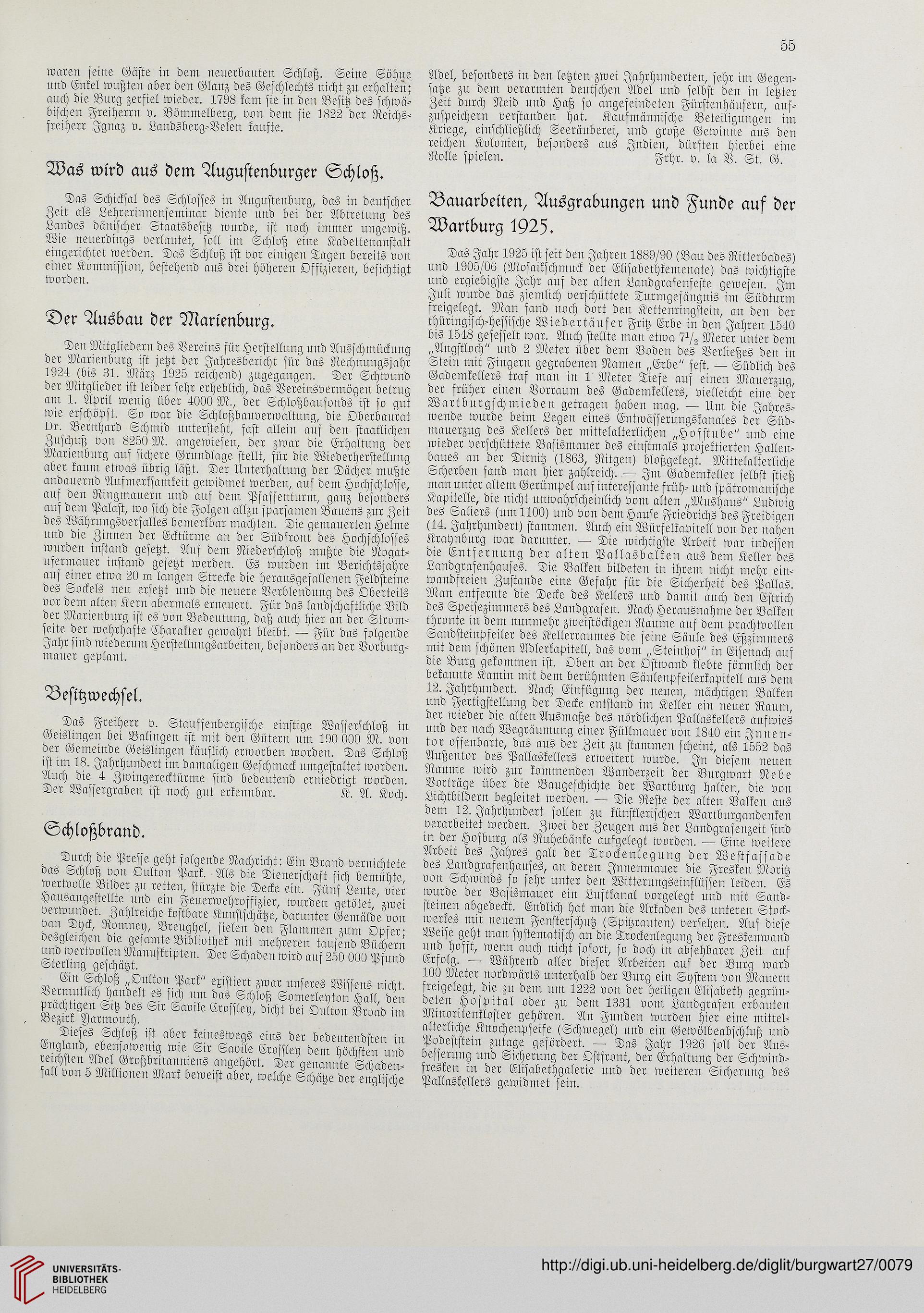55
waren seine Gäste in dem neuerbauten Schloß. Seine Söhne
und Enkel wußten aber den Glanz des Geschlechts nicht zu erhalten;
auch die Burg zerfiel wieder. 1798 kam sie in den Besitz des schwä-
bischen Freiherrn v. Bömmelberg, von dem sie 1822 der Reichs-
freiherr Ignaz v. Landsberg-Belen kaufte.
Was wird aus dem Augustmburger Schloß.
Das Schicksal des Schlosses in Augustenburg, das in deutscher
Zeit als Lehrerinnenseminar diente und bei der Abtretung des
Landes dänischer Staatsbesitz wurde, ist noch immer ungewiß.
Wie neuerdings verlautet, soll im Schloß eine Kadettenanstalt
eingerichtet werden. Das Schloß ist vor einigen Tagen bereits von
einer Kommission, bestehend aus drei höheren Offizieren, besichtigt
worden.
Der Ausbau der Marienburg.
Den Mitgliedern des Vereins für Herstellung und Ausschmückung
der Marienburg ist jetzt der Jahresbericht für das Rechnungsjahr
1924 (bis 31. März 1925 reichend) zugegangen. Der Schwund
der Mitglieder ist leider sehr erheblich, das Vereinsvermögen betrug
am 1. April wenig über 4000 M., der Schloßbaufonds ist so gut
wie erschöpft. So war die Schloßbauverwaltung, die Oberbaurat
vr. Bernhard Schund untersteht, fast allein auf den staatlichen
Zuschuß von 8250 M. angewiesen, der zwar die Erhaltung der
Marienburg auf sichere Grundlage stellt, für die Wiederherstellung
aber kaum etwas übrig läßt. Der Unterhaltung der Dächer mußte
andauernd Aufmerksamkeit gewidmet werden, auf dem Hochschlosse,
auf den Ringmauern und auf dem Psaffenturm, ganz besonders
auf dem Palast, wo sich die Folgen allzu sparsamen Bauens zur Zeit
des Währungsverfalles bemerkbar machten. Die gemauerten Helme
und die Zinnen der Ecktürme an der Südfront des Hochschlosses
wurden instand gesetzt. Auf dem Niederschloß mußte die Nogat-
ufermauer instand gesetzt werden. Es wurden im Berichtsjahre
auf einer etwa 20 m langen Strecke die herausgefallenen Feldsteine
des Sockels neu ersetzt und die neuere Verblendung des Oberteils
vor dem alten Kern abermals erneuert. Für das landschaftliche Bild
der Marienburg ist es von Bedeutung, daß auch hier an der Strom-
seite der wehrhafte Charakter gewahrt bleibt. — Für das folgende
Jahr sind wiederum Herstellunqsarbeiten, besonders an der Vorburg-
mauer geplant.
Besitzwechsel.
Das Freiherr v. Stauffenbergische einstige Wasserschloß in
Geislingen bei Balingen ist mit den Gütern um 190 000 M. von
der Gemeinde Geislingen käuflich erworben worden. Das Schloß
ist im 18. Jahrhundert im damaligen Geschmack nmgestaltet worden.
Auch die 4 Zwingerecktürme sind bedeutend erniedrigt worden.
Der Wassergraben ist noch gut erkennbar. K. A. Koch.
Schloßbrand.
Durch die Presse geht folgende Nachricht: Ein Brand vernichtete
das Schloß von Oulton Park. Als die Dienerschaft sich bemühte,
wertvolle Bilder zu retten, stürzte die Decke ein. Fünf Leute, vier
Hausangestellte und ein Feuerwehroffizier, wurden getötet, zwei
verwundet. Zahlreiche kostbare Kunstschätze, darunter Gemälde von
van Dyck, Romney, Breughel, fielen den Flammen zum Opfer;
desgleichen die gesamte Bibliothek mit mehreren tausend Büchern
und wertvollen Manuskripten. Der Schaden wird ans 250 000 Pfund
Sterling geschätzt.
Ein Schloß „Oulton Park" existiert zwar unseres Wissens nicht.
Vermutlich handelt es sich um das Schloß Somerleyton Hall, den
prächtigen Sitz des Sir Savile Erossley, dicht bei Oulton Broad im
Bezirk Warmouth.
Dieses Schloß ist aber keineswegs eins der bedeutendsten in
England, ebensowenig wie Sir Savile Erossley dem höchsten und
reichsten Adel Großbritanniens angehört. Der genannte Schaden-
fall von 5 Millionen Mark beweist aber, welche Schätze der englische
Adel, besonders in den letzten zwei Jahrhunderten, sehr im Gegen-
sätze zu dem verarmten deutschen Adel und selbst den in letzter
Zeit durch Neid und Haß so angefeindeten Fürstenhäusern, auf-
zuspeichern verstanden hat. Kaufmännische Beteiligungen im
Kriege, einschließlich Seeräuberei, und große Gewinne aus den
reichen Kolonien, besonders aus Indien, dürsten hierbei eine
Rolle spielen. Frhr. v. la V. St. G.
Bauarbeiten, Ausgrabungen und Funde auf der
Wartburg 192^.
Das Jahr 1925 ist seit den Jahren 1889/90 (Bau des Ritterbades)
und 1905/06 (Mosaikschmuck der Elisabethkemenate) das wichtigste
und ergiebigste Jahr auf der alten Landgrafenfeste gewesen. Im
Juli wurde das ziemlich verschüttete Turmgefängnis im Südturm
sreigelegt. Man fand noch dort den Kettenringstein, an den der
thüringisch-hessische Wiedertäufer Fritz Erbe in den Jahren 1540
bis 1548 gefesselt war. Auch stellte man etwa 7^ Meter unter dem
„Angstloch" und 2 Meter über dein Boden des Verließes den in
Stein mit Fingern gegrabenen Namen „Erbe" fest. — Südlich des
Gademkellers traf man in 1 Meter Tiefe ans einen Mauerzug,
der früher einen Vorraum des Gademkellers, vielleicht eine der
Wartburgschmieden getragen haben mag. — Um die Jahres-
wende wurde beim Legen eines Entwässerungskanales der Süd-
mauerzug des Kellers der mittelalterlichen „Hofstube" und eine
wieder verschüttete Basismauer des einstmals projektierten Hallen-
baues an der Dirnitz (1863, Ritgen) bloßgelegt. Mittelalterliche
Scherben fand man hier zahlreich. — Im Gademkeller selbst stieß
man unter altem Gerümpel auf interessante früh- und spätromanische
Kapitelle, die nicht unwahrscheinlich vom alten „Mushaus" Ludwig
des Saliers (um 1100) und von dem Hause Friedrichs des Freidigen
(14. Jahrhundert) stammen. Auch ein Würfelkapitell von der nahen
Kraynburg war darunter. — Die wichtigste Arbeit war indessen
die Entfernung der alten Pallasbalken aus dem Keller des
Landgrafenhauses. Die Balken bildeten in ihrem nicht mehr ein-
wandfreien Zustande eine Gefahr für die Sicherheit des Pallas.
Man entfernte die Decke des Kellers und damit auch den Estrich
des Speisezimmers des Landgrafen. Nach Herausnahme der Balken
thronte in dem nunmehr zweistöckigen Raume auf dem prachtvollen
Sandsteinpfeiler des Kellerraumes die feine Säule des Eßzimmers
mit dem schönen Adlerkapitell, das vom „Steinhof" in Eisenach auf
die Burg gekommen ist. Oben an der Ostwand klebte förmlich der
bekannte Kamin mit dem berühmten Säulenpfeilerkapitell aus den:
12. Jahrhundert. Nach Einfügung der neuen, mächtigen Balken
und Fertigstellung der Decke entstand im Keller ein neuer Raum,
der wieder die alten Ausmaße des nördlichen Pallaskellers anfwies
und der nach Wegräumung einer Füllmauer von 1840 ein Jnnen-
tor offenbarte, das aus der Zeit zu stammen scheint, als 1552 das
Außentor des Pallaskellers erweitert wurde. In diesem neuen
Raume wird zur kommenden Wanderzeit der Burgwart Nebe
Vorträge über die Baugeschichte der Wartburg halten, die von
Lichtbildern begleitet werden. — Die Reste der alten Balken aus
dem 12. Jahrhundert sollen zu künstlerischen Wartburgandenken
verarbeitet werden. Zwei der Zeugen aus der Landgrafenzeit sind
in der Hofburg als Ruhebänke aufgelegt worden. — Eine weitere
Arbeit des Jahres galt der Trockenlegung der Westfassade
des Landgrafenhauses, an deren Jnnenmauer die Fresken Moritz
von Schwinds so sehr unter den Witterungseinflüssen leiden. Es
wurde der Basismauer ein Luftkanal vorgelegt und mit Sand-
steinei: abgedeckt. Endlich hat man die Arkaden des unteren Stock-
werkes mit neuem Fensterschutz (Spitzrauten) versehen. Auf diese
Weise geht man systematisch an die Trockenlegung der Freskenwand
und hofft, wem: auch nicht sofort, so doch in absehbarer Zeit auf
Erfolg. — Während aller dieser Arbeiten auf der Burg ward
100 Meter nordwärts unterhalb der Burg ein System von Mauern
freigelegt, die zu dem um 1222 von der heiligen Elisabeth gegrün-
dete:: Hospital oder zu den: 1331 vom Landgrafen erbauten
Minoritenkloster gehören. An Funden wurden hier eine mittel-
alterliche Knochenpfeife (Schwegel) und ein Gewölbeabschluß und
Podeststein zutage gefördert. — Das Jahr 1926 soll der Aus-
besserung und Sicherung der Ostfront, der Erhaltung der Schwind-
fresken in der Elisabethgälerie und der weiteren Sicherung des
Pällaskellers gewidmet sein.
waren seine Gäste in dem neuerbauten Schloß. Seine Söhne
und Enkel wußten aber den Glanz des Geschlechts nicht zu erhalten;
auch die Burg zerfiel wieder. 1798 kam sie in den Besitz des schwä-
bischen Freiherrn v. Bömmelberg, von dem sie 1822 der Reichs-
freiherr Ignaz v. Landsberg-Belen kaufte.
Was wird aus dem Augustmburger Schloß.
Das Schicksal des Schlosses in Augustenburg, das in deutscher
Zeit als Lehrerinnenseminar diente und bei der Abtretung des
Landes dänischer Staatsbesitz wurde, ist noch immer ungewiß.
Wie neuerdings verlautet, soll im Schloß eine Kadettenanstalt
eingerichtet werden. Das Schloß ist vor einigen Tagen bereits von
einer Kommission, bestehend aus drei höheren Offizieren, besichtigt
worden.
Der Ausbau der Marienburg.
Den Mitgliedern des Vereins für Herstellung und Ausschmückung
der Marienburg ist jetzt der Jahresbericht für das Rechnungsjahr
1924 (bis 31. März 1925 reichend) zugegangen. Der Schwund
der Mitglieder ist leider sehr erheblich, das Vereinsvermögen betrug
am 1. April wenig über 4000 M., der Schloßbaufonds ist so gut
wie erschöpft. So war die Schloßbauverwaltung, die Oberbaurat
vr. Bernhard Schund untersteht, fast allein auf den staatlichen
Zuschuß von 8250 M. angewiesen, der zwar die Erhaltung der
Marienburg auf sichere Grundlage stellt, für die Wiederherstellung
aber kaum etwas übrig läßt. Der Unterhaltung der Dächer mußte
andauernd Aufmerksamkeit gewidmet werden, auf dem Hochschlosse,
auf den Ringmauern und auf dem Psaffenturm, ganz besonders
auf dem Palast, wo sich die Folgen allzu sparsamen Bauens zur Zeit
des Währungsverfalles bemerkbar machten. Die gemauerten Helme
und die Zinnen der Ecktürme an der Südfront des Hochschlosses
wurden instand gesetzt. Auf dem Niederschloß mußte die Nogat-
ufermauer instand gesetzt werden. Es wurden im Berichtsjahre
auf einer etwa 20 m langen Strecke die herausgefallenen Feldsteine
des Sockels neu ersetzt und die neuere Verblendung des Oberteils
vor dem alten Kern abermals erneuert. Für das landschaftliche Bild
der Marienburg ist es von Bedeutung, daß auch hier an der Strom-
seite der wehrhafte Charakter gewahrt bleibt. — Für das folgende
Jahr sind wiederum Herstellunqsarbeiten, besonders an der Vorburg-
mauer geplant.
Besitzwechsel.
Das Freiherr v. Stauffenbergische einstige Wasserschloß in
Geislingen bei Balingen ist mit den Gütern um 190 000 M. von
der Gemeinde Geislingen käuflich erworben worden. Das Schloß
ist im 18. Jahrhundert im damaligen Geschmack nmgestaltet worden.
Auch die 4 Zwingerecktürme sind bedeutend erniedrigt worden.
Der Wassergraben ist noch gut erkennbar. K. A. Koch.
Schloßbrand.
Durch die Presse geht folgende Nachricht: Ein Brand vernichtete
das Schloß von Oulton Park. Als die Dienerschaft sich bemühte,
wertvolle Bilder zu retten, stürzte die Decke ein. Fünf Leute, vier
Hausangestellte und ein Feuerwehroffizier, wurden getötet, zwei
verwundet. Zahlreiche kostbare Kunstschätze, darunter Gemälde von
van Dyck, Romney, Breughel, fielen den Flammen zum Opfer;
desgleichen die gesamte Bibliothek mit mehreren tausend Büchern
und wertvollen Manuskripten. Der Schaden wird ans 250 000 Pfund
Sterling geschätzt.
Ein Schloß „Oulton Park" existiert zwar unseres Wissens nicht.
Vermutlich handelt es sich um das Schloß Somerleyton Hall, den
prächtigen Sitz des Sir Savile Erossley, dicht bei Oulton Broad im
Bezirk Warmouth.
Dieses Schloß ist aber keineswegs eins der bedeutendsten in
England, ebensowenig wie Sir Savile Erossley dem höchsten und
reichsten Adel Großbritanniens angehört. Der genannte Schaden-
fall von 5 Millionen Mark beweist aber, welche Schätze der englische
Adel, besonders in den letzten zwei Jahrhunderten, sehr im Gegen-
sätze zu dem verarmten deutschen Adel und selbst den in letzter
Zeit durch Neid und Haß so angefeindeten Fürstenhäusern, auf-
zuspeichern verstanden hat. Kaufmännische Beteiligungen im
Kriege, einschließlich Seeräuberei, und große Gewinne aus den
reichen Kolonien, besonders aus Indien, dürsten hierbei eine
Rolle spielen. Frhr. v. la V. St. G.
Bauarbeiten, Ausgrabungen und Funde auf der
Wartburg 192^.
Das Jahr 1925 ist seit den Jahren 1889/90 (Bau des Ritterbades)
und 1905/06 (Mosaikschmuck der Elisabethkemenate) das wichtigste
und ergiebigste Jahr auf der alten Landgrafenfeste gewesen. Im
Juli wurde das ziemlich verschüttete Turmgefängnis im Südturm
sreigelegt. Man fand noch dort den Kettenringstein, an den der
thüringisch-hessische Wiedertäufer Fritz Erbe in den Jahren 1540
bis 1548 gefesselt war. Auch stellte man etwa 7^ Meter unter dem
„Angstloch" und 2 Meter über dein Boden des Verließes den in
Stein mit Fingern gegrabenen Namen „Erbe" fest. — Südlich des
Gademkellers traf man in 1 Meter Tiefe ans einen Mauerzug,
der früher einen Vorraum des Gademkellers, vielleicht eine der
Wartburgschmieden getragen haben mag. — Um die Jahres-
wende wurde beim Legen eines Entwässerungskanales der Süd-
mauerzug des Kellers der mittelalterlichen „Hofstube" und eine
wieder verschüttete Basismauer des einstmals projektierten Hallen-
baues an der Dirnitz (1863, Ritgen) bloßgelegt. Mittelalterliche
Scherben fand man hier zahlreich. — Im Gademkeller selbst stieß
man unter altem Gerümpel auf interessante früh- und spätromanische
Kapitelle, die nicht unwahrscheinlich vom alten „Mushaus" Ludwig
des Saliers (um 1100) und von dem Hause Friedrichs des Freidigen
(14. Jahrhundert) stammen. Auch ein Würfelkapitell von der nahen
Kraynburg war darunter. — Die wichtigste Arbeit war indessen
die Entfernung der alten Pallasbalken aus dem Keller des
Landgrafenhauses. Die Balken bildeten in ihrem nicht mehr ein-
wandfreien Zustande eine Gefahr für die Sicherheit des Pallas.
Man entfernte die Decke des Kellers und damit auch den Estrich
des Speisezimmers des Landgrafen. Nach Herausnahme der Balken
thronte in dem nunmehr zweistöckigen Raume auf dem prachtvollen
Sandsteinpfeiler des Kellerraumes die feine Säule des Eßzimmers
mit dem schönen Adlerkapitell, das vom „Steinhof" in Eisenach auf
die Burg gekommen ist. Oben an der Ostwand klebte förmlich der
bekannte Kamin mit dem berühmten Säulenpfeilerkapitell aus den:
12. Jahrhundert. Nach Einfügung der neuen, mächtigen Balken
und Fertigstellung der Decke entstand im Keller ein neuer Raum,
der wieder die alten Ausmaße des nördlichen Pallaskellers anfwies
und der nach Wegräumung einer Füllmauer von 1840 ein Jnnen-
tor offenbarte, das aus der Zeit zu stammen scheint, als 1552 das
Außentor des Pallaskellers erweitert wurde. In diesem neuen
Raume wird zur kommenden Wanderzeit der Burgwart Nebe
Vorträge über die Baugeschichte der Wartburg halten, die von
Lichtbildern begleitet werden. — Die Reste der alten Balken aus
dem 12. Jahrhundert sollen zu künstlerischen Wartburgandenken
verarbeitet werden. Zwei der Zeugen aus der Landgrafenzeit sind
in der Hofburg als Ruhebänke aufgelegt worden. — Eine weitere
Arbeit des Jahres galt der Trockenlegung der Westfassade
des Landgrafenhauses, an deren Jnnenmauer die Fresken Moritz
von Schwinds so sehr unter den Witterungseinflüssen leiden. Es
wurde der Basismauer ein Luftkanal vorgelegt und mit Sand-
steinei: abgedeckt. Endlich hat man die Arkaden des unteren Stock-
werkes mit neuem Fensterschutz (Spitzrauten) versehen. Auf diese
Weise geht man systematisch an die Trockenlegung der Freskenwand
und hofft, wem: auch nicht sofort, so doch in absehbarer Zeit auf
Erfolg. — Während aller dieser Arbeiten auf der Burg ward
100 Meter nordwärts unterhalb der Burg ein System von Mauern
freigelegt, die zu dem um 1222 von der heiligen Elisabeth gegrün-
dete:: Hospital oder zu den: 1331 vom Landgrafen erbauten
Minoritenkloster gehören. An Funden wurden hier eine mittel-
alterliche Knochenpfeife (Schwegel) und ein Gewölbeabschluß und
Podeststein zutage gefördert. — Das Jahr 1926 soll der Aus-
besserung und Sicherung der Ostfront, der Erhaltung der Schwind-
fresken in der Elisabethgälerie und der weiteren Sicherung des
Pällaskellers gewidmet sein.