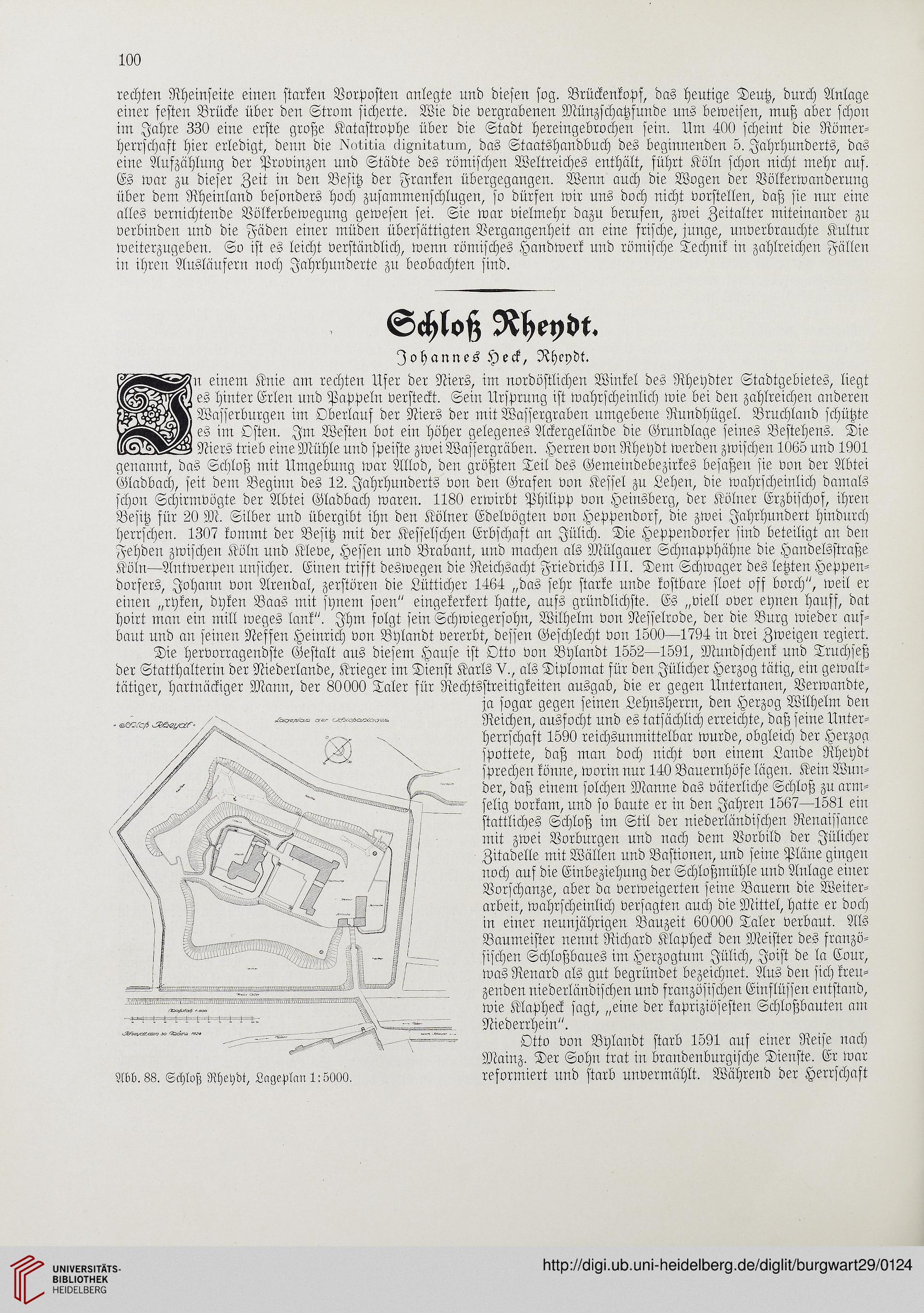100
rechten Rheinseite einen starken Vorposten anlegte und diesen sog. Brückenkopf, das heutige Deutz, durch Anlage
einer festen Brücke über den Strom sicherte. Wie die vergrabenen Münzschatzfunde uns beweisen, muß aber schon
im Jahre 330 eine erste große Katastrophe über die Stadt hereingebrochen sein. Um 400 scheint die Römer-
herrschaft hier erledigt, denn die Notitw ckiZnitatum, das Staatshandbuch des beginnenden 5. Jahrhunderts, das
eine Aufzählung der Provinzen und Städte des römischen Weltreiches enthält, führt Köln schon nicht mehr aus.
Es war zu dieser Zeit in den Besitz der Franken übergegangen. Wenn auch die Wogen der Völkerwanderung
über dem Rheinland besonders hoch zusammenschlngen, so dürfen wir uns doch nicht vorstellen, daß sie nur eine
alles vernichtende Völkerbewegung gewesen sei. Sie war vielmehr dazu berufen, zwei Zeitalter miteinander zu
verbinden und die Fäden einer müden übersättigten Vergangenheit an eine frische, junge, unverbrauchte Kultur
weiterzugeben. So ist es leicht verständlich, wenn römisches Handwerk und römische Technik in zahlreichen Fällen
in ihren Ausläufern noch Jahrhunderte zu beobachten sind.
Schloß Rheydt.
Johannes Heck, Rheydt.
n einem Knie am rechten Ufer der Niers, im nordöstlichen Winkel des Rheydter Stadtgebietes, liegt
es hinter Erlen und Pappeln versteckt. Sein Ursprung ist wahrscheinlich wie bei den zahlreichen anderen
Wasserburgen im Oberlauf der Niers der mit Wassergraben umgebene Rundhügel. Bruchland schützte
es im Osten. Im Westen bot ein höher gelegenes Ackergelünde die Grundlage seines Bestehens. Die
Niers trieb eine Mühle und speiste zwei Wassergräben. Herren von Rheydt werden zwischen 1065 und 1901
genannt, das Schloß mit Umgebung war Allod, den größten Teil des Gemeindebezirkes besaßen sie von der Abtei
Gladbach, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Kessel zu Lehen, die wahrscheinlich damals
schon Schirmvögte der Abtei Gladbach waren. 1180 erwirbt Philipp von Heinsberg, der Kölner Erzbischof, ihren
Besitz für 20 M. Silber und übergibt ihn den Kölner Edelvögten von Heppendorf, die zwei Jahrhundert hindurch
herrschen. 1307 kommt der Besitz mit der Kesselschen Erbschaft an Jülich. Die Heppendorser sind beteiligt an den
Fehden zwischen Köln und Kleve, Hessen und Brabant, und machen als Mülgauer Schnapphähne die Handelsstraße
Köln—Antwerpen unsicher. Einen trifft deswegen die Reichsacht Friedrichs III. Dem Schwager des letzten Heppen-
dorfers, Johann von Arendal, zerstören die Lütticher 1464 „das sehr starke unde kostbare sloet off borch", weil er
einen „ryken, dyken Baas mit synem soen" eingekerkert hatte, aufs gründlichste. Es „vielt oder eynen Hauff, dat
hoirt man ein mill Weges laut". Ihm folgt sein Schwiegersohn, Wilhelm von Nesselrode, der die Burg wieder auf-
baut und an seinen Neffen Heinrich von Bylandt vererbt, dessen Geschlecht von 1500—1794 in drei Zweigen regiert.
Die hervorragendste Gestalt aus diesem Hause ist Otto von Bylandt 1552—1591, Mundschenk und Truchseß
der Statthalterin der Niederlande, Krieger im Dienst Karls V., als Diplomat für den Jülicher Herzog tätig, ein gewalt-
tätiger, hartnäckiger Mann, der 80000 Taler für Rechtsstreitigkeiten ausgab, die er gegen Untertanen, Verwandte,
ja sogar gegen seinen Lehnsherrn, den Herzog Wilhelm den
Reichen, ausfocht und es tatsächlich erreichte, daß seine Unter-
herrschaft 1590 reichsunmittelbar wurde, obgleich der Herzog
spottete, daß man doch nicht von einem Lande Rheydt
sprechen könne, worin nur 140 Bauernhöfe lägen. Kein Wun-
der, daß einem solchen Manne das väterliche Schloß zu arm-
selig vorkam, und so baute er in den Jahren 1567—1581 ein
stattliches Schloß im Stil der niederländischen Renaissance
mit zwei Vorburgen und nach dem Vorbild der Jülicher
Zitadelle mit Wällen und Bastionen, und seine Pläne gingen
noch auf die Einbeziehung der Schloßmühle und Anlage einer
Vorschanze, aber da verweigerten seine Bauern die Weiter-
arbeit, wahrscheinlich versagten auch die Mittel, hatte er doch
in einer neunjährigen Bauzeit 60000 Taler verbaut. Als
Baunreister nennt Richard Klapheck den Meister des franzö-
sischen Schloßbaues im Herzogtum Jülich, Joist de la Cour,
was Renard als gut begründet bezeichnet. Ans den sich kreu-
zenden niederländischen und französischen Einflüssen entstand,
wie Klapheck sagt, „eine der kapriziösesten Schloßbauten am
Niederrhein".
Otto von Bylandt starb 1591 auf einer Reise nach
Mainz. Der Sohn trat in brandenburgische Dienste. Er war
reformiert und starb unvermählt. Während der Herrschaft
Abb. 88. Schloß Rheydt, Lageplan 1:5000.
rechten Rheinseite einen starken Vorposten anlegte und diesen sog. Brückenkopf, das heutige Deutz, durch Anlage
einer festen Brücke über den Strom sicherte. Wie die vergrabenen Münzschatzfunde uns beweisen, muß aber schon
im Jahre 330 eine erste große Katastrophe über die Stadt hereingebrochen sein. Um 400 scheint die Römer-
herrschaft hier erledigt, denn die Notitw ckiZnitatum, das Staatshandbuch des beginnenden 5. Jahrhunderts, das
eine Aufzählung der Provinzen und Städte des römischen Weltreiches enthält, führt Köln schon nicht mehr aus.
Es war zu dieser Zeit in den Besitz der Franken übergegangen. Wenn auch die Wogen der Völkerwanderung
über dem Rheinland besonders hoch zusammenschlngen, so dürfen wir uns doch nicht vorstellen, daß sie nur eine
alles vernichtende Völkerbewegung gewesen sei. Sie war vielmehr dazu berufen, zwei Zeitalter miteinander zu
verbinden und die Fäden einer müden übersättigten Vergangenheit an eine frische, junge, unverbrauchte Kultur
weiterzugeben. So ist es leicht verständlich, wenn römisches Handwerk und römische Technik in zahlreichen Fällen
in ihren Ausläufern noch Jahrhunderte zu beobachten sind.
Schloß Rheydt.
Johannes Heck, Rheydt.
n einem Knie am rechten Ufer der Niers, im nordöstlichen Winkel des Rheydter Stadtgebietes, liegt
es hinter Erlen und Pappeln versteckt. Sein Ursprung ist wahrscheinlich wie bei den zahlreichen anderen
Wasserburgen im Oberlauf der Niers der mit Wassergraben umgebene Rundhügel. Bruchland schützte
es im Osten. Im Westen bot ein höher gelegenes Ackergelünde die Grundlage seines Bestehens. Die
Niers trieb eine Mühle und speiste zwei Wassergräben. Herren von Rheydt werden zwischen 1065 und 1901
genannt, das Schloß mit Umgebung war Allod, den größten Teil des Gemeindebezirkes besaßen sie von der Abtei
Gladbach, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Kessel zu Lehen, die wahrscheinlich damals
schon Schirmvögte der Abtei Gladbach waren. 1180 erwirbt Philipp von Heinsberg, der Kölner Erzbischof, ihren
Besitz für 20 M. Silber und übergibt ihn den Kölner Edelvögten von Heppendorf, die zwei Jahrhundert hindurch
herrschen. 1307 kommt der Besitz mit der Kesselschen Erbschaft an Jülich. Die Heppendorser sind beteiligt an den
Fehden zwischen Köln und Kleve, Hessen und Brabant, und machen als Mülgauer Schnapphähne die Handelsstraße
Köln—Antwerpen unsicher. Einen trifft deswegen die Reichsacht Friedrichs III. Dem Schwager des letzten Heppen-
dorfers, Johann von Arendal, zerstören die Lütticher 1464 „das sehr starke unde kostbare sloet off borch", weil er
einen „ryken, dyken Baas mit synem soen" eingekerkert hatte, aufs gründlichste. Es „vielt oder eynen Hauff, dat
hoirt man ein mill Weges laut". Ihm folgt sein Schwiegersohn, Wilhelm von Nesselrode, der die Burg wieder auf-
baut und an seinen Neffen Heinrich von Bylandt vererbt, dessen Geschlecht von 1500—1794 in drei Zweigen regiert.
Die hervorragendste Gestalt aus diesem Hause ist Otto von Bylandt 1552—1591, Mundschenk und Truchseß
der Statthalterin der Niederlande, Krieger im Dienst Karls V., als Diplomat für den Jülicher Herzog tätig, ein gewalt-
tätiger, hartnäckiger Mann, der 80000 Taler für Rechtsstreitigkeiten ausgab, die er gegen Untertanen, Verwandte,
ja sogar gegen seinen Lehnsherrn, den Herzog Wilhelm den
Reichen, ausfocht und es tatsächlich erreichte, daß seine Unter-
herrschaft 1590 reichsunmittelbar wurde, obgleich der Herzog
spottete, daß man doch nicht von einem Lande Rheydt
sprechen könne, worin nur 140 Bauernhöfe lägen. Kein Wun-
der, daß einem solchen Manne das väterliche Schloß zu arm-
selig vorkam, und so baute er in den Jahren 1567—1581 ein
stattliches Schloß im Stil der niederländischen Renaissance
mit zwei Vorburgen und nach dem Vorbild der Jülicher
Zitadelle mit Wällen und Bastionen, und seine Pläne gingen
noch auf die Einbeziehung der Schloßmühle und Anlage einer
Vorschanze, aber da verweigerten seine Bauern die Weiter-
arbeit, wahrscheinlich versagten auch die Mittel, hatte er doch
in einer neunjährigen Bauzeit 60000 Taler verbaut. Als
Baunreister nennt Richard Klapheck den Meister des franzö-
sischen Schloßbaues im Herzogtum Jülich, Joist de la Cour,
was Renard als gut begründet bezeichnet. Ans den sich kreu-
zenden niederländischen und französischen Einflüssen entstand,
wie Klapheck sagt, „eine der kapriziösesten Schloßbauten am
Niederrhein".
Otto von Bylandt starb 1591 auf einer Reise nach
Mainz. Der Sohn trat in brandenburgische Dienste. Er war
reformiert und starb unvermählt. Während der Herrschaft
Abb. 88. Schloß Rheydt, Lageplan 1:5000.