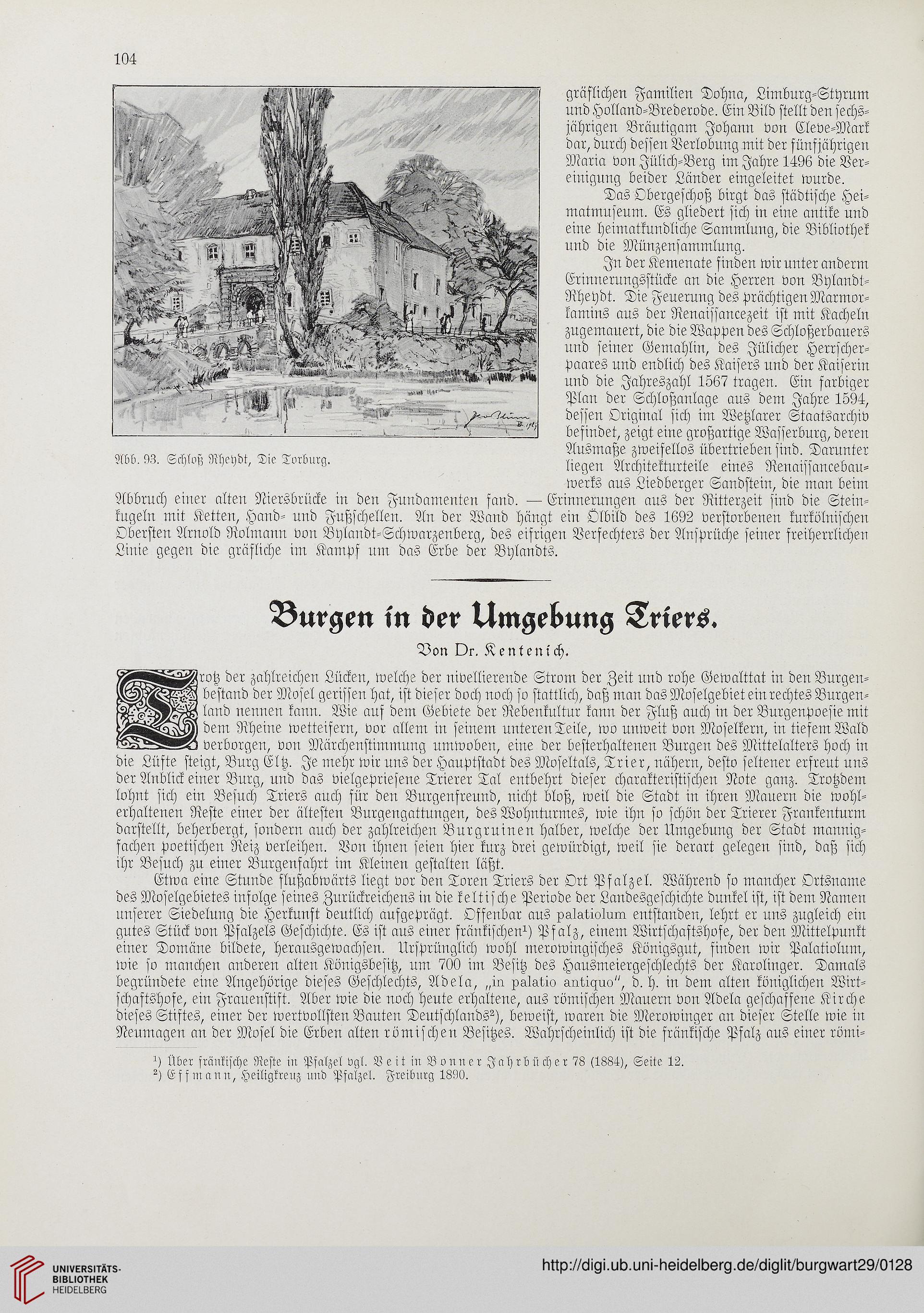104
gräflichen Familien Dohna, Limburg-Styrum
und Holland-Brederode. Ein Bild stellt den sechs-
jährigen Bräutigam Johann von Cleve-Mark
dar, durch dessen Verlobung mit der fünfjährigen
Maria von Jülich-Berg im Jahre 1496 die Ver-
einigung beider Länder eingeleitet wurde.
Das Obergeschoß birgt das städtische Hei-
matmuseum. Es gliedert sich in eine antike und
eine heimatkundliche Sammlung, die Bibliothek
und die Münzensammlung.
In der Kemenate finden wir unter anderm
Erinnerungsstücke an die Herren von Bylandt-
Rheydt. Die Feuerung des prächtigen Marmor-
kamins aus der Renaissancezeit ist mit Kacheln
zugemauert, die die Wappen des Schloßerbauers
und seiner Gemahlin, des Jülicher Herrscher-
paares und endlich des Kaisers und der Kaiserin
und die Jahreszahl 1567 tragen. Ein farbiger
Plan der Schloßanlage aus dem Jahre 1594,
dessen Original sich im Wetzlarer Staatsarchiv
befindet, zeigt eine großartige Wasserburg, deren
Ausmaße zweifellos übertrieben sind. Darunter
liegen Architekturteile eines Renaissancebau-
werks aus Liedberger Sandstein, die man beim
Abbruch einer alten Niersbrücke in den Fundamenten fand. — Erinnerungen aus der Ritterzeit sind die Stein-
kugeln mit Ketten, Hand- und Fußschellen. An der Wand hängt ein Ölbild des 1692 verstorbenen kurkölnischen
Obersten Arnold Rolmann von Bylandt-Schwarzenberg, des eifrigen Verfechters der Ansprüche seiner freiherrlichen
Linie gegen die gräfliche im Kampf um das Erbe der Bylandts.
Burgen in der Umgebung Triers.
Bon Or. Kentenich.
rotz der zahlreichen Lücken, welche der nivellierende Strom der Zeit und rohe Gewalttat in den Burgen-
bestand der Mosel gerissen hat, ist dieser doch noch so stattlich, daß man das Moselgebiet ein rechtes Burgen-
land nennen kann. Wie auf dem Gebiete der Rebenkultur kann der Fluß auch in der Burgenpoesie mit
dem Rheine wetteifern, vor allem in seinem unteren Teile, wo unweit von Moselkern, in tiefem Wald
verborgen, von Märchenstimmung umwoben, eine der besterhaltenen Burgen des Mittelalters hoch in
die Lüfte steigt, Burg Eltz. Je mehr wir uns der Hauptstadt des Moseltals, Trier, nähern, desto seltener erfreut uns
der Anblick einer Burg, und das vielgepriesene Trierer Tal entbehrt dieser charakteristischen Note ganz. Trotzdem
lohnt sich ein Besuch Triers auch für den Burgenfreund, nicht bloß, weil die Stadt in ihren Mauern die wohl-
erhaltenen Reste einer der ältesten Burgengattungen, des Wohnturmes, wie ihn so schön der Trierer Frankenturm
darstellt, beherbergt, sondern auch der zahlreichen Burgruinen halber, welche der Umgebung der Stadt mannig-
fachen poetischen Reiz verleihen. Von ihnen seien hier kurz drei gewürdigt, weil sie derart gelegen sind, daß sich
ihr Besuch zu einer Burgenfahrt im Kleinen gestalten läßt.
Etwa eine Stunde flußabwärts liegt vor den Toren Triers der Ort Pfalzel. Während so mancher Ortsname
des Moselgebietes infolge seines Zurückreichens in die keltische Periode der Landesgeschichte dunkel ist, ist dem Namen
unserer Siedelung die Herkunft deutlich aufgeprägt. Offenbar aus xalalioünn entstanden, lehrt er uns zugleich ein
gutes Stück von Pfalzels Geschichte. Es ist aus einer fränkischen^) Pfalz, einem Wirtschaftshofe, der den Mittelpunkt
einer Domäne bildete, herausgewachsen. Ursprünglich wohl merowingisches Königsgut, finden wir Palatiolum,
wie so manchen anderen alten Königsbesitz, um 700 im Besitz des Hausmeiergeschlechts der Karolinger. Damals
begründete eine Angehörige dieses Geschlechts, Adela, „ia palmio amiguo", d. h. in dem alten königlichen Wirt-
schaftshofe, ein Frauenstift. Aber wie die noch heute erhaltene, aus römischen Mauern von Adela geschaffene Kirche
dieses Stiftes, einer der wertvollsten Bauten Deutschlands^, beweist, waren die Merowinger an dieser Stelle wie in
Neumagen an der Mosel die Erben alten römischen Besitzes. Wahrscheinlich ist die fränkische Pfalz aus einer römi-
0 Über fränkische Reste in Pfalzel vgl. Veit in Bonner Jahrbü cher 78 (1884), Seite 12.
2) Eff mann, Heiligkrenz und Pfalzel. Freibnrg 1890.
gräflichen Familien Dohna, Limburg-Styrum
und Holland-Brederode. Ein Bild stellt den sechs-
jährigen Bräutigam Johann von Cleve-Mark
dar, durch dessen Verlobung mit der fünfjährigen
Maria von Jülich-Berg im Jahre 1496 die Ver-
einigung beider Länder eingeleitet wurde.
Das Obergeschoß birgt das städtische Hei-
matmuseum. Es gliedert sich in eine antike und
eine heimatkundliche Sammlung, die Bibliothek
und die Münzensammlung.
In der Kemenate finden wir unter anderm
Erinnerungsstücke an die Herren von Bylandt-
Rheydt. Die Feuerung des prächtigen Marmor-
kamins aus der Renaissancezeit ist mit Kacheln
zugemauert, die die Wappen des Schloßerbauers
und seiner Gemahlin, des Jülicher Herrscher-
paares und endlich des Kaisers und der Kaiserin
und die Jahreszahl 1567 tragen. Ein farbiger
Plan der Schloßanlage aus dem Jahre 1594,
dessen Original sich im Wetzlarer Staatsarchiv
befindet, zeigt eine großartige Wasserburg, deren
Ausmaße zweifellos übertrieben sind. Darunter
liegen Architekturteile eines Renaissancebau-
werks aus Liedberger Sandstein, die man beim
Abbruch einer alten Niersbrücke in den Fundamenten fand. — Erinnerungen aus der Ritterzeit sind die Stein-
kugeln mit Ketten, Hand- und Fußschellen. An der Wand hängt ein Ölbild des 1692 verstorbenen kurkölnischen
Obersten Arnold Rolmann von Bylandt-Schwarzenberg, des eifrigen Verfechters der Ansprüche seiner freiherrlichen
Linie gegen die gräfliche im Kampf um das Erbe der Bylandts.
Burgen in der Umgebung Triers.
Bon Or. Kentenich.
rotz der zahlreichen Lücken, welche der nivellierende Strom der Zeit und rohe Gewalttat in den Burgen-
bestand der Mosel gerissen hat, ist dieser doch noch so stattlich, daß man das Moselgebiet ein rechtes Burgen-
land nennen kann. Wie auf dem Gebiete der Rebenkultur kann der Fluß auch in der Burgenpoesie mit
dem Rheine wetteifern, vor allem in seinem unteren Teile, wo unweit von Moselkern, in tiefem Wald
verborgen, von Märchenstimmung umwoben, eine der besterhaltenen Burgen des Mittelalters hoch in
die Lüfte steigt, Burg Eltz. Je mehr wir uns der Hauptstadt des Moseltals, Trier, nähern, desto seltener erfreut uns
der Anblick einer Burg, und das vielgepriesene Trierer Tal entbehrt dieser charakteristischen Note ganz. Trotzdem
lohnt sich ein Besuch Triers auch für den Burgenfreund, nicht bloß, weil die Stadt in ihren Mauern die wohl-
erhaltenen Reste einer der ältesten Burgengattungen, des Wohnturmes, wie ihn so schön der Trierer Frankenturm
darstellt, beherbergt, sondern auch der zahlreichen Burgruinen halber, welche der Umgebung der Stadt mannig-
fachen poetischen Reiz verleihen. Von ihnen seien hier kurz drei gewürdigt, weil sie derart gelegen sind, daß sich
ihr Besuch zu einer Burgenfahrt im Kleinen gestalten läßt.
Etwa eine Stunde flußabwärts liegt vor den Toren Triers der Ort Pfalzel. Während so mancher Ortsname
des Moselgebietes infolge seines Zurückreichens in die keltische Periode der Landesgeschichte dunkel ist, ist dem Namen
unserer Siedelung die Herkunft deutlich aufgeprägt. Offenbar aus xalalioünn entstanden, lehrt er uns zugleich ein
gutes Stück von Pfalzels Geschichte. Es ist aus einer fränkischen^) Pfalz, einem Wirtschaftshofe, der den Mittelpunkt
einer Domäne bildete, herausgewachsen. Ursprünglich wohl merowingisches Königsgut, finden wir Palatiolum,
wie so manchen anderen alten Königsbesitz, um 700 im Besitz des Hausmeiergeschlechts der Karolinger. Damals
begründete eine Angehörige dieses Geschlechts, Adela, „ia palmio amiguo", d. h. in dem alten königlichen Wirt-
schaftshofe, ein Frauenstift. Aber wie die noch heute erhaltene, aus römischen Mauern von Adela geschaffene Kirche
dieses Stiftes, einer der wertvollsten Bauten Deutschlands^, beweist, waren die Merowinger an dieser Stelle wie in
Neumagen an der Mosel die Erben alten römischen Besitzes. Wahrscheinlich ist die fränkische Pfalz aus einer römi-
0 Über fränkische Reste in Pfalzel vgl. Veit in Bonner Jahrbü cher 78 (1884), Seite 12.
2) Eff mann, Heiligkrenz und Pfalzel. Freibnrg 1890.