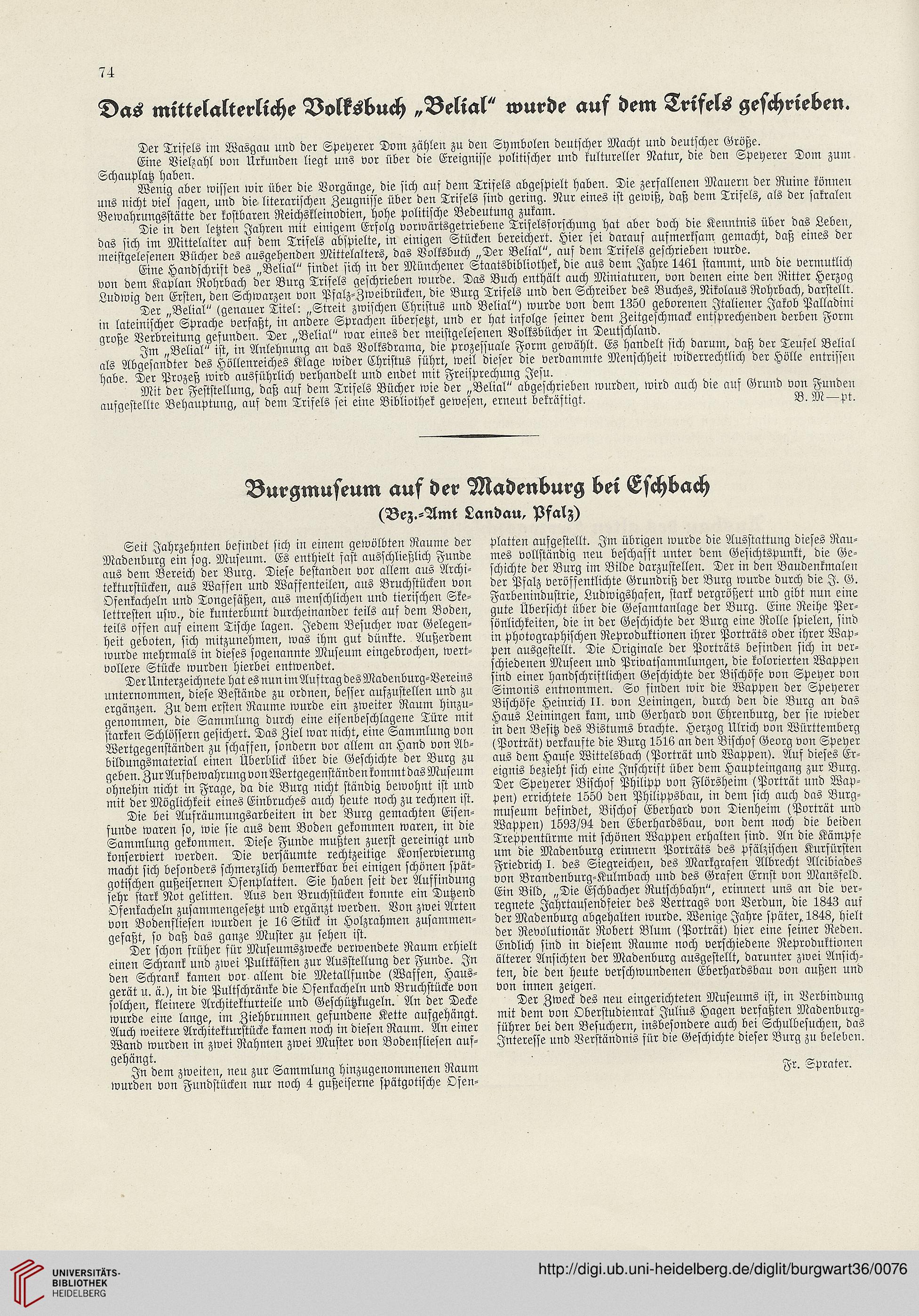74
Das mittelalterliche Volksbuch „Belial" wurde auf dem Trifels geschrieben.
Der Trifels im Wasgau und der Speyerer Dom zählen zu den Symbolen deutscher Macht und deutscher Größe.
Eine Vielzahl von Urkunden liegt uns vor über die Ereignisse politischer und kultureller Natur, die den Speyerer Dom zum
Schauplatz haben.
Wenig aber wissen mir über die Vorgänge, die sich auf dem Trifels abgespielt haben. Die zerfallenen Mauern der Ruine können
uns nicht viel sagen, und die literarischen Zeugnisse über den Trifels sind gering. Nur eines ist gewiß, daß dem Trifels, als der sakralen
Bewährungsstätte der kostbaren Reichskleinodien, hohe politische Bedeutung zukam.
Die in den letzten Jahren mit einigem Erfolg vorwärtsgetriebene Trifelsforschung hat aber doch die Kenntnis über das Leben,
das sich im Mittelalter auf dem Trifels abspielte, in einigen Stücken bereichert. Hier sei darauf aufmerksam gemacht, daß eines der
meistgelesenen Bücher des ausgehenden Mittelalters, das Volksbuch „Der Belial", auf dem Trifels geschrieben wurde.
Eine Handschrift des „Belial" findet sich in der Münchener Staatsbibliothek, die aus dem Jahre 1461 stammt, und die vermutlich
von dem Kaplan Rohrbach der Burg Trifels geschrieben wurde. Das Buch enthält auch Miniaturen, von denen eine den Ritter Herzog
Ludwig den Ersten, den Schwarzen von Pfalz-Zweibrücken, die Burg Trifels und den Schreiber des Buches, Nikolaus Rohrbach, darstellt.
Der „Belial" (genauer Titel: „Streit zwischen Christus und Belial") wurde von dem 1350 geborenen Italiener Jakob Pälladini
in lateinischer Sprache verfaßt, in andere Sprachen übersetzt, und er hat infolge seiner dem Zeitgeschmack entsprechenden derben Form
große Verbreitung gefunden. Der „Belial" war eines der meistgelesenen Volksbücher in Deutschland.
Im „Belial" ist, in Anlehnung an das Volksdrama, die prozessuale Form gewählt. Es handelt sich darum, daß der Teufel Belial
als Abgesandter des Höllenreiches Klage wider Christus führt, weil dieser die verdammte Menschheit widerrechtlich der Hölle entrissen
habe. Der Prozeß wird ausführlich verhandelt und endet mit Freisprechung Jesu.
Mit der Feststellung, daß auf dem Trifels Bücher wie der „Belial" abgeschrieben wurden, wird auch die auf Grund von Funden
aufgestellte Behauptung, aus dem Trifels sei eine Bibliothek gewesen, erneut bekräftigt. B. M—Pt.
Burgmuseum auf der Madenburg bei Eschbach
(Bez.-Amt Landau. Pfalz)
Seit Jahrzehnten befindet sich in einem gewölbten Raume der
Madenburg ein sog. Museum. Es enthielt fast ausschließlich Funde
aus dem Bereich der Burg. Diese bestanden vor allem aus Archi-
tekturstücken, aus Waffen und Waffenteilen, aus Bruchstücken von
Ofenkacheln und Tongefäßen, aus menschlichen und tierischen Ske-
lettresten usw., die kunterbunt durcheinander teils auf dem Boden,
teils offen auf einen: Tische lagen. Jedem Besucher war Gelegen-
heit geboten, sich mitzunehmen, was ihn: gut dünkte. Außerdem
wurde mehrmals in dieses sogenannte Museum eingebrochen, wert-
vollere Stücke wurden hierbei entwendet.
Der Unterzeichnete hat es nun imAuftrag des Madenburg-Vereins
unternommen, diese Bestände zu ordnen, besser aufzustellen und zu
ergänzen. Zu dem ersten Raume wurde ein zweiter Raum hinzu-
genommen, die Sammlung durch eine eisenbeschlagene Türe mit
starken Schlössern gesichert. Das Ziel war nicht, eine Sammlung von
Wertgegenständen zu schaffen, sondern Vvr allen: an Hand von Ab-
bildungsmaterial einen Überblick über die Geschichte der Burg zu
geben. ZurAufbewahrung vonWertgegenständen kommtdas Museum
ohnehin nicht in Frage, da die Burg nicht ständig bewohnt ist und
mit der Möglichkeit eines Einbruches auch heute noch zu rechnen ist.
Die bei Aufräumungsarbeiten in der Burg gemachten Eisen-
funde waren so, wie sie aus dem Boden gekommen waren, in die
Sammlung gekommen. Diese Funde mußten zuerst gereinigt und
konserviert werden. Die versäumte rechtzeitige Konservierung
macht sich besonders schmerzlich bemerkbar bei einigen schönen spät-
gotischen gußeisernen Ofenplatten. Sie haben seit der Auffindung
sehr stark Not gelitten. Aus den Bruchstücken konnte ein Dutzend
Ofenkacheln zusammengesetzt und ergänzt werden. Bon zwei Arten
von Bodenfliesen wurden je 16 Stück in Holzrahmen zusammen-
gefaßt, so daß das ganze Muster zu sehen ist.
Der schon früher für Museumszwecke verwendete Raum erhielt
einen Schrank und zwei Pultkästen zur Ausstellung der Funde. In
den Schrank kamen vor allem die Metallsunde (Waffen, Haus-
gerät u. ä.), in die Pultschränke die Ofenkacheln und Bruchstücke von
solchen, kleinere Architekturteile und Geschützkugeln. An der Decke
wurde eine lange, in: Ziehbrunnen gefundene Kette aufgehängt.
Auch weitere Architekturstücke kamen noch in diesen Raum. An einer
Wand wurden in zwei Rahmen zwei Muster von Bodenfliesen auf-
gehängt.
In dem zweiten, neu zur Sammlung hinzugenommenen Raum
wurden von Mundstücken nur noch 4 gußeiserne spätgotische Ofen-
platten aufgestellt. Im übrigen wurde die Ausstattung dieses Rau-
mes vollständig neu beschafft unter dem Gesichtspunkt, die Ge-
schichte der Burg im Bilde darzustellen. Der in den Baudenkmalen
der Pfalz veröffentlichte Grundriß der Burg wurde durch die I. G.
Farbenindustrie, Ludwigshafen, stark vergrößert und gibt nun eine
gute Übersicht über die Gesamtanlage der Burg. Eine Reihe Per-
sönlichkeiten, die in der Geschichte der Burg eine Rolle spielen, sind
in photographischen Reproduktionen ihrer Porträts oder ihrer Wap-
pen ausgestellt. Die Originale der Porträts befinden sich in ver-
schiedenen Museen und Privatsammlungen, die kolorierten Wappen
sind einer handschriftlichen Geschichte der Bischöfe von Speyer von
Simonis entnommen. So finden wir die Wappen der Speyerer
Bischöfe Heinrich II. von Leiningen, durch den die Burg an das
Haus Leiningen kam, und Gerhard von Ehrenburg, der sie wieder
in den Besitz des Bistums brachte. Herzog Ulrich von Württemberg
(Porträt) verkaufte die Burg 1516 an den Bischof Georg von Speyer
aus dem Hause Wittelsbach (Porträt und Wappen). Auf dieses Er-
eignis bezieht sich eine Inschrift über dem Haupteingang zur Burg.
Der Speyerer Bischof Philipp von Flörsheim (Porträt und Wap-
pen) errichtete 1550 den Philippsbau, in dem sich auch das Burg-
museum befindet, Bischof Eberhard von Dienheim (Porträt und
Wappen) 1593/94 den Eberhardsbau, von dem noch die beiden
Treppentürme mit schönen Wappen erhalten sind. An die Kämpfe
um die Madenburg erinnern Porträts des pfälzischen Kurfürsten
Friedrich I. des Siegreichen, des Markgrafen Albrecht Alcibiades
von Brandenburg-Kulmbach und des Grafen Ernst von Mansfeld.
Ein Bild, „Die Eschbacher Rutschbahn", erinnert uns an die ver-
regnete Jahrtausendfeier des Vertrags von Verdun, die 1843 au:
der Madenburg abgehalten wurde. Wenige Jahre später, 1848, hielt
der Revolutionär Robert Blum (Porträt) hier eine seiner Reden.
Endlich sind in diesem Raume noch verschiedene Reproduktionen
älterer Ansichten der Madenburg ausgestellt, darunter zwei Ansich-
ten, die den heute verschwundenen Eberhardsbau von außen und
von innen zeigen.
Der Zweck des neu eingerichteten Museums ist, in Verbindung
mit dem von Oberstudienrat Julius Hagen verfaßten Madenburg-
führer bei den Besuchern, insbesondere auch bei Schulbesuchen, das
Interesse und Verständnis für die Geschichte dieser Burg zu beleben.
Fr. Sprater.
Das mittelalterliche Volksbuch „Belial" wurde auf dem Trifels geschrieben.
Der Trifels im Wasgau und der Speyerer Dom zählen zu den Symbolen deutscher Macht und deutscher Größe.
Eine Vielzahl von Urkunden liegt uns vor über die Ereignisse politischer und kultureller Natur, die den Speyerer Dom zum
Schauplatz haben.
Wenig aber wissen mir über die Vorgänge, die sich auf dem Trifels abgespielt haben. Die zerfallenen Mauern der Ruine können
uns nicht viel sagen, und die literarischen Zeugnisse über den Trifels sind gering. Nur eines ist gewiß, daß dem Trifels, als der sakralen
Bewährungsstätte der kostbaren Reichskleinodien, hohe politische Bedeutung zukam.
Die in den letzten Jahren mit einigem Erfolg vorwärtsgetriebene Trifelsforschung hat aber doch die Kenntnis über das Leben,
das sich im Mittelalter auf dem Trifels abspielte, in einigen Stücken bereichert. Hier sei darauf aufmerksam gemacht, daß eines der
meistgelesenen Bücher des ausgehenden Mittelalters, das Volksbuch „Der Belial", auf dem Trifels geschrieben wurde.
Eine Handschrift des „Belial" findet sich in der Münchener Staatsbibliothek, die aus dem Jahre 1461 stammt, und die vermutlich
von dem Kaplan Rohrbach der Burg Trifels geschrieben wurde. Das Buch enthält auch Miniaturen, von denen eine den Ritter Herzog
Ludwig den Ersten, den Schwarzen von Pfalz-Zweibrücken, die Burg Trifels und den Schreiber des Buches, Nikolaus Rohrbach, darstellt.
Der „Belial" (genauer Titel: „Streit zwischen Christus und Belial") wurde von dem 1350 geborenen Italiener Jakob Pälladini
in lateinischer Sprache verfaßt, in andere Sprachen übersetzt, und er hat infolge seiner dem Zeitgeschmack entsprechenden derben Form
große Verbreitung gefunden. Der „Belial" war eines der meistgelesenen Volksbücher in Deutschland.
Im „Belial" ist, in Anlehnung an das Volksdrama, die prozessuale Form gewählt. Es handelt sich darum, daß der Teufel Belial
als Abgesandter des Höllenreiches Klage wider Christus führt, weil dieser die verdammte Menschheit widerrechtlich der Hölle entrissen
habe. Der Prozeß wird ausführlich verhandelt und endet mit Freisprechung Jesu.
Mit der Feststellung, daß auf dem Trifels Bücher wie der „Belial" abgeschrieben wurden, wird auch die auf Grund von Funden
aufgestellte Behauptung, aus dem Trifels sei eine Bibliothek gewesen, erneut bekräftigt. B. M—Pt.
Burgmuseum auf der Madenburg bei Eschbach
(Bez.-Amt Landau. Pfalz)
Seit Jahrzehnten befindet sich in einem gewölbten Raume der
Madenburg ein sog. Museum. Es enthielt fast ausschließlich Funde
aus dem Bereich der Burg. Diese bestanden vor allem aus Archi-
tekturstücken, aus Waffen und Waffenteilen, aus Bruchstücken von
Ofenkacheln und Tongefäßen, aus menschlichen und tierischen Ske-
lettresten usw., die kunterbunt durcheinander teils auf dem Boden,
teils offen auf einen: Tische lagen. Jedem Besucher war Gelegen-
heit geboten, sich mitzunehmen, was ihn: gut dünkte. Außerdem
wurde mehrmals in dieses sogenannte Museum eingebrochen, wert-
vollere Stücke wurden hierbei entwendet.
Der Unterzeichnete hat es nun imAuftrag des Madenburg-Vereins
unternommen, diese Bestände zu ordnen, besser aufzustellen und zu
ergänzen. Zu dem ersten Raume wurde ein zweiter Raum hinzu-
genommen, die Sammlung durch eine eisenbeschlagene Türe mit
starken Schlössern gesichert. Das Ziel war nicht, eine Sammlung von
Wertgegenständen zu schaffen, sondern Vvr allen: an Hand von Ab-
bildungsmaterial einen Überblick über die Geschichte der Burg zu
geben. ZurAufbewahrung vonWertgegenständen kommtdas Museum
ohnehin nicht in Frage, da die Burg nicht ständig bewohnt ist und
mit der Möglichkeit eines Einbruches auch heute noch zu rechnen ist.
Die bei Aufräumungsarbeiten in der Burg gemachten Eisen-
funde waren so, wie sie aus dem Boden gekommen waren, in die
Sammlung gekommen. Diese Funde mußten zuerst gereinigt und
konserviert werden. Die versäumte rechtzeitige Konservierung
macht sich besonders schmerzlich bemerkbar bei einigen schönen spät-
gotischen gußeisernen Ofenplatten. Sie haben seit der Auffindung
sehr stark Not gelitten. Aus den Bruchstücken konnte ein Dutzend
Ofenkacheln zusammengesetzt und ergänzt werden. Bon zwei Arten
von Bodenfliesen wurden je 16 Stück in Holzrahmen zusammen-
gefaßt, so daß das ganze Muster zu sehen ist.
Der schon früher für Museumszwecke verwendete Raum erhielt
einen Schrank und zwei Pultkästen zur Ausstellung der Funde. In
den Schrank kamen vor allem die Metallsunde (Waffen, Haus-
gerät u. ä.), in die Pultschränke die Ofenkacheln und Bruchstücke von
solchen, kleinere Architekturteile und Geschützkugeln. An der Decke
wurde eine lange, in: Ziehbrunnen gefundene Kette aufgehängt.
Auch weitere Architekturstücke kamen noch in diesen Raum. An einer
Wand wurden in zwei Rahmen zwei Muster von Bodenfliesen auf-
gehängt.
In dem zweiten, neu zur Sammlung hinzugenommenen Raum
wurden von Mundstücken nur noch 4 gußeiserne spätgotische Ofen-
platten aufgestellt. Im übrigen wurde die Ausstattung dieses Rau-
mes vollständig neu beschafft unter dem Gesichtspunkt, die Ge-
schichte der Burg im Bilde darzustellen. Der in den Baudenkmalen
der Pfalz veröffentlichte Grundriß der Burg wurde durch die I. G.
Farbenindustrie, Ludwigshafen, stark vergrößert und gibt nun eine
gute Übersicht über die Gesamtanlage der Burg. Eine Reihe Per-
sönlichkeiten, die in der Geschichte der Burg eine Rolle spielen, sind
in photographischen Reproduktionen ihrer Porträts oder ihrer Wap-
pen ausgestellt. Die Originale der Porträts befinden sich in ver-
schiedenen Museen und Privatsammlungen, die kolorierten Wappen
sind einer handschriftlichen Geschichte der Bischöfe von Speyer von
Simonis entnommen. So finden wir die Wappen der Speyerer
Bischöfe Heinrich II. von Leiningen, durch den die Burg an das
Haus Leiningen kam, und Gerhard von Ehrenburg, der sie wieder
in den Besitz des Bistums brachte. Herzog Ulrich von Württemberg
(Porträt) verkaufte die Burg 1516 an den Bischof Georg von Speyer
aus dem Hause Wittelsbach (Porträt und Wappen). Auf dieses Er-
eignis bezieht sich eine Inschrift über dem Haupteingang zur Burg.
Der Speyerer Bischof Philipp von Flörsheim (Porträt und Wap-
pen) errichtete 1550 den Philippsbau, in dem sich auch das Burg-
museum befindet, Bischof Eberhard von Dienheim (Porträt und
Wappen) 1593/94 den Eberhardsbau, von dem noch die beiden
Treppentürme mit schönen Wappen erhalten sind. An die Kämpfe
um die Madenburg erinnern Porträts des pfälzischen Kurfürsten
Friedrich I. des Siegreichen, des Markgrafen Albrecht Alcibiades
von Brandenburg-Kulmbach und des Grafen Ernst von Mansfeld.
Ein Bild, „Die Eschbacher Rutschbahn", erinnert uns an die ver-
regnete Jahrtausendfeier des Vertrags von Verdun, die 1843 au:
der Madenburg abgehalten wurde. Wenige Jahre später, 1848, hielt
der Revolutionär Robert Blum (Porträt) hier eine seiner Reden.
Endlich sind in diesem Raume noch verschiedene Reproduktionen
älterer Ansichten der Madenburg ausgestellt, darunter zwei Ansich-
ten, die den heute verschwundenen Eberhardsbau von außen und
von innen zeigen.
Der Zweck des neu eingerichteten Museums ist, in Verbindung
mit dem von Oberstudienrat Julius Hagen verfaßten Madenburg-
führer bei den Besuchern, insbesondere auch bei Schulbesuchen, das
Interesse und Verständnis für die Geschichte dieser Burg zu beleben.
Fr. Sprater.