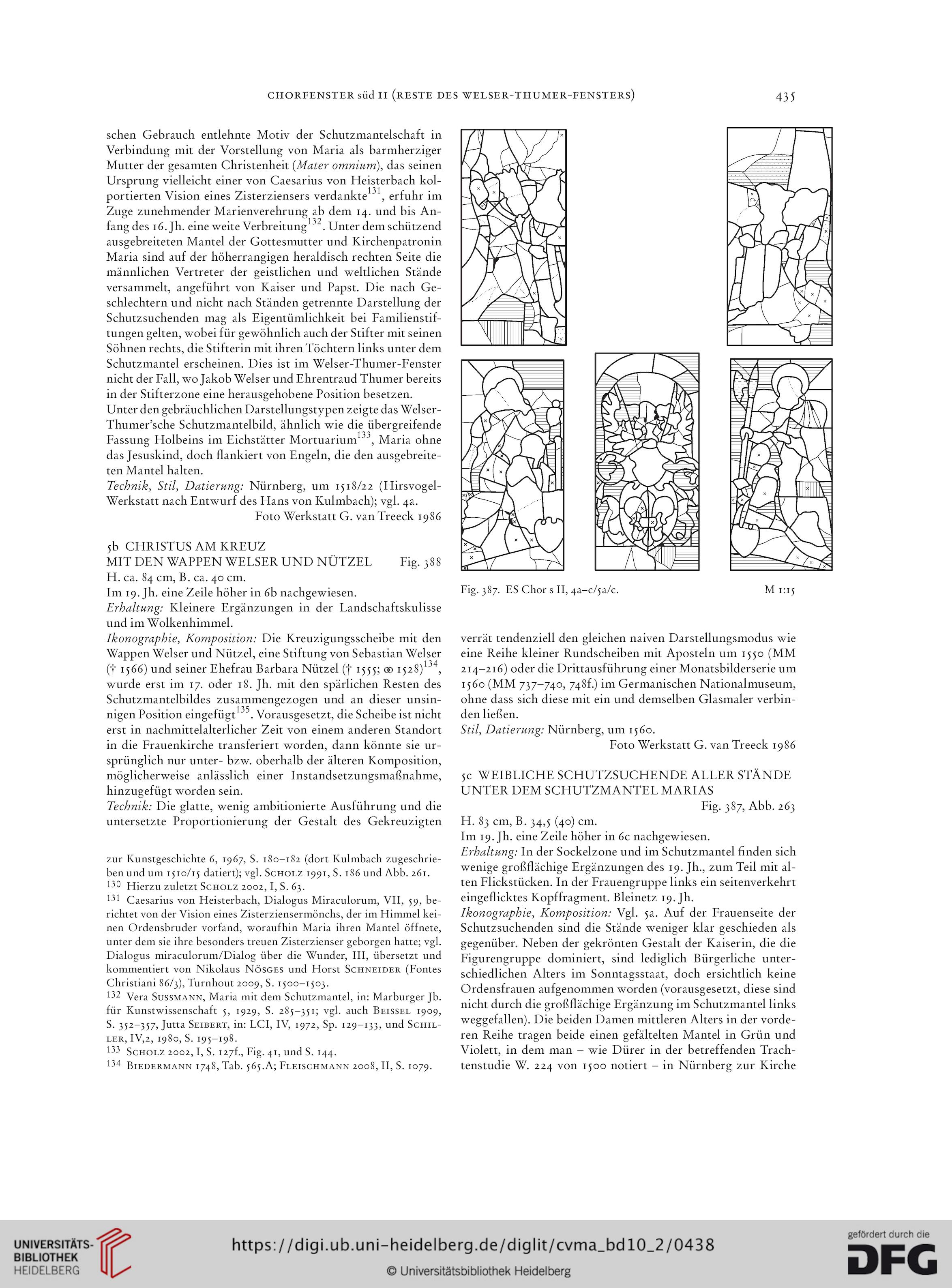CHORFENSTER süd II (RESTE DES WELSER-THUMER-FENSTERS)
43 5
sehen Gebrauch entlehnte Motiv der Schutzmantelschaft in
Verbindung mit der Vorstellung von Maria als barmherziger
Mutter der gesamten Christenheit (Mater omnium), das seinen
Ursprung vielleicht einer von Caesarius von Heisterbach kol-
portierten Vision eines Zisterziensers verdankte131, erfuhr im
Zuge zunehmender Marienverehrung ab dem 14. und bis An-
fang des i6.Jh. eine weite Verbreitung132. Unter dem schützend
ausgebreiteten Mantel der Gottesmutter und Kirchenpatronin
Maria sind auf der höherrangigen heraldisch rechten Seite die
männlichen Vertreter der geistlichen und weltlichen Stände
versammelt, angeführt von Kaiser und Papst. Die nach Ge-
schlechtern und nicht nach Ständen getrennte Darstellung der
Schutz suchenden mag als Eigentümlichkeit bei Familienstif-
tungen gelten, wobei für gewöhnlich auch der Stifter mit seinen
Söhnen rechts, die Stifterin mit ihren Töchtern links unter dem
Schutzmantel erscheinen. Dies ist im Welser-Thumer-Fenster
nicht der Fall, wo Jakob Welser und Ehrentraud Thumer bereits
in der Stifterzone eine herausgehobene Position besetzen.
Unter den gebräuchlichen Darstellungstypen zeigte das Welser-
Thumer’sche Schutzmantelbild, ähnlich wie die übergreifende
Fassung Holbeins im Eichstätter Mortuarium , Maria ohne
das Jesuskind, doch flankiert von Engeln, die den ausgebreite-
ten Mantel halten.
Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-
Werkstatt nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.
Foto Werkstatt G. van Treeck 1986
5b CHRISTUS AM KREUZ
MIT DEN WAPPEN WELSER UND NÜTZEL Fig. 388
H. ca. 84 cm, B. ca. 40 cm.
Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6b nachgewiesen.
Erhaltung: Kleinere Ergänzungen in der Landschaftskulisse
und im Wolkenhimmel.
Ikonographie, Komposition: Die Kreuzigungsscheibe mit den
Wappen Welser und Nützel, eine Stiftung von Sebastian Welser
(t 1566) und seiner Ehefrau Barbara Nützel (J 1555; ® 1528)134,
wurde erst im 17. oder 18. Jh. mit den spärlichen Resten des
Schutzmantelbildes zusammengezogen und an dieser unsin-
nigen Position eingefügt135. Vorausgesetzt, die Scheibe ist nicht
erst in nachmittelalterlicher Zeit von einem anderen Standort
in die Frauenkirche transferiert worden, dann könnte sie ur-
sprünglich nur unter- bzw. oberhalb der älteren Komposition,
möglicherweise anlässlich einer Instandsetzungsmaßnahme,
hinzugefügt worden sein.
Technik: Die glatte, wenig ambitionierte Ausführung und die
untersetzte Proportionierung der Gestalt des Gekreuzigten
zur Kunstgeschichte 6, 1967, S. 180-182 (dort Kulmbach zugeschrie-
ben und um 1510/15 datiert); vgl. Scholz 1991, S. 186 und Abb. 261.
DO Hierzu zuletzt Scholz 2002,1, S. 63.
Dl Caesarius von Heisterbach, Dialogus Miraculorum, VII, 59, be-
richtet von der Vision eines Zisterziensermönchs, der im Himmel kei-
nen Ordensbruder vorfand, woraufhin Maria ihren Mantel öffnete,
unter dem sie ihre besonders treuen Zisterzienser geborgen hatte; vgl.
Dialogus miraculorum/Dialog über die Wunder, III, übersetzt und
kommentiert von Nikolaus Nösges und Horst Schneider (Fontes
Christian! 86/3), Turnhout 2009, S. 1500-1503.
D2 Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, in: Marburger Jb.
für Kunstwissenschaft 5, 1929, S. 285-351; vgl. auch Beissel 1909,
S. 352-357, Jutta Seibert, in: LCI, IV, 1972, Sp. 129-133, und Schil-
ler, IV,2, 1980, S. 195-198.
D3 Scholz 2002,1, S. 127k, Fig. 41, und S. 144.
D4 Biedermann 1748, Tab. 565.A; Fleischmann 2008, II, S. 1079.
Fig. 387. ES Chor s II, 4a-c/5a/c.
M 1:15
verrät tendenziell den gleichen naiven Darstellungsmodus wie
eine Reihe kleiner Rundscheiben mit Aposteln um 1550 (MM
214-216) oder die Drittausführung einer Monatsbilderserie um
1560 (MM 737-740, 748E) im Germanischen Nationalmuseum,
ohne dass sich diese mit ein und demselben Glasmaler verbin-
den ließen.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1560.
Foto Werkstatt G. van Treeck 1986
5c WEIBLICHE SCHUTZSUCHENDE ALLER STÄNDE
UNTER DEM SCHUTZMANTEL MARIAS
Fig. 387, Abb. 263
H. 83 cm, B. 34,5 (40) cm.
Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6c nachgewiesen.
Erhaltung: In der Sockelzone und im Schutzmantel finden sich
wenige großflächige Ergänzungen des 19. Jh., zum Teil mit al-
ten Flickstücken. In der Frauengruppe links ein seitenverkehrt
eingeflicktes Kopffragment. Bleinetz 19. Jh.
Ikonographie, Komposition: Vgl. 5a. Auf der Frauenseite der
Schutzsuchenden sind die Stände weniger klar geschieden als
gegenüber. Neben der gekrönten Gestalt der Kaiserin, die die
Figurengruppe dominiert, sind lediglich Bürgerliche unter-
schiedlichen Alters im Sonntagsstaat, doch ersichtlich keine
Ordensfrauen aufgenommen worden (vorausgesetzt, diese sind
nicht durch die großflächige Ergänzung im Schutzmantel links
weggefallen). Die beiden Damen mittleren Alters in der vorde-
ren Reihe tragen beide einen gefältelten Mantel in Grün und
Violett, in dem man - wie Dürer in der betreffenden Trach-
tenstudie W. 224 von 1500 notiert - in Nürnberg zur Kirche
43 5
sehen Gebrauch entlehnte Motiv der Schutzmantelschaft in
Verbindung mit der Vorstellung von Maria als barmherziger
Mutter der gesamten Christenheit (Mater omnium), das seinen
Ursprung vielleicht einer von Caesarius von Heisterbach kol-
portierten Vision eines Zisterziensers verdankte131, erfuhr im
Zuge zunehmender Marienverehrung ab dem 14. und bis An-
fang des i6.Jh. eine weite Verbreitung132. Unter dem schützend
ausgebreiteten Mantel der Gottesmutter und Kirchenpatronin
Maria sind auf der höherrangigen heraldisch rechten Seite die
männlichen Vertreter der geistlichen und weltlichen Stände
versammelt, angeführt von Kaiser und Papst. Die nach Ge-
schlechtern und nicht nach Ständen getrennte Darstellung der
Schutz suchenden mag als Eigentümlichkeit bei Familienstif-
tungen gelten, wobei für gewöhnlich auch der Stifter mit seinen
Söhnen rechts, die Stifterin mit ihren Töchtern links unter dem
Schutzmantel erscheinen. Dies ist im Welser-Thumer-Fenster
nicht der Fall, wo Jakob Welser und Ehrentraud Thumer bereits
in der Stifterzone eine herausgehobene Position besetzen.
Unter den gebräuchlichen Darstellungstypen zeigte das Welser-
Thumer’sche Schutzmantelbild, ähnlich wie die übergreifende
Fassung Holbeins im Eichstätter Mortuarium , Maria ohne
das Jesuskind, doch flankiert von Engeln, die den ausgebreite-
ten Mantel halten.
Technik, Stil, Datierung: Nürnberg, um 1518/22 (Hirsvogel-
Werkstatt nach Entwurf des Hans von Kulmbach); vgl. 4a.
Foto Werkstatt G. van Treeck 1986
5b CHRISTUS AM KREUZ
MIT DEN WAPPEN WELSER UND NÜTZEL Fig. 388
H. ca. 84 cm, B. ca. 40 cm.
Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6b nachgewiesen.
Erhaltung: Kleinere Ergänzungen in der Landschaftskulisse
und im Wolkenhimmel.
Ikonographie, Komposition: Die Kreuzigungsscheibe mit den
Wappen Welser und Nützel, eine Stiftung von Sebastian Welser
(t 1566) und seiner Ehefrau Barbara Nützel (J 1555; ® 1528)134,
wurde erst im 17. oder 18. Jh. mit den spärlichen Resten des
Schutzmantelbildes zusammengezogen und an dieser unsin-
nigen Position eingefügt135. Vorausgesetzt, die Scheibe ist nicht
erst in nachmittelalterlicher Zeit von einem anderen Standort
in die Frauenkirche transferiert worden, dann könnte sie ur-
sprünglich nur unter- bzw. oberhalb der älteren Komposition,
möglicherweise anlässlich einer Instandsetzungsmaßnahme,
hinzugefügt worden sein.
Technik: Die glatte, wenig ambitionierte Ausführung und die
untersetzte Proportionierung der Gestalt des Gekreuzigten
zur Kunstgeschichte 6, 1967, S. 180-182 (dort Kulmbach zugeschrie-
ben und um 1510/15 datiert); vgl. Scholz 1991, S. 186 und Abb. 261.
DO Hierzu zuletzt Scholz 2002,1, S. 63.
Dl Caesarius von Heisterbach, Dialogus Miraculorum, VII, 59, be-
richtet von der Vision eines Zisterziensermönchs, der im Himmel kei-
nen Ordensbruder vorfand, woraufhin Maria ihren Mantel öffnete,
unter dem sie ihre besonders treuen Zisterzienser geborgen hatte; vgl.
Dialogus miraculorum/Dialog über die Wunder, III, übersetzt und
kommentiert von Nikolaus Nösges und Horst Schneider (Fontes
Christian! 86/3), Turnhout 2009, S. 1500-1503.
D2 Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, in: Marburger Jb.
für Kunstwissenschaft 5, 1929, S. 285-351; vgl. auch Beissel 1909,
S. 352-357, Jutta Seibert, in: LCI, IV, 1972, Sp. 129-133, und Schil-
ler, IV,2, 1980, S. 195-198.
D3 Scholz 2002,1, S. 127k, Fig. 41, und S. 144.
D4 Biedermann 1748, Tab. 565.A; Fleischmann 2008, II, S. 1079.
Fig. 387. ES Chor s II, 4a-c/5a/c.
M 1:15
verrät tendenziell den gleichen naiven Darstellungsmodus wie
eine Reihe kleiner Rundscheiben mit Aposteln um 1550 (MM
214-216) oder die Drittausführung einer Monatsbilderserie um
1560 (MM 737-740, 748E) im Germanischen Nationalmuseum,
ohne dass sich diese mit ein und demselben Glasmaler verbin-
den ließen.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1560.
Foto Werkstatt G. van Treeck 1986
5c WEIBLICHE SCHUTZSUCHENDE ALLER STÄNDE
UNTER DEM SCHUTZMANTEL MARIAS
Fig. 387, Abb. 263
H. 83 cm, B. 34,5 (40) cm.
Im 19. Jh. eine Zeile höher in 6c nachgewiesen.
Erhaltung: In der Sockelzone und im Schutzmantel finden sich
wenige großflächige Ergänzungen des 19. Jh., zum Teil mit al-
ten Flickstücken. In der Frauengruppe links ein seitenverkehrt
eingeflicktes Kopffragment. Bleinetz 19. Jh.
Ikonographie, Komposition: Vgl. 5a. Auf der Frauenseite der
Schutzsuchenden sind die Stände weniger klar geschieden als
gegenüber. Neben der gekrönten Gestalt der Kaiserin, die die
Figurengruppe dominiert, sind lediglich Bürgerliche unter-
schiedlichen Alters im Sonntagsstaat, doch ersichtlich keine
Ordensfrauen aufgenommen worden (vorausgesetzt, diese sind
nicht durch die großflächige Ergänzung im Schutzmantel links
weggefallen). Die beiden Damen mittleren Alters in der vorde-
ren Reihe tragen beide einen gefältelten Mantel in Grün und
Violett, in dem man - wie Dürer in der betreffenden Trach-
tenstudie W. 224 von 1500 notiert - in Nürnberg zur Kirche