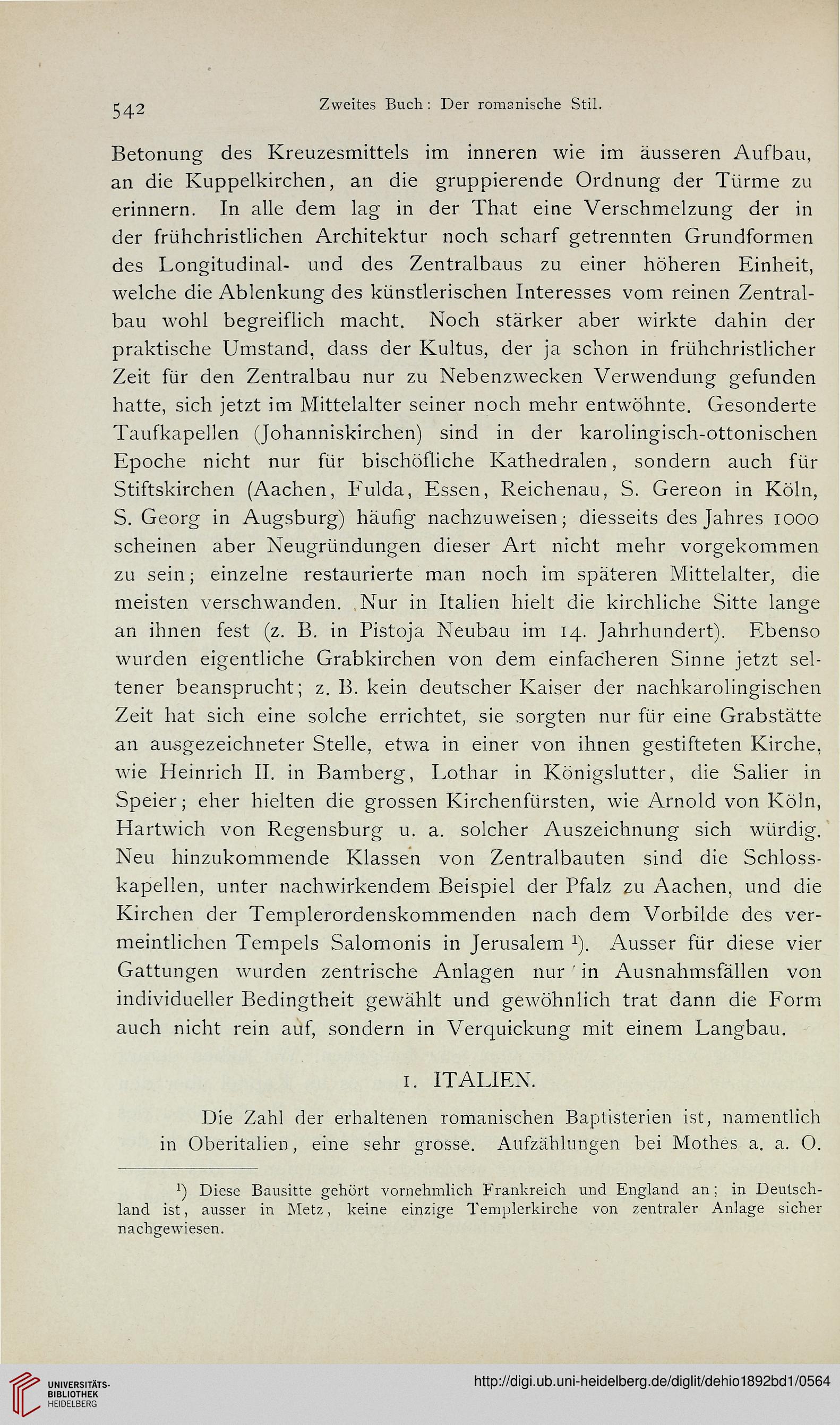542
Zweites Buch : Der romanische Stil.
Betonung des Kreuzesmittels im inneren wie im äusseren Aufbau,
an die Kuppelkirchen, an die gruppierende Ordnung der Türme zu
erinnern. In alle dem lag in der That eine Verschmelzung der in
der frühchristlichen Architektur noch scharf getrennten Grundformen
des Longitudinal- und des Zentralbaus zu einer höheren Einheit,
welche die Ablenkung des künstlerischen Interesses vom reinen Zentral-
bau wohl begreiflich macht. Noch stärker aber wirkte dahin der
praktische Umstand, dass der Kultus, der ja schon in frühchristlicher
Zeit für den Zentralbau nur zu Nebenzwecken Verwendung gefunden
hatte, sich jetzt im Mittelalter seiner noch mehr entwöhnte. Gesonderte
Taufkapellen (Johanniskirchen) sind in der karolingisch-ottonischen
Epoche nicht nur für bischöfliche Kathedralen, sondern auch für
Stiftskirchen (Aachen, Fulda, Essen, Reichenau, S. Gereon in Köln,
S. Georg in Augsburg) häufig nachzuweisen; diesseits des Jahres iooo
scheinen aber Neugründungen dieser Art nicht mehr vorgekommen
zu sein; einzelne restaurierte man noch im späteren Mittelalter, die
meisten verschwanden. Nur in Italien hielt die kirchliche Sitte lange
an ihnen fest (z. B. in Pistoja Neubau im 14. Jahrhundert). Ebenso
wurden eigentliche Grabkirchen von dem einfacheren Sinne jetzt sel-
tener beansprucht; z. B. kein deutscher Kaiser der nachkarolingischen
Zeit hat sich eine solche errichtet, sie sorgten nur für eine Grabstätte
an ausgezeichneter Stelle, etwa in einer von ihnen gestifteten Kirche,
wie Heinrich II. in Bamberg, Lothar in Königslutter, die Salier in
Speier; eher hielten die grossen Kirchenfürsten, wie Arnold von Köln,
Hartwich von Regensburg u. a. solcher Auszeichnung sich würdig.
Neu hinzukommende Klassen von Zentralbauten sind die Schloss-
kapellen, unter nachwirkendem Beispiel der Pfalz zu Aachen, und die
Kirchen der Templerordenskommenden nach dem Vorbilde des ver-
meintlichen Tempels Salomonis in Jerusalem 1). Ausser für diese vier
Gattungen wurden zentrische Anlagen nur ' in Ausnahmsfällen von
individueller Bedingtheit gewählt und gewöhnlich trat dann die Form
auch nicht rein auf, sondern in Verquickung mit einem Langbau.
1. ITALIEN.
Die Zahl der erhaltenen romanischen Baptisterien ist, namentlich
in Oberitalien, eine sehr grosse. Aufzählungen bei Mothes a. a. O.
!) Diese Bausitte gehört vornehmlich Frankreich und England an; in Deutsch-
land ist, ausser in Metz, keine einzige Templerkirche von zentraler Anlage sicher
nachgewiesen.
Zweites Buch : Der romanische Stil.
Betonung des Kreuzesmittels im inneren wie im äusseren Aufbau,
an die Kuppelkirchen, an die gruppierende Ordnung der Türme zu
erinnern. In alle dem lag in der That eine Verschmelzung der in
der frühchristlichen Architektur noch scharf getrennten Grundformen
des Longitudinal- und des Zentralbaus zu einer höheren Einheit,
welche die Ablenkung des künstlerischen Interesses vom reinen Zentral-
bau wohl begreiflich macht. Noch stärker aber wirkte dahin der
praktische Umstand, dass der Kultus, der ja schon in frühchristlicher
Zeit für den Zentralbau nur zu Nebenzwecken Verwendung gefunden
hatte, sich jetzt im Mittelalter seiner noch mehr entwöhnte. Gesonderte
Taufkapellen (Johanniskirchen) sind in der karolingisch-ottonischen
Epoche nicht nur für bischöfliche Kathedralen, sondern auch für
Stiftskirchen (Aachen, Fulda, Essen, Reichenau, S. Gereon in Köln,
S. Georg in Augsburg) häufig nachzuweisen; diesseits des Jahres iooo
scheinen aber Neugründungen dieser Art nicht mehr vorgekommen
zu sein; einzelne restaurierte man noch im späteren Mittelalter, die
meisten verschwanden. Nur in Italien hielt die kirchliche Sitte lange
an ihnen fest (z. B. in Pistoja Neubau im 14. Jahrhundert). Ebenso
wurden eigentliche Grabkirchen von dem einfacheren Sinne jetzt sel-
tener beansprucht; z. B. kein deutscher Kaiser der nachkarolingischen
Zeit hat sich eine solche errichtet, sie sorgten nur für eine Grabstätte
an ausgezeichneter Stelle, etwa in einer von ihnen gestifteten Kirche,
wie Heinrich II. in Bamberg, Lothar in Königslutter, die Salier in
Speier; eher hielten die grossen Kirchenfürsten, wie Arnold von Köln,
Hartwich von Regensburg u. a. solcher Auszeichnung sich würdig.
Neu hinzukommende Klassen von Zentralbauten sind die Schloss-
kapellen, unter nachwirkendem Beispiel der Pfalz zu Aachen, und die
Kirchen der Templerordenskommenden nach dem Vorbilde des ver-
meintlichen Tempels Salomonis in Jerusalem 1). Ausser für diese vier
Gattungen wurden zentrische Anlagen nur ' in Ausnahmsfällen von
individueller Bedingtheit gewählt und gewöhnlich trat dann die Form
auch nicht rein auf, sondern in Verquickung mit einem Langbau.
1. ITALIEN.
Die Zahl der erhaltenen romanischen Baptisterien ist, namentlich
in Oberitalien, eine sehr grosse. Aufzählungen bei Mothes a. a. O.
!) Diese Bausitte gehört vornehmlich Frankreich und England an; in Deutsch-
land ist, ausser in Metz, keine einzige Templerkirche von zentraler Anlage sicher
nachgewiesen.