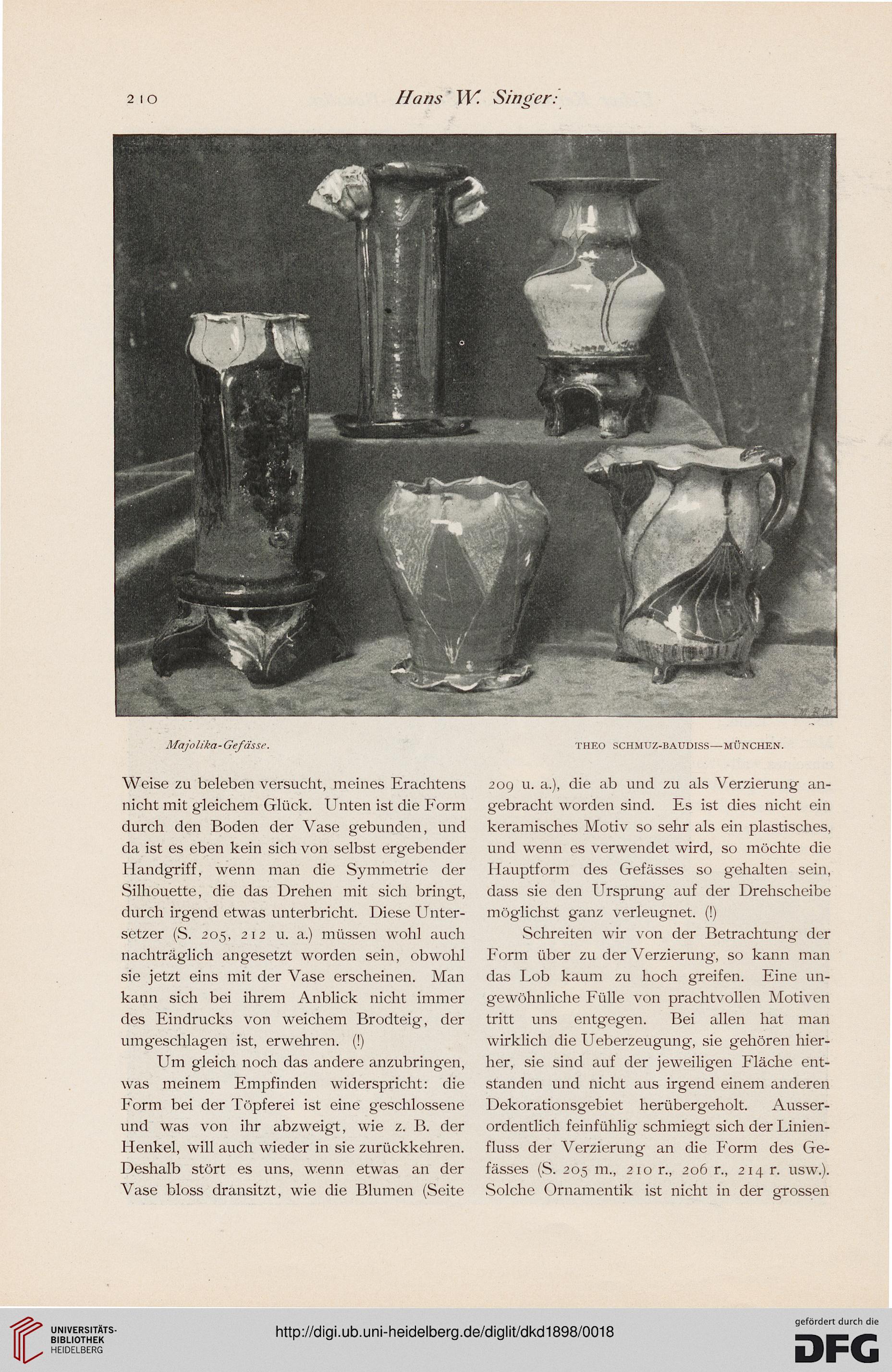2 I O
Hans' W. Singer:
Majolika-Gefässe.
THEO SCHMUZ-BAUDISS—MÜNCHEN.
Weise zu beleben versucht, meines Erachtens
nicht mit gleichem Glück. Unten ist die Form
durch den Boden der Vase gebunden, und
da ist es eben kein sich von selbst ergebender
Handgriff, wenn man die Symmetrie der
Silhouette, die das Drehen mit sich bringt,
durch irgend etwas unterbricht. Diese Unter-
setzer (S. 205, 212 u. a.) müssen wohl auch
nachträglich angesetzt worden sein, obwohl
sie jetzt eins mit der Vase erscheinen. Man
kann sich bei ihrem Anblick nicht immer
des Eindrucks von weichem Brodteig, der
umgeschlagen ist, erwehren. (!)
Um gleich noch das andere anzubringen,
was meinem Empfinden widerspricht: die
Form bei der Töpferei ist eine geschlossene
und was von ihr abzweigt, wie z. B. der
Henkel, will auch wieder in sie zurückkehren.
Deshalb stört es uns, wenn etwas an der
Vase bloss dransitzt, wie die Blumen (Seite
209 u. a.), die ab und zu als Verzierung an-
gebracht worden sind. Es ist dies nicht ein
keramisches Motiv so sehr als ein plastisches,
und wenn es verwendet wird, so möchte die
Hauptform des Gefässes so gehalten sein,
dass sie den Ursprung auf der Drehscheibe
möglichst ganz verleugnet. (!)
Schreiten wir von der Betrachtung der
Form über zu der Verzierung, so kann man
das Lob kaum zu hoch greifen. Eine un-
gewöhnliche Fülle von prachtvollen Motiven
tritt uns entgegen. Bei allen hat man
wirklich die Ueberzeugung, sie gehören hier-
her, sie sind auf der jeweiligen Fläche ent-
standen und nicht aus irgend einem anderen
Dekorationsgebiet herübergeholt. Ausser-
ordentlich feinfühlig schmiegt sich der Linien-
fluss der Verzierung an die Form des Ge-
fässes (S. 205 m., 210 r., 206 r., 214 r. usw.).
Solche Ornamentik ist nicht in der grossen
Hans' W. Singer:
Majolika-Gefässe.
THEO SCHMUZ-BAUDISS—MÜNCHEN.
Weise zu beleben versucht, meines Erachtens
nicht mit gleichem Glück. Unten ist die Form
durch den Boden der Vase gebunden, und
da ist es eben kein sich von selbst ergebender
Handgriff, wenn man die Symmetrie der
Silhouette, die das Drehen mit sich bringt,
durch irgend etwas unterbricht. Diese Unter-
setzer (S. 205, 212 u. a.) müssen wohl auch
nachträglich angesetzt worden sein, obwohl
sie jetzt eins mit der Vase erscheinen. Man
kann sich bei ihrem Anblick nicht immer
des Eindrucks von weichem Brodteig, der
umgeschlagen ist, erwehren. (!)
Um gleich noch das andere anzubringen,
was meinem Empfinden widerspricht: die
Form bei der Töpferei ist eine geschlossene
und was von ihr abzweigt, wie z. B. der
Henkel, will auch wieder in sie zurückkehren.
Deshalb stört es uns, wenn etwas an der
Vase bloss dransitzt, wie die Blumen (Seite
209 u. a.), die ab und zu als Verzierung an-
gebracht worden sind. Es ist dies nicht ein
keramisches Motiv so sehr als ein plastisches,
und wenn es verwendet wird, so möchte die
Hauptform des Gefässes so gehalten sein,
dass sie den Ursprung auf der Drehscheibe
möglichst ganz verleugnet. (!)
Schreiten wir von der Betrachtung der
Form über zu der Verzierung, so kann man
das Lob kaum zu hoch greifen. Eine un-
gewöhnliche Fülle von prachtvollen Motiven
tritt uns entgegen. Bei allen hat man
wirklich die Ueberzeugung, sie gehören hier-
her, sie sind auf der jeweiligen Fläche ent-
standen und nicht aus irgend einem anderen
Dekorationsgebiet herübergeholt. Ausser-
ordentlich feinfühlig schmiegt sich der Linien-
fluss der Verzierung an die Form des Ge-
fässes (S. 205 m., 210 r., 206 r., 214 r. usw.).
Solche Ornamentik ist nicht in der grossen