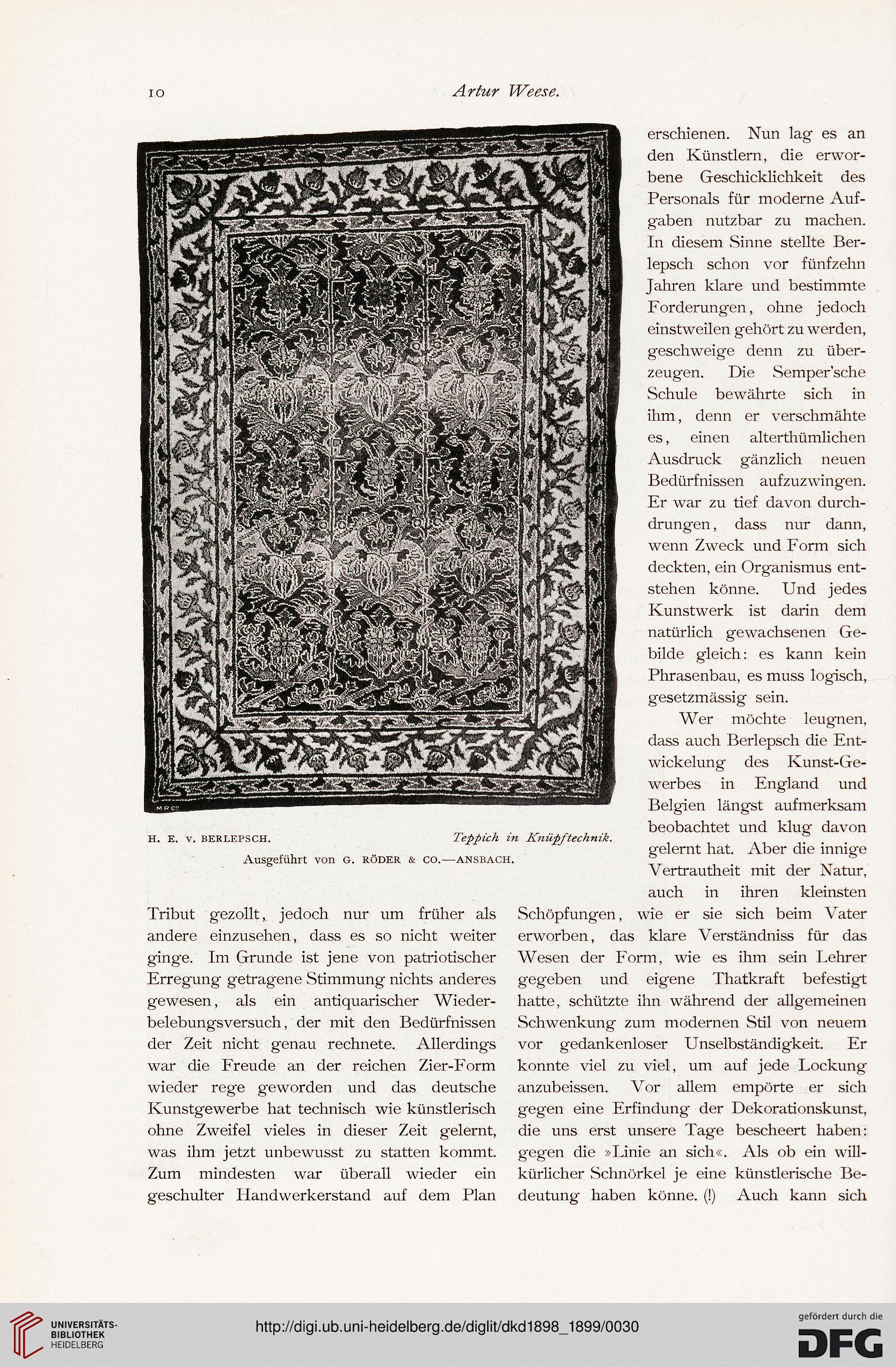10
Artur Weese.
h. e. v. berlepsch.
Ausgeführt von G. Röder & co.—Ansbach.
Tribut gezollt, jedoch nur um früher als
andere einzusehen, dass es so nicht weiter
ginge. Im Grunde ist jene von patriotischer
Erregung getragene Stimmung nichts anderes
gewesen, als ein antiquarischer Wieder-
belebungsversuch, der mit den Bedürfnissen
der Zeit nicht genau rechnete. Allerdings
war die Freude an der reichen Zier-Form
wieder rege geworden und das deutsche
Kunstgewerbe hat technisch wie künstlerisch
ohne Zweifel vieles in dieser Zeit gelernt,
was ihm jetzt unbewusst zu statten kommt.
Zum mindesten war überall wieder ein
geschulter Handwerkerstand auf dem Plan
erschienen. Nun lag es an
den Künstlern, die erwor-
bene Geschicklichkeit des
Personals für moderne Auf-
gaben nutzbar zu machen.
In diesem Sinne stellte Ber-
lepsch schon vor fünfzehn
Jahren klare und bestimmte
Forderungen, ohne jedoch
einstweilen gehört zu werden,
geschweige denn zu über-
zeugen. Die Semper'sche
Schule bewährte sich in
ihm, denn er verschmähte
es, einen alterthümlichen
Ausdruck gänzlich neuen
Bedürfnissen aufzuzwingen.
Er war zu tief davon durch-
drungen, dass nur dann,
wenn Zweck und Form sich
deckten, ein Organismus ent-
stehen könne. Und jedes
Kunstwerk ist darin dem
natürlich gewachsenen Ge-
bilde gleich: es kann kein
Phrasenbau, es muss logisch,
gesetzmässig sein.
Wer möchte leugnen,
dass auch Berlepsch die Ent-
wicklung des Kunst-Ge-
werbes in England und
Belgien längst aufmerksam
beobachtet und klug davon
gelernt hat. Aber die innige
Vertrautheit mit der Natur,
auch in ihren kleinsten
Schöpfungen, wie er sie sich beim Vater
erworben, das klare Verständniss für das
Wesen der Form, wie es ihm sein Lehrer
gegeben und eigene Thatkraft befestigt
hatte, schützte ihn während der allgemeinen
Schwenkung zum modernen Stil von neuem
vor gedankenloser Unselbständigkeit. Er
konnte viel zu viel, um auf jede Lockung
anzubeissen. Vor allem empörte er sich
gegen eine Erfindung der Dekorationskunst,
die uns erst unsere Tage bescheert haben:
gegen die »Linie an sich«. Als ob ein will-
kürlicher Schnörkel je eine künsüerische Be-
deutung haben könne. (!) Auch kann sich
Teppich in Knüpftechnik.
Artur Weese.
h. e. v. berlepsch.
Ausgeführt von G. Röder & co.—Ansbach.
Tribut gezollt, jedoch nur um früher als
andere einzusehen, dass es so nicht weiter
ginge. Im Grunde ist jene von patriotischer
Erregung getragene Stimmung nichts anderes
gewesen, als ein antiquarischer Wieder-
belebungsversuch, der mit den Bedürfnissen
der Zeit nicht genau rechnete. Allerdings
war die Freude an der reichen Zier-Form
wieder rege geworden und das deutsche
Kunstgewerbe hat technisch wie künstlerisch
ohne Zweifel vieles in dieser Zeit gelernt,
was ihm jetzt unbewusst zu statten kommt.
Zum mindesten war überall wieder ein
geschulter Handwerkerstand auf dem Plan
erschienen. Nun lag es an
den Künstlern, die erwor-
bene Geschicklichkeit des
Personals für moderne Auf-
gaben nutzbar zu machen.
In diesem Sinne stellte Ber-
lepsch schon vor fünfzehn
Jahren klare und bestimmte
Forderungen, ohne jedoch
einstweilen gehört zu werden,
geschweige denn zu über-
zeugen. Die Semper'sche
Schule bewährte sich in
ihm, denn er verschmähte
es, einen alterthümlichen
Ausdruck gänzlich neuen
Bedürfnissen aufzuzwingen.
Er war zu tief davon durch-
drungen, dass nur dann,
wenn Zweck und Form sich
deckten, ein Organismus ent-
stehen könne. Und jedes
Kunstwerk ist darin dem
natürlich gewachsenen Ge-
bilde gleich: es kann kein
Phrasenbau, es muss logisch,
gesetzmässig sein.
Wer möchte leugnen,
dass auch Berlepsch die Ent-
wicklung des Kunst-Ge-
werbes in England und
Belgien längst aufmerksam
beobachtet und klug davon
gelernt hat. Aber die innige
Vertrautheit mit der Natur,
auch in ihren kleinsten
Schöpfungen, wie er sie sich beim Vater
erworben, das klare Verständniss für das
Wesen der Form, wie es ihm sein Lehrer
gegeben und eigene Thatkraft befestigt
hatte, schützte ihn während der allgemeinen
Schwenkung zum modernen Stil von neuem
vor gedankenloser Unselbständigkeit. Er
konnte viel zu viel, um auf jede Lockung
anzubeissen. Vor allem empörte er sich
gegen eine Erfindung der Dekorationskunst,
die uns erst unsere Tage bescheert haben:
gegen die »Linie an sich«. Als ob ein will-
kürlicher Schnörkel je eine künsüerische Be-
deutung haben könne. (!) Auch kann sich
Teppich in Knüpftechnik.