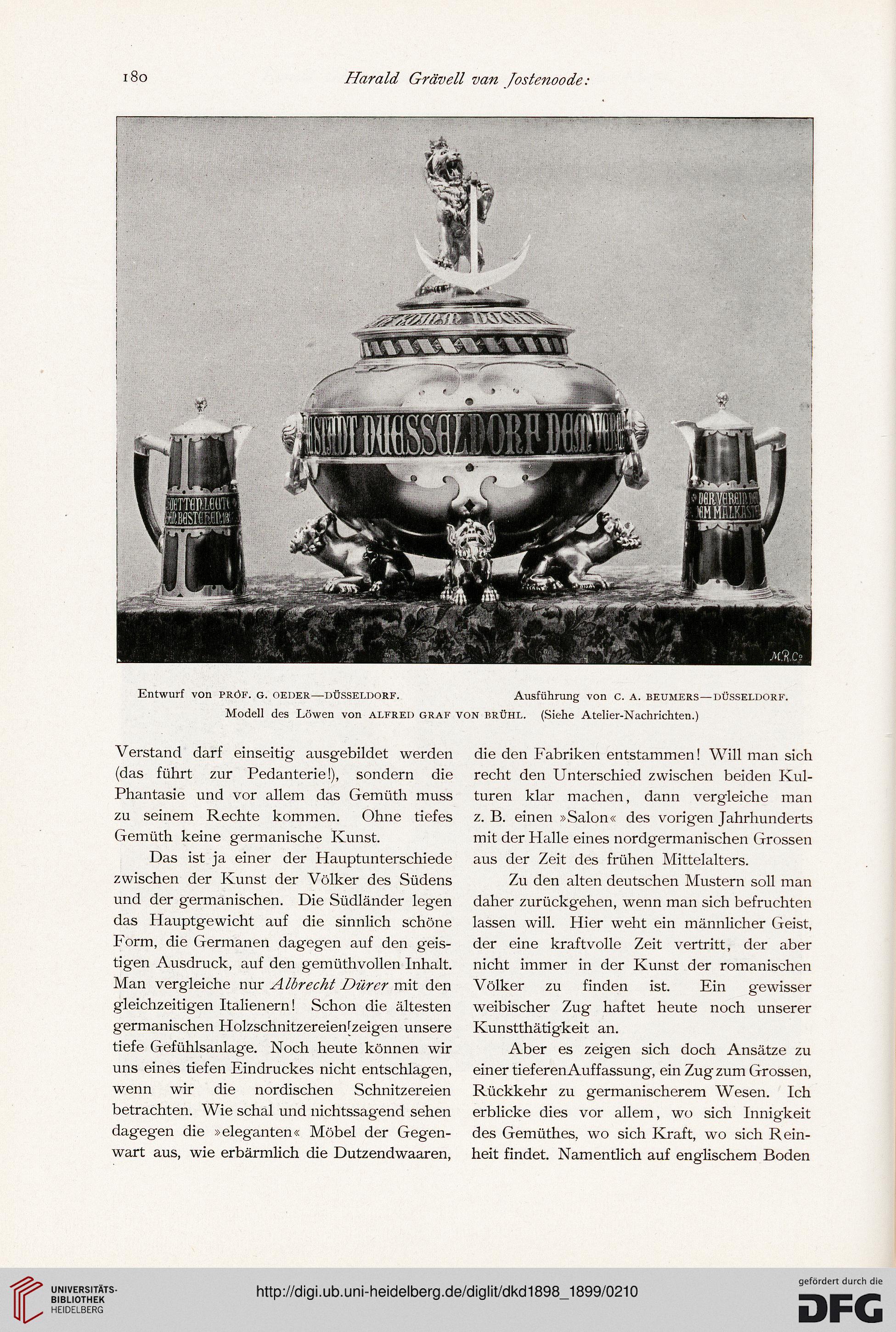i8o
Harald Grävell van Jostenoode:
Entwurf von prof. G. oeder—düsseldorf. Ausführung von c. a. beumers —düsseldorf.
Modell des Löwen von Alfred graf von Brühl. (Siehe Atelier-Nachrichten.)
Verstand darf einseitig ausgebildet werden
(das führt zur Pedanterie!), sondern die
Phantasie und vor allem das Gemüth muss
zu seinem Rechte kommen. Ohne tiefes
Gemüth keine germanische Kunst.
Das ist ja einer der Hauptunterschiede
zwischen der Kunst der Völker des Südens
und der germanischen. Die Südländer legen
das Hauptgewicht auf die sinnlich schöne
Form, die Germanen dagegen auf den geis-
tigen Ausdruck, auf den gemüthvollen Inhalt.
Man vergleiche nur Albrecht Dürer mit den
gleichzeitigen Italienern! Schon die ältesten
germanischen Holzschnitzereien[zeigen unsere
tiefe Gefühlsanlage. Noch heute können wir
uns eines tiefen Eindruckes nicht entschlagen,
wenn wir die nordischen Schnitzereien
betrachten. Wie schal und nichtssagend sehen
dagegen die »eleganten« Möbel der Gegen-
wart aus, wie erbärmlich die Dutzendwaaren,
die den Fabriken entstammen! Will man sich
recht den Unterschied zwischen beiden Kul-
turen klar machen, dann vergleiche man
z. B. einen »Salon« des vorigen Jahrhunderts
mit der Halle eines nordgermanischen Grossen
aus der Zeit des frühen Mittelalters.
Zu den alten deutschen Mustern soll man
daher zurückgehen, wenn man sich befruchten
lassen will. Hier weht ein männlicher Geist,
der eine kraftvolle Zeit vertritt, der aber
nicht immer in der Kunst der romanischen
Völker zu finden ist. Ein gewisser
weibischer Zug haftet heute noch unserer
Kunstthätigkeit an.
Aber es zeigen sich doch Ansätze zu
einer tieferen Auffassung, ein Zug zum Grossen,
Rückkehr zu germanischerem Wesen. Ich
erblicke dies vor allem, wo sich Innigkeit
des Gemüthes, wo sich Kraft, wo sich Rein-
heit findet. Namentlich auf englischem Boden
Harald Grävell van Jostenoode:
Entwurf von prof. G. oeder—düsseldorf. Ausführung von c. a. beumers —düsseldorf.
Modell des Löwen von Alfred graf von Brühl. (Siehe Atelier-Nachrichten.)
Verstand darf einseitig ausgebildet werden
(das führt zur Pedanterie!), sondern die
Phantasie und vor allem das Gemüth muss
zu seinem Rechte kommen. Ohne tiefes
Gemüth keine germanische Kunst.
Das ist ja einer der Hauptunterschiede
zwischen der Kunst der Völker des Südens
und der germanischen. Die Südländer legen
das Hauptgewicht auf die sinnlich schöne
Form, die Germanen dagegen auf den geis-
tigen Ausdruck, auf den gemüthvollen Inhalt.
Man vergleiche nur Albrecht Dürer mit den
gleichzeitigen Italienern! Schon die ältesten
germanischen Holzschnitzereien[zeigen unsere
tiefe Gefühlsanlage. Noch heute können wir
uns eines tiefen Eindruckes nicht entschlagen,
wenn wir die nordischen Schnitzereien
betrachten. Wie schal und nichtssagend sehen
dagegen die »eleganten« Möbel der Gegen-
wart aus, wie erbärmlich die Dutzendwaaren,
die den Fabriken entstammen! Will man sich
recht den Unterschied zwischen beiden Kul-
turen klar machen, dann vergleiche man
z. B. einen »Salon« des vorigen Jahrhunderts
mit der Halle eines nordgermanischen Grossen
aus der Zeit des frühen Mittelalters.
Zu den alten deutschen Mustern soll man
daher zurückgehen, wenn man sich befruchten
lassen will. Hier weht ein männlicher Geist,
der eine kraftvolle Zeit vertritt, der aber
nicht immer in der Kunst der romanischen
Völker zu finden ist. Ein gewisser
weibischer Zug haftet heute noch unserer
Kunstthätigkeit an.
Aber es zeigen sich doch Ansätze zu
einer tieferen Auffassung, ein Zug zum Grossen,
Rückkehr zu germanischerem Wesen. Ich
erblicke dies vor allem, wo sich Innigkeit
des Gemüthes, wo sich Kraft, wo sich Rein-
heit findet. Namentlich auf englischem Boden