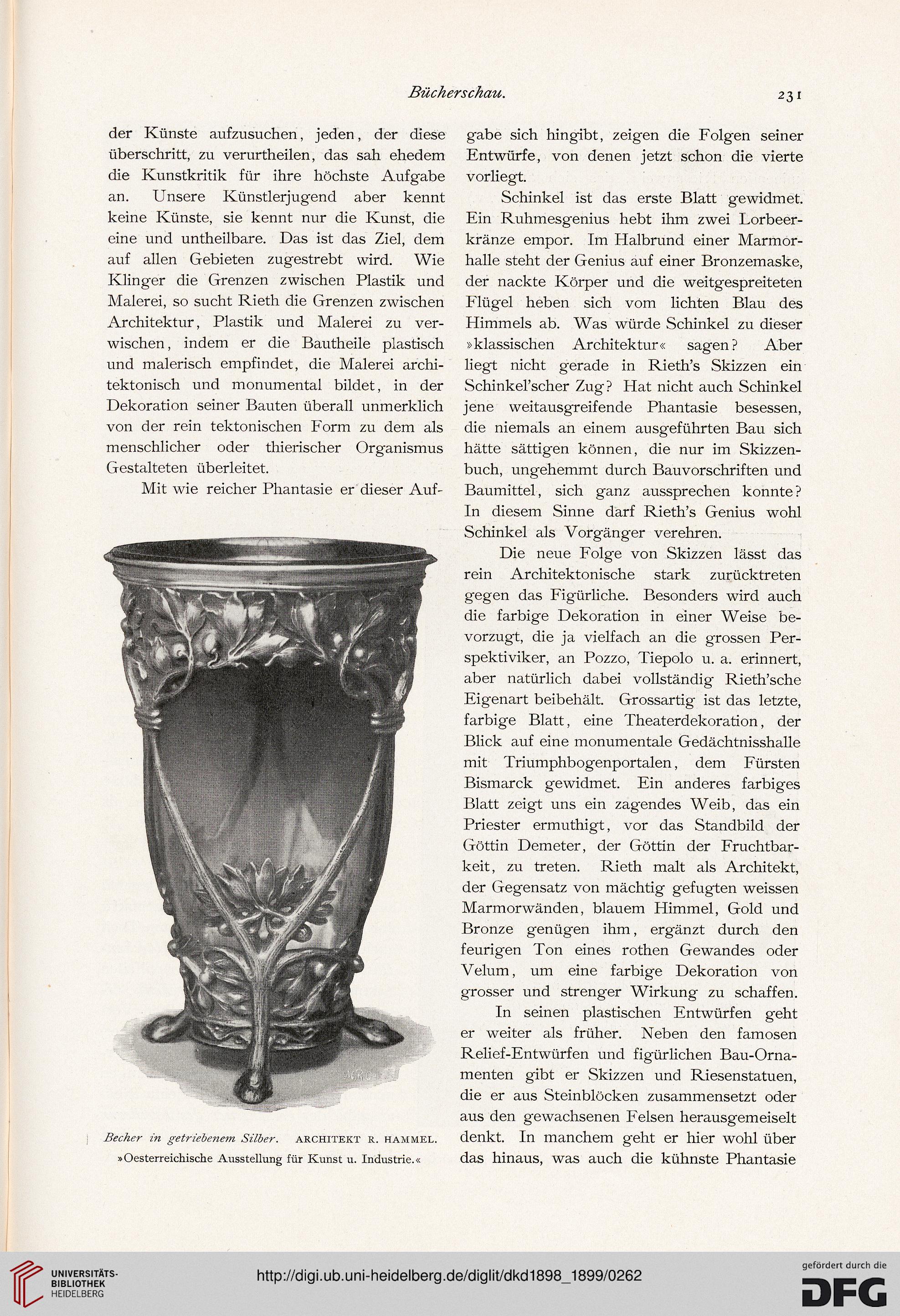Bücherschau.
231
der Künste aufzusuchen, jeden, der diese
überschritt, zu verurtheilen, das sah ehedem
die Kunstkritik für ihre höchste Aufgabe
an. Unsere Künstlerjugend aber kennt
keine Künste, sie kennt nur die Kunst, die
eine und untheilbare. Das ist das Ziel, dem
auf allen Gebieten zugestrebt wird. Wie
Klinger die Grenzen zwischen Plastik und
Malerei, so sucht Rieth die Grenzen zwischen
Architektur, Plastik und Malerei zu ver-
wischen , indem er die Bautheile plastisch
und malerisch empfindet, die Malerei archi-
tektonisch und monumental bildet, in der
Dekoration seiner Bauten überall unmerklich
von der rein tektonischen Form zu dem als
menschlicher oder thierischer Organismus
Gestalteten überleitet.
Mit wie reicher Phantasie er dieser Auf-
Becher in getriebenem Silber. ARCHITEKT R. HAMMEL.
»Oesterreichische Ausstellung für Kunst u. Industrie.«
gäbe sich hingibt, zeigen die Folgen seiner
Entwürfe, von denen jetzt schon die vierte
vorliegt.
Schinkel ist das erste Blatt gewidmet.
Ein Ruhmesgenius hebt ihm zwei Lorbeer-
kränze empor. Im Halbrund einer Marmor-
halle steht der Genius auf einer Bronzemaske,
der nackte Körper und die weitgespreiteten
Flügel heben sich vom lichten Blau des
Himmels ab. Was würde Schinkel zu dieser
»klassischen Architektur« sagen? Aber
liegt nicht gerade in Rieth's Skizzen ein
Schinkel'scher Zug? Hat nicht auch Schinkel
jene weitausgreifende Phantasie besessen,
die niemals an einem ausgeführten Bau sich
hätte sättigen können, die nur im Skizzen-
buch, ungehemmt durch Bauvorschriften und
Baumittel, sich ganz aussprechen konnte?
In diesem Sinne darf Rieth's Genius wohl
Schinkel als Vorgänger verehren.
Die neue Folge von Skizzen lässt das
rein Architektonische stark zurücktreten
gegen das Figürliche. Besonders wird auch
die farbige Dekoration in einer Weise be-
vorzugt, die ja vielfach an die grossen Per-
spektiviker, an Pozzo, Tiepolo u. a. erinnert,
aber natürlich dabei vollständig- Rieth'sche
Eigenart beibehält. Grossartig ist das letzte,
farbige Blatt, eine Theaterdekoration, der
Blick auf eine monumentale Gedächtnisshalle
mit Triumphbogenportalen, dem Fürsten
Bismarck gewidmet. Ein anderes farbiges
Blatt zeigt uns ein zagendes Weib, das ein
Priester ermuthigt, vor das Standbild der
Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbar-
keit, zu treten. Rieth malt als Architekt,
der Gegensatz von mächtig gefugten weissen
Marmorwänden, blauem Himmel, Gold und
Bronze genügen ihm, ergänzt durch den
feurigen Ton eines rothen Gewandes oder
Velum, um eine farbige Dekoration von
grosser und strenger Wirkung zu schaffen.
In seinen plastischen Entwürfen geht
er weiter als früher. Neben den famosen
Relief-Entwürfen und figürlichen Bau-Orna-
menten gibt er Skizzen und Riesenstatuen,
die er aus Steinblöcken zusammensetzt oder
aus den gewachsenen Felsen herausgemeiselt
denkt. In manchem geht er hier wohl über
das hinaus, was auch die kühnste Phantasie
231
der Künste aufzusuchen, jeden, der diese
überschritt, zu verurtheilen, das sah ehedem
die Kunstkritik für ihre höchste Aufgabe
an. Unsere Künstlerjugend aber kennt
keine Künste, sie kennt nur die Kunst, die
eine und untheilbare. Das ist das Ziel, dem
auf allen Gebieten zugestrebt wird. Wie
Klinger die Grenzen zwischen Plastik und
Malerei, so sucht Rieth die Grenzen zwischen
Architektur, Plastik und Malerei zu ver-
wischen , indem er die Bautheile plastisch
und malerisch empfindet, die Malerei archi-
tektonisch und monumental bildet, in der
Dekoration seiner Bauten überall unmerklich
von der rein tektonischen Form zu dem als
menschlicher oder thierischer Organismus
Gestalteten überleitet.
Mit wie reicher Phantasie er dieser Auf-
Becher in getriebenem Silber. ARCHITEKT R. HAMMEL.
»Oesterreichische Ausstellung für Kunst u. Industrie.«
gäbe sich hingibt, zeigen die Folgen seiner
Entwürfe, von denen jetzt schon die vierte
vorliegt.
Schinkel ist das erste Blatt gewidmet.
Ein Ruhmesgenius hebt ihm zwei Lorbeer-
kränze empor. Im Halbrund einer Marmor-
halle steht der Genius auf einer Bronzemaske,
der nackte Körper und die weitgespreiteten
Flügel heben sich vom lichten Blau des
Himmels ab. Was würde Schinkel zu dieser
»klassischen Architektur« sagen? Aber
liegt nicht gerade in Rieth's Skizzen ein
Schinkel'scher Zug? Hat nicht auch Schinkel
jene weitausgreifende Phantasie besessen,
die niemals an einem ausgeführten Bau sich
hätte sättigen können, die nur im Skizzen-
buch, ungehemmt durch Bauvorschriften und
Baumittel, sich ganz aussprechen konnte?
In diesem Sinne darf Rieth's Genius wohl
Schinkel als Vorgänger verehren.
Die neue Folge von Skizzen lässt das
rein Architektonische stark zurücktreten
gegen das Figürliche. Besonders wird auch
die farbige Dekoration in einer Weise be-
vorzugt, die ja vielfach an die grossen Per-
spektiviker, an Pozzo, Tiepolo u. a. erinnert,
aber natürlich dabei vollständig- Rieth'sche
Eigenart beibehält. Grossartig ist das letzte,
farbige Blatt, eine Theaterdekoration, der
Blick auf eine monumentale Gedächtnisshalle
mit Triumphbogenportalen, dem Fürsten
Bismarck gewidmet. Ein anderes farbiges
Blatt zeigt uns ein zagendes Weib, das ein
Priester ermuthigt, vor das Standbild der
Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbar-
keit, zu treten. Rieth malt als Architekt,
der Gegensatz von mächtig gefugten weissen
Marmorwänden, blauem Himmel, Gold und
Bronze genügen ihm, ergänzt durch den
feurigen Ton eines rothen Gewandes oder
Velum, um eine farbige Dekoration von
grosser und strenger Wirkung zu schaffen.
In seinen plastischen Entwürfen geht
er weiter als früher. Neben den famosen
Relief-Entwürfen und figürlichen Bau-Orna-
menten gibt er Skizzen und Riesenstatuen,
die er aus Steinblöcken zusammensetzt oder
aus den gewachsenen Felsen herausgemeiselt
denkt. In manchem geht er hier wohl über
das hinaus, was auch die kühnste Phantasie