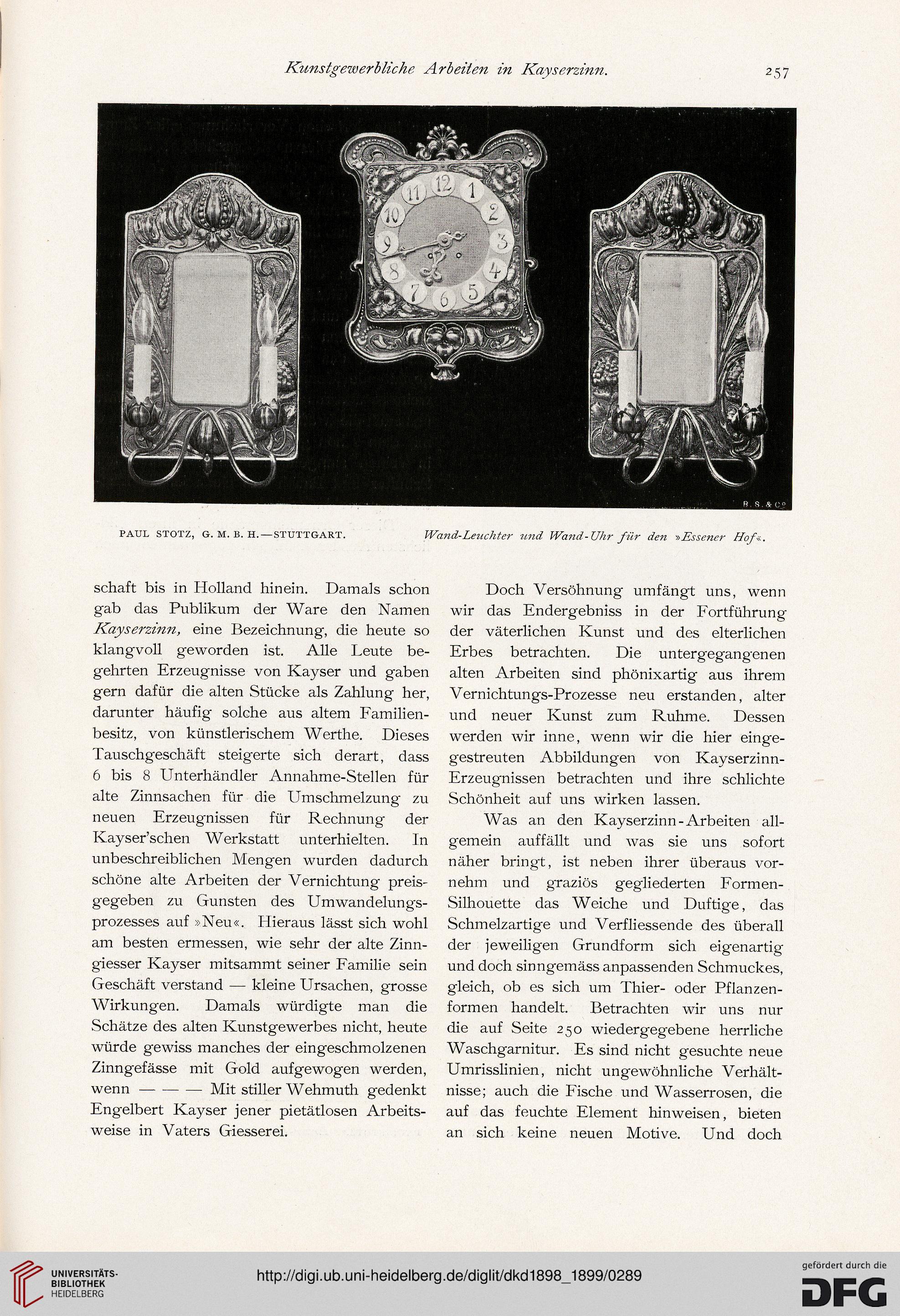Kunstgewerbliche Arbeiten in Kayserzinn.
257
schaft bis in Holland hinein. Damals schon
gab das Publikum der Ware den Namen
Kayserzinn, eine Bezeichnung, die heute so
klangvoll geworden ist. Alle Leute be-
gehrten Erzeugnisse von Kayser und gaben
gern dafür die alten Stücke als Zahlung her,
darunter häufig solche aus altem Familien-
besitz, von künstlerischem Werthe. Dieses
Tauschgeschäft steigerte sich derart, dass
6 bis 8 Unterhändler Annahme-Stellen für
alte Zinnsachen für die Umschmelzung zu
neuen Erzeugnissen für Rechnung der
Kayser'schen Werkstatt unterhielten. In
unbeschreiblichen Mengen wurden dadurch
schöne alte Arbeiten der Vernichtung preis-
gegeben zu Gunsten des Umwandelungs-
prozesses auf »Neu«. Hieraus lässt sich wohl
am besten ermessen, wie sehr der alte Zinn-
giesser Kayser mitsammt seiner Familie sein
Geschäft verstand — kleine Ursachen, grosse
Wirkungen. Damals würdigte man die
Schätze des alten Kunstgewerbes nicht, heute
würde gewiss manches der eingeschmolzenen
Zinngefässe mit Gold aufgewogen werden,
wenn---Mit stiller Wehmuth gedenkt
Engelbert Kayser jener pietätlosen Arbeits-
weise in Vaters Giesserei.
Doch Versöhnung umfängt uns, wenn
wir das Endergebniss in der Fortführung
der väterlichen Kunst und des elterlichen
Erbes betrachten. Die untergegangenen
alten Arbeiten sind phönixartig aus ihrem
Vernichtungs-Prozesse neu erstanden, alter
und neuer Kunst zum Ruhme. Dessen
werden wir inne, wenn wir die hier einge-
gestreuten Abbildungen von Kayserzinn-
Erzeugnissen betrachten und ihre schlichte
Schönheit auf uns wirken lassen.
Was an den Kayserzinn-Arbeiten all-
gemein auffällt und was sie uns sofort
näher bringt, ist neben ihrer überaus vor-
nehm und graziös gegliederten Formen-
Silhouette das Weiche und Duftige, das
Schmelzartige und Verfliessende des überall
der jeweiligen Grundform sich eigenartig
und doch sinngemäss anpassenden Schmuckes,
gleich, ob es sich um Thier- oder Pflanzen-
formen handelt. Betrachten wir uns nur
die auf Seite 250 wiedergegebene herrliche
Waschgarnitur. Es sind nicht gesuchte neue
Umrisslinien, nicht ungewöhnliche Verhält-
nisse; auch die Fische und Wasserrosen, die
auf das feuchte Element hinweisen, bieten
an sich keine neuen Motive. Und doch
257
schaft bis in Holland hinein. Damals schon
gab das Publikum der Ware den Namen
Kayserzinn, eine Bezeichnung, die heute so
klangvoll geworden ist. Alle Leute be-
gehrten Erzeugnisse von Kayser und gaben
gern dafür die alten Stücke als Zahlung her,
darunter häufig solche aus altem Familien-
besitz, von künstlerischem Werthe. Dieses
Tauschgeschäft steigerte sich derart, dass
6 bis 8 Unterhändler Annahme-Stellen für
alte Zinnsachen für die Umschmelzung zu
neuen Erzeugnissen für Rechnung der
Kayser'schen Werkstatt unterhielten. In
unbeschreiblichen Mengen wurden dadurch
schöne alte Arbeiten der Vernichtung preis-
gegeben zu Gunsten des Umwandelungs-
prozesses auf »Neu«. Hieraus lässt sich wohl
am besten ermessen, wie sehr der alte Zinn-
giesser Kayser mitsammt seiner Familie sein
Geschäft verstand — kleine Ursachen, grosse
Wirkungen. Damals würdigte man die
Schätze des alten Kunstgewerbes nicht, heute
würde gewiss manches der eingeschmolzenen
Zinngefässe mit Gold aufgewogen werden,
wenn---Mit stiller Wehmuth gedenkt
Engelbert Kayser jener pietätlosen Arbeits-
weise in Vaters Giesserei.
Doch Versöhnung umfängt uns, wenn
wir das Endergebniss in der Fortführung
der väterlichen Kunst und des elterlichen
Erbes betrachten. Die untergegangenen
alten Arbeiten sind phönixartig aus ihrem
Vernichtungs-Prozesse neu erstanden, alter
und neuer Kunst zum Ruhme. Dessen
werden wir inne, wenn wir die hier einge-
gestreuten Abbildungen von Kayserzinn-
Erzeugnissen betrachten und ihre schlichte
Schönheit auf uns wirken lassen.
Was an den Kayserzinn-Arbeiten all-
gemein auffällt und was sie uns sofort
näher bringt, ist neben ihrer überaus vor-
nehm und graziös gegliederten Formen-
Silhouette das Weiche und Duftige, das
Schmelzartige und Verfliessende des überall
der jeweiligen Grundform sich eigenartig
und doch sinngemäss anpassenden Schmuckes,
gleich, ob es sich um Thier- oder Pflanzen-
formen handelt. Betrachten wir uns nur
die auf Seite 250 wiedergegebene herrliche
Waschgarnitur. Es sind nicht gesuchte neue
Umrisslinien, nicht ungewöhnliche Verhält-
nisse; auch die Fische und Wasserrosen, die
auf das feuchte Element hinweisen, bieten
an sich keine neuen Motive. Und doch