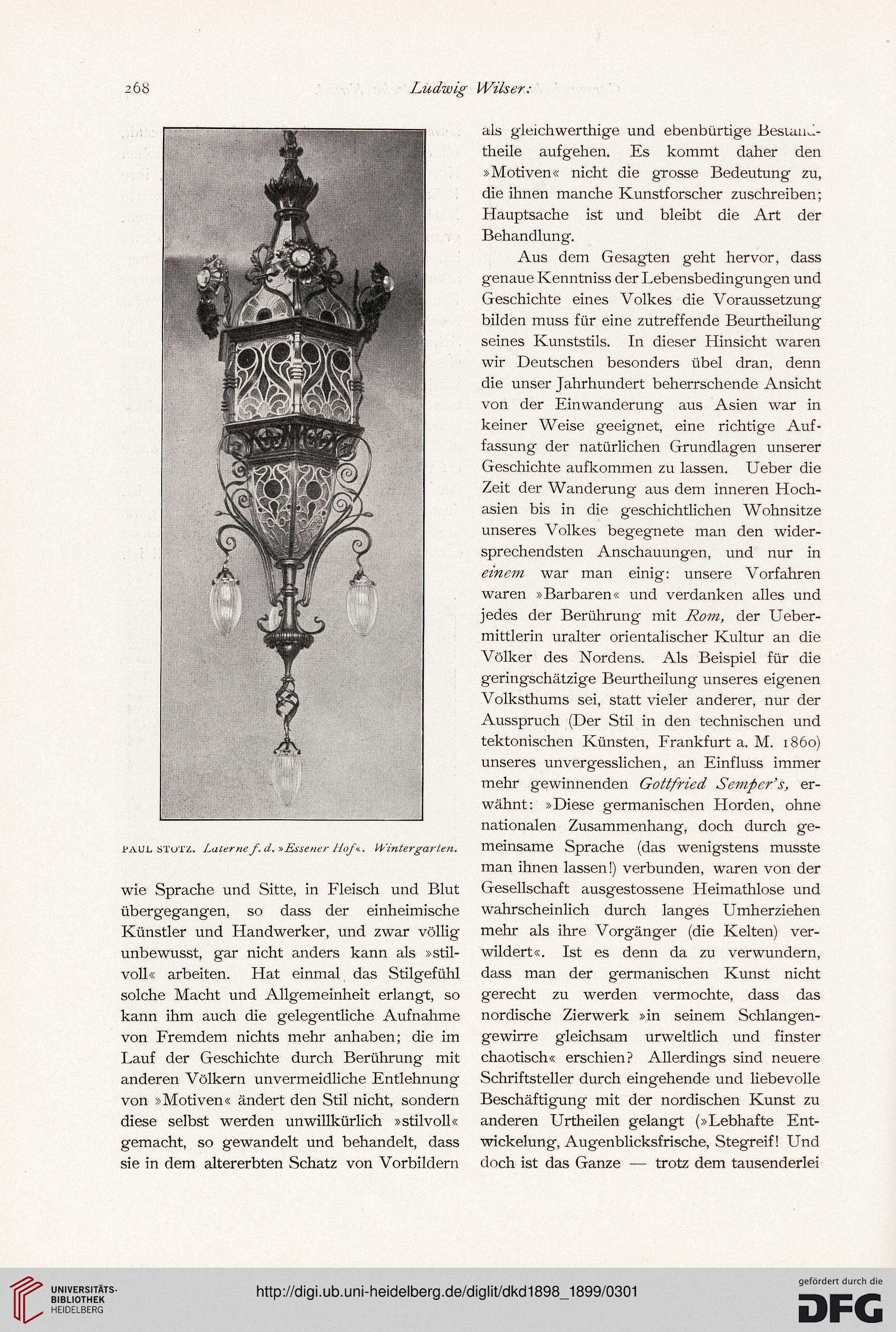268
Ludwig Wils er:
PAUL STUTZ. Laterne f.d. »Essener Hof*.. Wintergarten.
wie Sprache und Sitte, in Fleisch und Blut
übergegangen, so dass der einheimische
Künstler und Handwerker, und zwar völlig
unbewusst, gar nicht anders kann als »stil-
voll« arbeiten. Hat einmal das Stilgefühl
solche Macht und Allgemeinheit erlangt, so
kann ihm auch die gelegentliche Aufnahme
von Fremdem nichts mehr anhaben; die im
Lauf der Geschichte durch Berührung mit
anderen Völkern unvermeidliche Entlehnung
von »Motiven« ändert den Stil nicht, sondern
diese selbst werden unwillkürlich »stilvoll«
gemacht, so gewandelt und behandelt, dass
sie in dem altererbten Schatz von Vorbildern
als gleichwerthige und ebenbürtige Bestan^-
theile aufgehen. Es kommt daher den
»Motiven« nicht die grosse Bedeutung zu,
die ihnen manche Kunstforscher zuschreiben;
Hauptsache ist und bleibt die Art der
Behandlung.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass
genaue Kenntniss der Lebensbedingungen und
Geschichte eines Volkes die Voraussetzung
bilden muss für eine zutreffende Beurtheilung
seines Kunststils. In dieser Hinsicht waren
wir Deutschen besonders übel dran, denn
die unser Jahrhundert beherrschende Ansicht
von der Einwanderung aus Asien war in
keiner Weise geeignet, eine richtige Auf-
fassung der natürlichen Grundlagen unserer
Geschichte aufkommen zu lassen. Ueber die
Zeit der Wanderung aus dem inneren Hoch-
asien bis in die geschichtlichen Wohnsitze
unseres Volkes begegnete man den wider-
sprechendsten Anschauungen, und nur in
einem war man einig: unsere Vorfahren
waren »Barbaren« und verdanken alles und
jedes der Berührung mit Rom, der Ueber-
mittlerin uralter orientalischer Kultur an die
Völker des Nordens. Als Beispiel für die
geringschätzige Beurtheilung unseres eigenen
Volksthums sei, statt vieler anderer, nur der
Ausspruch (Der Stil in den technischen und
tektonischen Künsten, Frankfurt a. M. 1860)
unseres unvergesslichen, an Einfluss immer
mehr gewinnenden Gottfried Semper's, er-
wähnt: »Diese germanischen Horden, ohne
nationalen Zusammenhang, doch durch ge-
meinsame Sprache (das wenigstens musste
man ihnen lassen!) verbunden, waren von der
Gesellschaft ausgestossene Heimathlose und
wahrscheinlich durch langes Umherziehen
mehr als ihre Vorgänger (die Kelten) ver-
wildert«. Ist es denn da zu verwundern,
dass man der germanischen Kunst nicht
gerecht zu werden vermochte, dass das
nordische Zierwerk »in seinem Schlangen-
gewirre gleichsam urweltiich und finster
chaotisch« erschien? Allerdings sind neuere
Schriftsteller durch eingehende und liebevolle
Beschäftigung mit der nordischen Kunst zu
anderen Urtheilen gelangt (»Lebhafte Ent-
wickelung, Augenblicksfrische, Stegreif! Und
doch ist das Ganze — trotz dem tausenderlei
Ludwig Wils er:
PAUL STUTZ. Laterne f.d. »Essener Hof*.. Wintergarten.
wie Sprache und Sitte, in Fleisch und Blut
übergegangen, so dass der einheimische
Künstler und Handwerker, und zwar völlig
unbewusst, gar nicht anders kann als »stil-
voll« arbeiten. Hat einmal das Stilgefühl
solche Macht und Allgemeinheit erlangt, so
kann ihm auch die gelegentliche Aufnahme
von Fremdem nichts mehr anhaben; die im
Lauf der Geschichte durch Berührung mit
anderen Völkern unvermeidliche Entlehnung
von »Motiven« ändert den Stil nicht, sondern
diese selbst werden unwillkürlich »stilvoll«
gemacht, so gewandelt und behandelt, dass
sie in dem altererbten Schatz von Vorbildern
als gleichwerthige und ebenbürtige Bestan^-
theile aufgehen. Es kommt daher den
»Motiven« nicht die grosse Bedeutung zu,
die ihnen manche Kunstforscher zuschreiben;
Hauptsache ist und bleibt die Art der
Behandlung.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass
genaue Kenntniss der Lebensbedingungen und
Geschichte eines Volkes die Voraussetzung
bilden muss für eine zutreffende Beurtheilung
seines Kunststils. In dieser Hinsicht waren
wir Deutschen besonders übel dran, denn
die unser Jahrhundert beherrschende Ansicht
von der Einwanderung aus Asien war in
keiner Weise geeignet, eine richtige Auf-
fassung der natürlichen Grundlagen unserer
Geschichte aufkommen zu lassen. Ueber die
Zeit der Wanderung aus dem inneren Hoch-
asien bis in die geschichtlichen Wohnsitze
unseres Volkes begegnete man den wider-
sprechendsten Anschauungen, und nur in
einem war man einig: unsere Vorfahren
waren »Barbaren« und verdanken alles und
jedes der Berührung mit Rom, der Ueber-
mittlerin uralter orientalischer Kultur an die
Völker des Nordens. Als Beispiel für die
geringschätzige Beurtheilung unseres eigenen
Volksthums sei, statt vieler anderer, nur der
Ausspruch (Der Stil in den technischen und
tektonischen Künsten, Frankfurt a. M. 1860)
unseres unvergesslichen, an Einfluss immer
mehr gewinnenden Gottfried Semper's, er-
wähnt: »Diese germanischen Horden, ohne
nationalen Zusammenhang, doch durch ge-
meinsame Sprache (das wenigstens musste
man ihnen lassen!) verbunden, waren von der
Gesellschaft ausgestossene Heimathlose und
wahrscheinlich durch langes Umherziehen
mehr als ihre Vorgänger (die Kelten) ver-
wildert«. Ist es denn da zu verwundern,
dass man der germanischen Kunst nicht
gerecht zu werden vermochte, dass das
nordische Zierwerk »in seinem Schlangen-
gewirre gleichsam urweltiich und finster
chaotisch« erschien? Allerdings sind neuere
Schriftsteller durch eingehende und liebevolle
Beschäftigung mit der nordischen Kunst zu
anderen Urtheilen gelangt (»Lebhafte Ent-
wickelung, Augenblicksfrische, Stegreif! Und
doch ist das Ganze — trotz dem tausenderlei