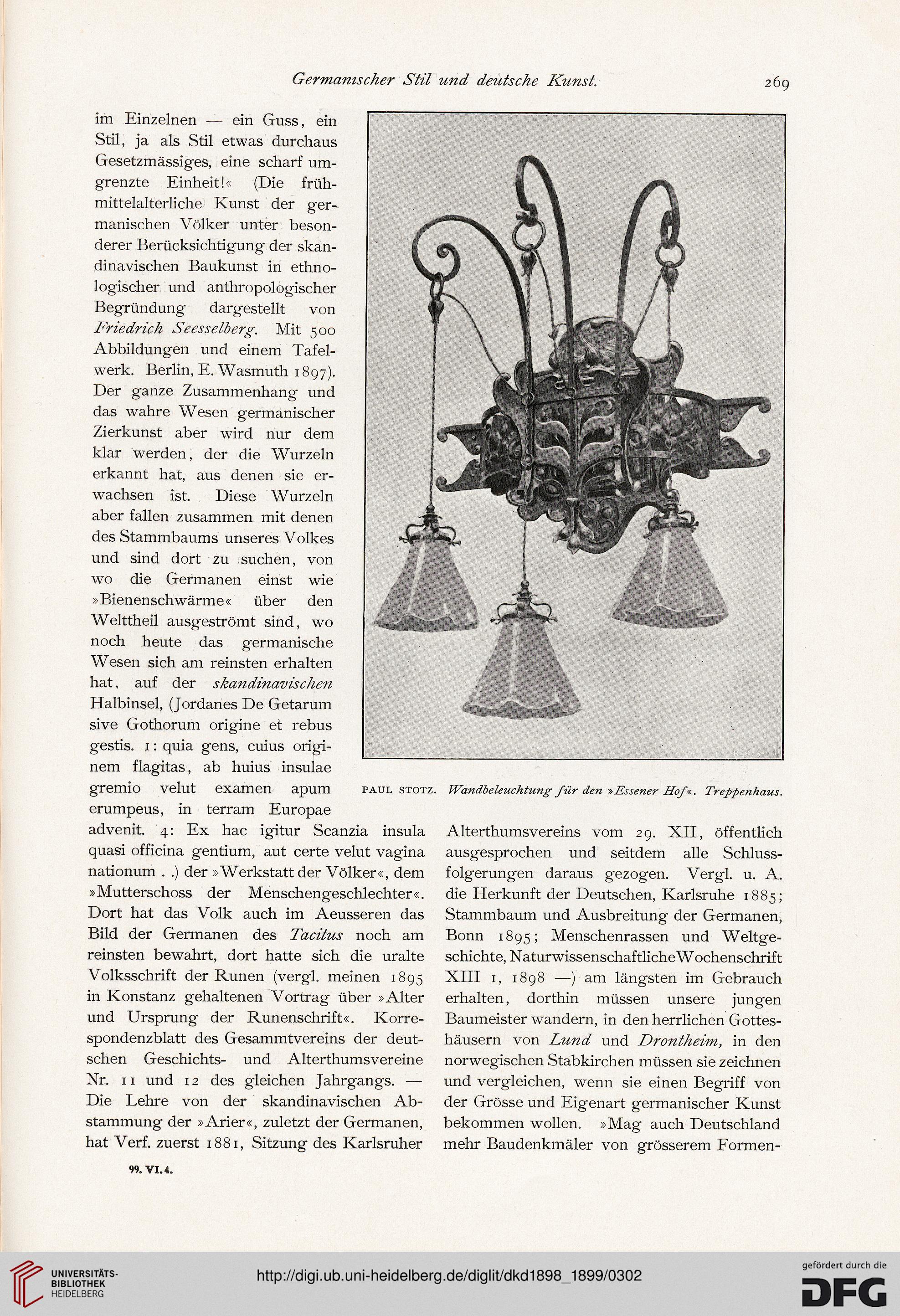Germanischer Stil und deutsche Kunst.
269
im Einzelnen — ein Guss, ein
Stil, ja als Stil etwas durchaus
Gesetzmässiges, eine scharf um-
grenzte Einheit!« (Die früh-
mittelalterliche Kunst der ger-
manischen Völker unter beson-
derer Berücksichtigung der skan-
dinavischen Baukunst in ethno-
logischer und anthropologischer
Begründung dargestellt von
Friedrich Seesselberg. Mit 500
Abbildungen und einem Tafel-
werk. Berlin, E.Wasmuth 1897).
Der ganze Zusammenhang und
das wahre Wesen germanischer
Zierkunst aber wird nur dem
klar werden, der die Wurzeln
erkannt hat, aus denen sie er-
wachsen ist. Diese Wurzeln
aber fallen zusammen mit denen
des Stammbaums unseres Volkes
und sind dort zu suchen, von
wo die Germanen einst wie
»Bienenschwärme« über den
Welttheil ausgeströmt sind, wo
noch heute das germanische
Wesen sich am reinsten erhalten
hat, auf der skandinavischen
Halbinsel, (Jordanes De Getarum
sive Gothorum origine et rebus
gestis. 1: quia gens, cuius origi-
nem flagitas, ab huius insulae
gremio velut examen apum
erumpeus, in terram Europae
advenit. 4: Ex hac igitur Scanzia insula
quasi officina gentium, aut certe velut vagina
nationum . .) der »Werkstatt der Völker«, dem
»Mutterschoss der Menschengeschlechter«.
Dort hat das Volk auch im Aeusseren das
Bild der Germanen des Tacitus noch am
reinsten bewahrt, dort hatte sich die uralte
Volksschrift der Runen (vergl. meinen 1895
in Konstanz gehaltenen Vortrag über »Alter
und Ursprung der Runenschrift«. Korre-
spondenzblatt des Gesammtvereins der deut-
schen Geschichts- und Alterthumsvereine
Nr. 11 und 12 des gleichen Jahrgangs. —
Die Lehre von der skandinavischen Ab-
stammung der »Arier«, zuletzt der Germanen,
hat Verf. zuerst 1881, Sitzung des Karlsruher
PAUL STOTZ. Wandbeleuchtung für den »Essener Höfa. Treppenhaus.
Alterthumsvereins vom 29. XII, öffentlich
ausgesprochen und seitdem alle Schluss-
folgerungen daraus gezogen. Vergl. u. A.
die Herkunft der Deutschen, Karlsruhe 1885;
Stammbaum und Ausbreitung der Germanen,
Bonn 1895; Menschenrassen und Weltge-
schichte, NaturwissenschaftlicheWochenschrift
XIII 1, 1898 —) am längsten im Gebrauch
erhalten, dorthin müssen unsere jungen
Baumeister wandern, in den herrlichen Gottes-
häusern von Lund und Drontheim, in den
norwegischen Stabkirchen müssen sie zeichnen
und vergleichen, wenn sie einen Begriff von
der Grösse und Eigenart germanischer Kunst
bekommen wollen. »Mag auch Deutschland
mehr Baudenkmäler von grösserem Formen-
99. vi. 4.
269
im Einzelnen — ein Guss, ein
Stil, ja als Stil etwas durchaus
Gesetzmässiges, eine scharf um-
grenzte Einheit!« (Die früh-
mittelalterliche Kunst der ger-
manischen Völker unter beson-
derer Berücksichtigung der skan-
dinavischen Baukunst in ethno-
logischer und anthropologischer
Begründung dargestellt von
Friedrich Seesselberg. Mit 500
Abbildungen und einem Tafel-
werk. Berlin, E.Wasmuth 1897).
Der ganze Zusammenhang und
das wahre Wesen germanischer
Zierkunst aber wird nur dem
klar werden, der die Wurzeln
erkannt hat, aus denen sie er-
wachsen ist. Diese Wurzeln
aber fallen zusammen mit denen
des Stammbaums unseres Volkes
und sind dort zu suchen, von
wo die Germanen einst wie
»Bienenschwärme« über den
Welttheil ausgeströmt sind, wo
noch heute das germanische
Wesen sich am reinsten erhalten
hat, auf der skandinavischen
Halbinsel, (Jordanes De Getarum
sive Gothorum origine et rebus
gestis. 1: quia gens, cuius origi-
nem flagitas, ab huius insulae
gremio velut examen apum
erumpeus, in terram Europae
advenit. 4: Ex hac igitur Scanzia insula
quasi officina gentium, aut certe velut vagina
nationum . .) der »Werkstatt der Völker«, dem
»Mutterschoss der Menschengeschlechter«.
Dort hat das Volk auch im Aeusseren das
Bild der Germanen des Tacitus noch am
reinsten bewahrt, dort hatte sich die uralte
Volksschrift der Runen (vergl. meinen 1895
in Konstanz gehaltenen Vortrag über »Alter
und Ursprung der Runenschrift«. Korre-
spondenzblatt des Gesammtvereins der deut-
schen Geschichts- und Alterthumsvereine
Nr. 11 und 12 des gleichen Jahrgangs. —
Die Lehre von der skandinavischen Ab-
stammung der »Arier«, zuletzt der Germanen,
hat Verf. zuerst 1881, Sitzung des Karlsruher
PAUL STOTZ. Wandbeleuchtung für den »Essener Höfa. Treppenhaus.
Alterthumsvereins vom 29. XII, öffentlich
ausgesprochen und seitdem alle Schluss-
folgerungen daraus gezogen. Vergl. u. A.
die Herkunft der Deutschen, Karlsruhe 1885;
Stammbaum und Ausbreitung der Germanen,
Bonn 1895; Menschenrassen und Weltge-
schichte, NaturwissenschaftlicheWochenschrift
XIII 1, 1898 —) am längsten im Gebrauch
erhalten, dorthin müssen unsere jungen
Baumeister wandern, in den herrlichen Gottes-
häusern von Lund und Drontheim, in den
norwegischen Stabkirchen müssen sie zeichnen
und vergleichen, wenn sie einen Begriff von
der Grösse und Eigenart germanischer Kunst
bekommen wollen. »Mag auch Deutschland
mehr Baudenkmäler von grösserem Formen-
99. vi. 4.