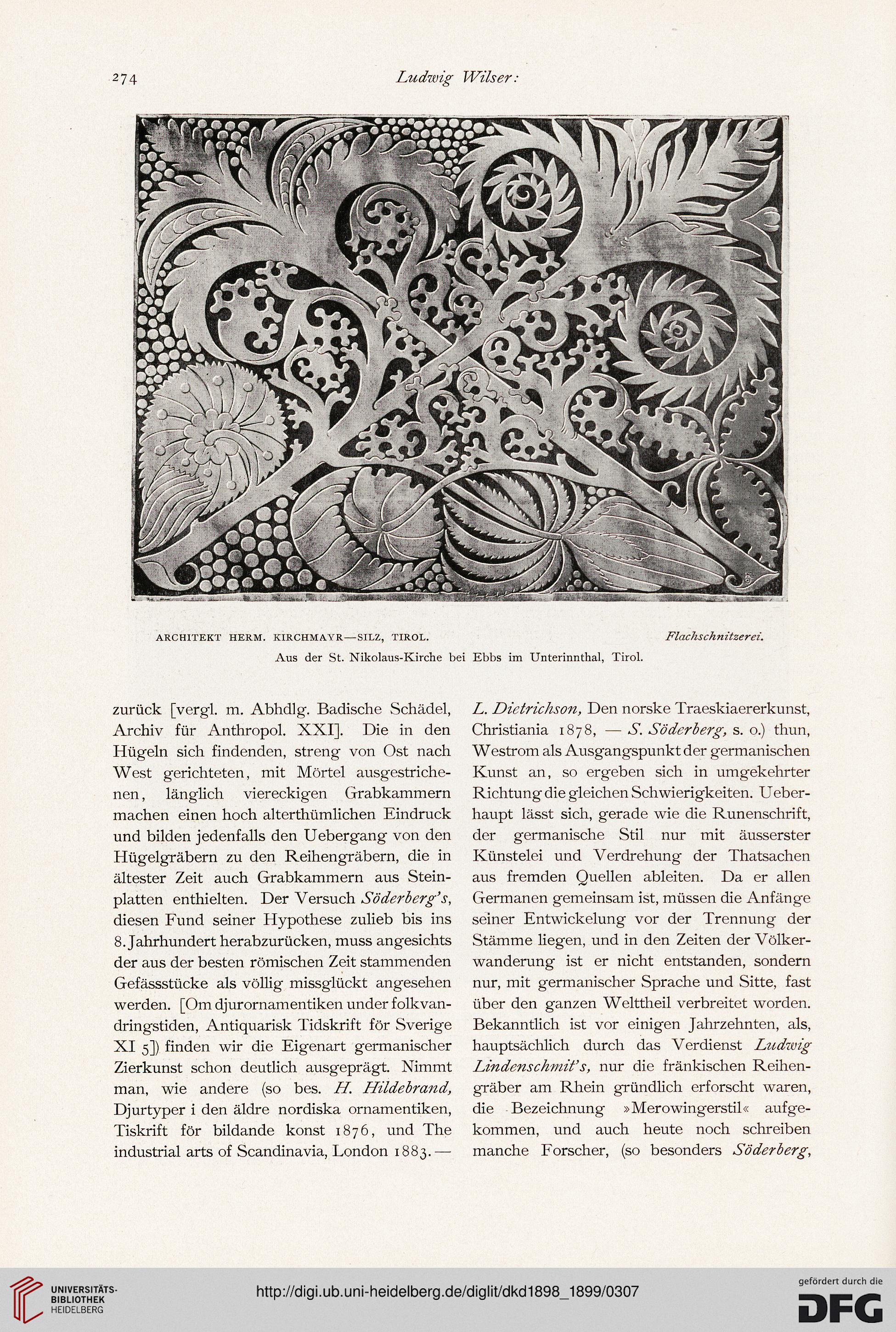274
Ludwig Wils er:
zurück [vergl. m. Abhdlg. Badische Schädel,
Archiv für Anthropol. XXI]. Die in den
Hügeln sich findenden, streng von Ost nach
West gerichteten, mit Mörtel ausgestriche-
nen, länglich viereckigen Grabkammern
machen einen hoch alterthümlichen Eindruck
und bilden jedenfalls den Uebergang von den
Hügelgräbern zu den Reihengräbern, die in
ältester Zeit auch Grabkammern aus Stein-
platten enthielten. Der Versuch Söderberg's,
diesen Fund seiner Hypothese zulieb bis ins
8. Jahrhundert herabzurücken, muss angesichts
der aus der besten römischen Zeit stammenden
Gefässstücke als völlig missglückt angesehen
werden. [Om djurornamentiken under folkvitn-
dringstiden, Antiquarisk Tidskrift för Sverige
XI 5]) finden wir die Eigenart germanischer
Zierkunst schon deutlich ausgeprägt. Nimmt
man, wie andere (so bes. H. Hildebrand,
Djurtyper i den äldre nordiska Ornamentiken,
Tiskrift för bildande konst 1876, und The
industrial arts of Scandinavia, London 1883.—
L. Dietrichson, Den norske Traeskiaererkunst,
Christiania 1878, — S. Söderberg, s. o.) thun,
Westrom als Ausgangspunkt der germanischen
Kunst an, so ergeben sich in umgekehrter
Richtung die gleichen Schwierigkeiten. Ueber-
haupt lässt sich, gerade wie die Runenschrift,
der germanische Stil nur mit äusserster
Künstelei und Verdrehung der Thatsachen
aus fremden Quellen ableiten. Da er allen
Germanen gemeinsam ist, müssen die Anfänge
seiner Entwickelung vor der Trennung der
Stämme liegen, und in den Zeiten der Völker-
wanderung ist er nicht entstanden, sondern
nur, mit germanischer Sprache und Sitte, fast
über den ganzen Welttheil verbreitet worden.
Bekanntlich ist vor einigen Jahrzehnten, als,
hauptsächlich durch das Verdienst Ludwig
Lindenschmit's, nur die fränkischen Reihen-
gräber am Rhein gründlich erforscht waren,
die Bezeichnung »Merowingerstil« aufge-
kommen, und auch heute noch schreiben
manche Forscher, (so besonders Söderberg,
Ludwig Wils er:
zurück [vergl. m. Abhdlg. Badische Schädel,
Archiv für Anthropol. XXI]. Die in den
Hügeln sich findenden, streng von Ost nach
West gerichteten, mit Mörtel ausgestriche-
nen, länglich viereckigen Grabkammern
machen einen hoch alterthümlichen Eindruck
und bilden jedenfalls den Uebergang von den
Hügelgräbern zu den Reihengräbern, die in
ältester Zeit auch Grabkammern aus Stein-
platten enthielten. Der Versuch Söderberg's,
diesen Fund seiner Hypothese zulieb bis ins
8. Jahrhundert herabzurücken, muss angesichts
der aus der besten römischen Zeit stammenden
Gefässstücke als völlig missglückt angesehen
werden. [Om djurornamentiken under folkvitn-
dringstiden, Antiquarisk Tidskrift för Sverige
XI 5]) finden wir die Eigenart germanischer
Zierkunst schon deutlich ausgeprägt. Nimmt
man, wie andere (so bes. H. Hildebrand,
Djurtyper i den äldre nordiska Ornamentiken,
Tiskrift för bildande konst 1876, und The
industrial arts of Scandinavia, London 1883.—
L. Dietrichson, Den norske Traeskiaererkunst,
Christiania 1878, — S. Söderberg, s. o.) thun,
Westrom als Ausgangspunkt der germanischen
Kunst an, so ergeben sich in umgekehrter
Richtung die gleichen Schwierigkeiten. Ueber-
haupt lässt sich, gerade wie die Runenschrift,
der germanische Stil nur mit äusserster
Künstelei und Verdrehung der Thatsachen
aus fremden Quellen ableiten. Da er allen
Germanen gemeinsam ist, müssen die Anfänge
seiner Entwickelung vor der Trennung der
Stämme liegen, und in den Zeiten der Völker-
wanderung ist er nicht entstanden, sondern
nur, mit germanischer Sprache und Sitte, fast
über den ganzen Welttheil verbreitet worden.
Bekanntlich ist vor einigen Jahrzehnten, als,
hauptsächlich durch das Verdienst Ludwig
Lindenschmit's, nur die fränkischen Reihen-
gräber am Rhein gründlich erforscht waren,
die Bezeichnung »Merowingerstil« aufge-
kommen, und auch heute noch schreiben
manche Forscher, (so besonders Söderberg,