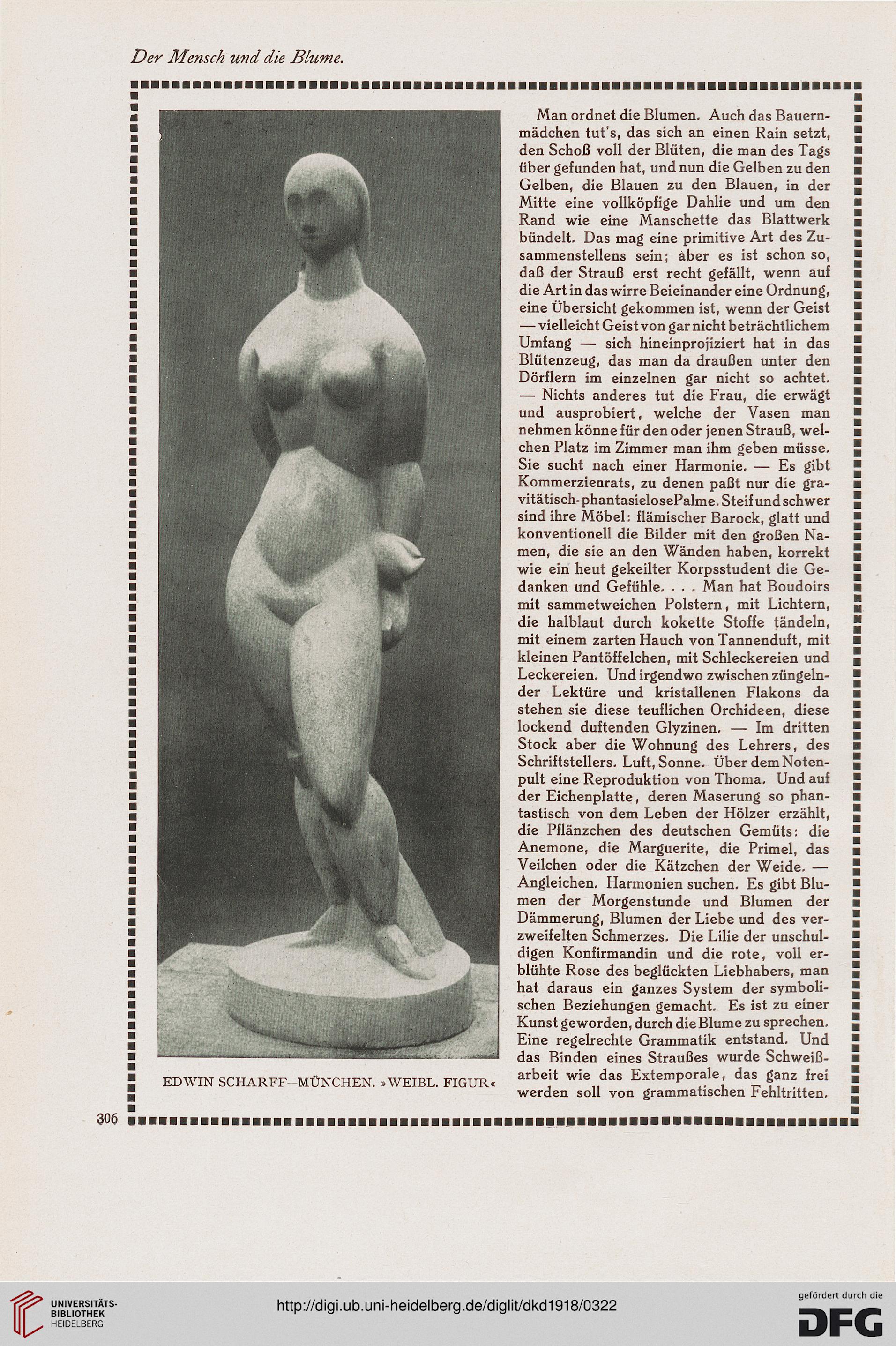Der Mensch und die Blume.
EDWIN SCHARFF MÜNCHEN. »WEIBL. FIGUR«
Man ordnet die Blumen. Auch das Bauern-
mädchen tut's, das sich an einen Rain setzt,
den Schoß voll der Blüten, die man des Tags
über gefunden hat, und nun die Gelben zu den
Gelben, die Blauen zu den Blauen, in der
Mitte eine vollköpfige Dahlie und um den
Rand wie eine Manschette das Blattwerk
bündelt. Das mag eine primitive Art des Zu-
sammenstellens sein; aber es ist schon so,
daß der Strauß erst recht gefällt, wenn auf
die Art in das wirre Beieinander eine Ordnung,
eine Übersicht gekommen ist, wenn der Geist
— vielleicht Geist von gar nicht beträchtlichem
Umfang — sich hineinprojiziert hat in das
Blütenzeug, das man da draußen unter den
Dörflern im einzelnen gar nicht so achtet.
— Nichts anderes tut die Frau, die erwägt
und ausprobiert, welche der Vasen man
nehmen könne für den oder jenen Strauß, wel-
chen Platz im Zimmer man ihm geben müsse.
Sie sucht nach einer Harmonie. — Es gibt
Kommerzienrats, zu denen paßt nur die gra-
vitätisch-phantasielosePalme. Steif und schwer
sind ihre Möbel: flämischer Barock, glatt und
konventionell die Bilder mit den großen Na-
men, die sie an den Wänden haben, korrekt
wie ein heut gekeilter Korpsstudent die Ge-
danken und Gefühle. . . . Man hat Boudoirs
mit sammetweichen Polstern, mit Lichtern,
die halblaut durch kokette Stoffe tändeln,
mit einem zarten Hauch von Tannenduft, mit
kleinen Pantöffelchen, mit Schleckereien und
Leckereien. Und irgendwo zwischen züngeln-
der Lektüre und kristallenen Flakons da
stehen sie diese teuflichen Orchideen, diese
lockend duftenden Glyzinen. — Im dritten
Stock aber die Wohnung des Lehrers, des
Schriftstellers. Luft, Sonne. Über dem Noten-
pult eine Reproduktion von Thoma. Und auf
der Eichenplatte, deren Maserung so phan-
tastisch von dem Leben der Hölzer erzählt,
die Pflänzchen des deutschen Gemüts: die
Anemone, die Marguerite, die Primel, das
Veilchen oder die Kätzchen der Weide. —
Angleichen. Harmonien suchen. Es gibt Blu-
men der Morgenstunde und Blumen der
Dämmerung, Blumen der Liebe und des ver-
zweifelten Schmerzes. Die Lilie der unschul-
digen Konfirmandin und die rote, voll er-
blühte Rose des beglückten Liebhabers, man
hat daraus ein ganzes System der symboli-
schen Beziehungen gemacht. Es ist zu einer
Kunst geworden, durch die Blume zu sprechen.
Eine regelrechte Grammatik entstand. Und
das Binden eines Straußes wurde Schweiß-
arbeit wie das Extemporale, das ganz frei
werden soll von grammatischen Fehltritten.
306
EDWIN SCHARFF MÜNCHEN. »WEIBL. FIGUR«
Man ordnet die Blumen. Auch das Bauern-
mädchen tut's, das sich an einen Rain setzt,
den Schoß voll der Blüten, die man des Tags
über gefunden hat, und nun die Gelben zu den
Gelben, die Blauen zu den Blauen, in der
Mitte eine vollköpfige Dahlie und um den
Rand wie eine Manschette das Blattwerk
bündelt. Das mag eine primitive Art des Zu-
sammenstellens sein; aber es ist schon so,
daß der Strauß erst recht gefällt, wenn auf
die Art in das wirre Beieinander eine Ordnung,
eine Übersicht gekommen ist, wenn der Geist
— vielleicht Geist von gar nicht beträchtlichem
Umfang — sich hineinprojiziert hat in das
Blütenzeug, das man da draußen unter den
Dörflern im einzelnen gar nicht so achtet.
— Nichts anderes tut die Frau, die erwägt
und ausprobiert, welche der Vasen man
nehmen könne für den oder jenen Strauß, wel-
chen Platz im Zimmer man ihm geben müsse.
Sie sucht nach einer Harmonie. — Es gibt
Kommerzienrats, zu denen paßt nur die gra-
vitätisch-phantasielosePalme. Steif und schwer
sind ihre Möbel: flämischer Barock, glatt und
konventionell die Bilder mit den großen Na-
men, die sie an den Wänden haben, korrekt
wie ein heut gekeilter Korpsstudent die Ge-
danken und Gefühle. . . . Man hat Boudoirs
mit sammetweichen Polstern, mit Lichtern,
die halblaut durch kokette Stoffe tändeln,
mit einem zarten Hauch von Tannenduft, mit
kleinen Pantöffelchen, mit Schleckereien und
Leckereien. Und irgendwo zwischen züngeln-
der Lektüre und kristallenen Flakons da
stehen sie diese teuflichen Orchideen, diese
lockend duftenden Glyzinen. — Im dritten
Stock aber die Wohnung des Lehrers, des
Schriftstellers. Luft, Sonne. Über dem Noten-
pult eine Reproduktion von Thoma. Und auf
der Eichenplatte, deren Maserung so phan-
tastisch von dem Leben der Hölzer erzählt,
die Pflänzchen des deutschen Gemüts: die
Anemone, die Marguerite, die Primel, das
Veilchen oder die Kätzchen der Weide. —
Angleichen. Harmonien suchen. Es gibt Blu-
men der Morgenstunde und Blumen der
Dämmerung, Blumen der Liebe und des ver-
zweifelten Schmerzes. Die Lilie der unschul-
digen Konfirmandin und die rote, voll er-
blühte Rose des beglückten Liebhabers, man
hat daraus ein ganzes System der symboli-
schen Beziehungen gemacht. Es ist zu einer
Kunst geworden, durch die Blume zu sprechen.
Eine regelrechte Grammatik entstand. Und
das Binden eines Straußes wurde Schweiß-
arbeit wie das Extemporale, das ganz frei
werden soll von grammatischen Fehltritten.
306