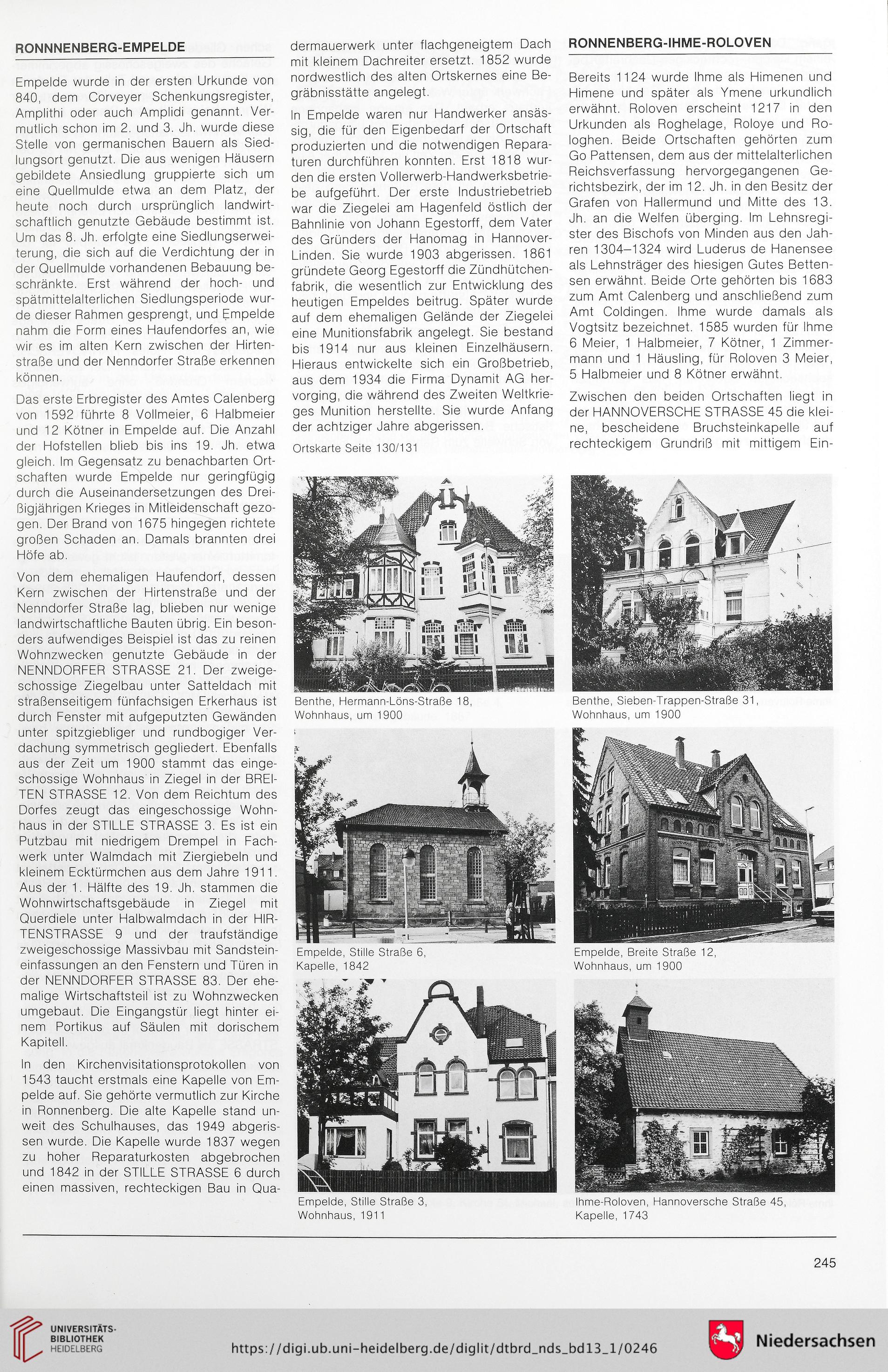RONNNENBERG-EMPELDE
Empelde wurde in der ersten Urkunde von
840, dem Corveyer Schenkungsregister,
Amplithi oder auch Amplidi genannt. Ver-
mutlich schon im 2. und 3. Jh. wurde diese
Stelle von germanischen Bauern als Sied-
lungsort genutzt. Die aus wenigen Häusern
gebildete Ansiedlung gruppierte sich um
eine Quellmulde etwa an dem Platz, der
heute noch durch ursprünglich landwirt-
schaftlich genutzte Gebäude bestimmt ist.
Um das 8. Jh. erfolgte eine Siedlungserwei-
terung, die sich auf die Verdichtung der in
der Quellmulde vorhandenen Bebauung be-
schränkte. Erst während der hoch- und
spätmittelalterlichen Siedlungsperiode wur-
de dieser Rahmen gesprengt, und Empelde
nahm die Form eines Haufendorfes an, wie
wir es im alten Kern zwischen der Hirten-
straße und der Nenndorfer Straße erkennen
können.
Das erste Erbregister des Amtes Calenberg
von 1592 führte 8 Vollmeier, 6 Halbmeier
und 12 Kötner in Empelde auf. Die Anzahl
der Hofstellen blieb bis ins 19. Jh. etwa
gleich. Im Gegensatz zu benachbarten Ort-
schaften wurde Empelde nur geringfügig
durch die Auseinandersetzungen des Drei-
ßigjährigen Krieges in Mitleidenschaft gezo-
gen. Der Brand von 1675 hingegen richtete
großen Schaden an. Damals brannten drei
Höfe ab.
Von dem ehemaligen Haufendorf, dessen
Kern zwischen der Hirtenstraße und der
Nenndorfer Straße lag, blieben nur wenige
landwirtschaftliche Bauten übrig. Ein beson-
ders aufwendiges Beispiel ist das zu reinen
Wohnzwecken genutzte Gebäude in der
NENNDORFER STRASSE 21. Der zweige-
schossige Ziegelbau unter Satteldach mit
straßenseitigem fünfachsigen Erkerhaus ist
durch Fenster mit aufgeputzten Gewänden
unter spitzgiebliger und rundbogiger Ver-
dachung symmetrisch gegliedert. Ebenfalls
aus der Zeit um 1900 stammt das einge-
schossige Wohnhaus in Ziegel in der BREI-
TEN STRASSE 12. Von dem Reichtum des
Dorfes zeugt das eingeschossige Wohn-
haus in der STILLE STRASSE 3. Es ist ein
Putzbau mit niedrigem Drempel in Fach-
werk unter Walmdach mit Ziergiebeln und
kleinem Ecktürmchen aus dem Jahre 1911.
Aus der 1. Hälfte des 19. Jh. stammen die
Wohnwirtschaftsgebäude in Ziegel mit
Querdiele unter Halbwalmdach in der HIR-
TENSTRASSE 9 und der traufständige
zweigeschossige Massivbau mit Sandstein-
einfassungen an den Fenstern und Türen in
der NENNDORFER STRASSE 83. Der ehe-
malige Wirtschaftsteil ist zu Wohnzwecken
umgebaut. Die Eingangstür liegt hinter ei-
nem Portikus auf Säulen mit dorischem
Kapitell.
in den Kirchenvisitationsprotokollen von
1543 taucht erstmals eine Kapelle von Em-
pelde auf. Sie gehörte vermutlich zur Kirche
in Ronnenberg. Die alte Kapelle stand un-
weit des Schulhauses, das 1949 abgeris-
sen wurde. Die Kapelle wurde 1837 wegen
zu hoher Reparaturkosten abgebrochen
und 1842 in der STILLE STRASSE 6 durch
einen massiven, rechteckigen Bau in Qua-
dermauerwerk unter flachgeneigtem Dach
mit kleinem Dachreiter ersetzt. 1852 wurde
nordwestlich des alten Ortskernes eine Be-
gräbnisstätte angelegt.
In Empelde waren nur Handwerker ansäs-
sig, die für den Eigenbedarf der Ortschaft
produzierten und die notwendigen Repara-
turen durchführen konnten. Erst 1818 wur-
den die ersten Vollerwerb-Handwerksbetrie-
be aufgeführt. Der erste Industriebetrieb
war die Ziegelei am Hagenfeld östlich der
Bahnlinie von Johann Egestorff, dem Vater
des Gründers der Hanomag in Hannover-
Linden. Sie wurde 1903 abgerissen. 1861
gründete Georg Egestorff die Zündhütchen-
fabrik, die wesentlich zur Entwicklung des
heutigen Empeldes beitrug. Später wurde
auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei
eine Munitionsfabrik angelegt. Sie bestand
bis 1914 nur aus kleinen Einzelhäusern.
Hieraus entwickelte sich ein Großbetrieb,
aus dem 1934 die Firma Dynamit AG her-
vorging, die während des Zweiten Weltkrie-
ges Munition herstellte. Sie wurde Anfang
der achtziger Jahre abgerissen.
Ortskarte Seite 130/131
Benthe, Hermann-Löns-Straße 18,
Wohnhaus, um 1900
Empelde, Stille Straße 6,
Kapelle, 1842
Empelde, Stille Straße 3,
Wohnhaus, 1911
RONNENBERG-IHME-ROLOVEN
Bereits 1124 wurde Ihme als Himenen und
Himene und später als Ymene urkundlich
erwähnt. Roloven erscheint 1217 in den
Urkunden als Roghelage, Roloye und Ro-
loghen. Beide Ortschaften gehörten zum
Go Pattensen, dem aus der mittelalterlichen
Reichsverfassung hervorgegangenen Ge-
richtsbezirk, der im 12. Jh. in den Besitz der
Grafen von Hallermund und Mitte des 13.
Jh. an die Welfen überging. Im Lehnsregi-
ster des Bischofs von Minden aus den Jah-
ren 1304-1324 wird Luderus de Hanensee
als Lehnsträger des hiesigen Gutes Betten-
sen erwähnt. Beide Orte gehörten bis 1683
zum Amt Calenberg und anschließend zum
Amt Coldingen. Ihme wurde damals als
Vogtsitz bezeichnet. 1585 wurden für Ihme
6 Meier, 1 Halbmeier, 7 Kötner, 1 Zimmer-
mann und 1 Häusling, für Roloven 3 Meier,
5 Halbmeier und 8 Kötner erwähnt.
Zwischen den beiden Ortschaften liegt in
der HANNOVERSCHE STRASSE 45 die klei-
ne, bescheidene Bruchsteinkapelle auf
rechteckigem Grundriß mit mittigem Ein-
Benthe, Sieben-Trappen-Straße 31,
Wohnhaus, um 1900
Empelde, Breite Straße 12,
Wohnhaus, um 1900
Ihme-Roloven, Hannoversche Straße 45,
Kapelle, 1743
245
Empelde wurde in der ersten Urkunde von
840, dem Corveyer Schenkungsregister,
Amplithi oder auch Amplidi genannt. Ver-
mutlich schon im 2. und 3. Jh. wurde diese
Stelle von germanischen Bauern als Sied-
lungsort genutzt. Die aus wenigen Häusern
gebildete Ansiedlung gruppierte sich um
eine Quellmulde etwa an dem Platz, der
heute noch durch ursprünglich landwirt-
schaftlich genutzte Gebäude bestimmt ist.
Um das 8. Jh. erfolgte eine Siedlungserwei-
terung, die sich auf die Verdichtung der in
der Quellmulde vorhandenen Bebauung be-
schränkte. Erst während der hoch- und
spätmittelalterlichen Siedlungsperiode wur-
de dieser Rahmen gesprengt, und Empelde
nahm die Form eines Haufendorfes an, wie
wir es im alten Kern zwischen der Hirten-
straße und der Nenndorfer Straße erkennen
können.
Das erste Erbregister des Amtes Calenberg
von 1592 führte 8 Vollmeier, 6 Halbmeier
und 12 Kötner in Empelde auf. Die Anzahl
der Hofstellen blieb bis ins 19. Jh. etwa
gleich. Im Gegensatz zu benachbarten Ort-
schaften wurde Empelde nur geringfügig
durch die Auseinandersetzungen des Drei-
ßigjährigen Krieges in Mitleidenschaft gezo-
gen. Der Brand von 1675 hingegen richtete
großen Schaden an. Damals brannten drei
Höfe ab.
Von dem ehemaligen Haufendorf, dessen
Kern zwischen der Hirtenstraße und der
Nenndorfer Straße lag, blieben nur wenige
landwirtschaftliche Bauten übrig. Ein beson-
ders aufwendiges Beispiel ist das zu reinen
Wohnzwecken genutzte Gebäude in der
NENNDORFER STRASSE 21. Der zweige-
schossige Ziegelbau unter Satteldach mit
straßenseitigem fünfachsigen Erkerhaus ist
durch Fenster mit aufgeputzten Gewänden
unter spitzgiebliger und rundbogiger Ver-
dachung symmetrisch gegliedert. Ebenfalls
aus der Zeit um 1900 stammt das einge-
schossige Wohnhaus in Ziegel in der BREI-
TEN STRASSE 12. Von dem Reichtum des
Dorfes zeugt das eingeschossige Wohn-
haus in der STILLE STRASSE 3. Es ist ein
Putzbau mit niedrigem Drempel in Fach-
werk unter Walmdach mit Ziergiebeln und
kleinem Ecktürmchen aus dem Jahre 1911.
Aus der 1. Hälfte des 19. Jh. stammen die
Wohnwirtschaftsgebäude in Ziegel mit
Querdiele unter Halbwalmdach in der HIR-
TENSTRASSE 9 und der traufständige
zweigeschossige Massivbau mit Sandstein-
einfassungen an den Fenstern und Türen in
der NENNDORFER STRASSE 83. Der ehe-
malige Wirtschaftsteil ist zu Wohnzwecken
umgebaut. Die Eingangstür liegt hinter ei-
nem Portikus auf Säulen mit dorischem
Kapitell.
in den Kirchenvisitationsprotokollen von
1543 taucht erstmals eine Kapelle von Em-
pelde auf. Sie gehörte vermutlich zur Kirche
in Ronnenberg. Die alte Kapelle stand un-
weit des Schulhauses, das 1949 abgeris-
sen wurde. Die Kapelle wurde 1837 wegen
zu hoher Reparaturkosten abgebrochen
und 1842 in der STILLE STRASSE 6 durch
einen massiven, rechteckigen Bau in Qua-
dermauerwerk unter flachgeneigtem Dach
mit kleinem Dachreiter ersetzt. 1852 wurde
nordwestlich des alten Ortskernes eine Be-
gräbnisstätte angelegt.
In Empelde waren nur Handwerker ansäs-
sig, die für den Eigenbedarf der Ortschaft
produzierten und die notwendigen Repara-
turen durchführen konnten. Erst 1818 wur-
den die ersten Vollerwerb-Handwerksbetrie-
be aufgeführt. Der erste Industriebetrieb
war die Ziegelei am Hagenfeld östlich der
Bahnlinie von Johann Egestorff, dem Vater
des Gründers der Hanomag in Hannover-
Linden. Sie wurde 1903 abgerissen. 1861
gründete Georg Egestorff die Zündhütchen-
fabrik, die wesentlich zur Entwicklung des
heutigen Empeldes beitrug. Später wurde
auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei
eine Munitionsfabrik angelegt. Sie bestand
bis 1914 nur aus kleinen Einzelhäusern.
Hieraus entwickelte sich ein Großbetrieb,
aus dem 1934 die Firma Dynamit AG her-
vorging, die während des Zweiten Weltkrie-
ges Munition herstellte. Sie wurde Anfang
der achtziger Jahre abgerissen.
Ortskarte Seite 130/131
Benthe, Hermann-Löns-Straße 18,
Wohnhaus, um 1900
Empelde, Stille Straße 6,
Kapelle, 1842
Empelde, Stille Straße 3,
Wohnhaus, 1911
RONNENBERG-IHME-ROLOVEN
Bereits 1124 wurde Ihme als Himenen und
Himene und später als Ymene urkundlich
erwähnt. Roloven erscheint 1217 in den
Urkunden als Roghelage, Roloye und Ro-
loghen. Beide Ortschaften gehörten zum
Go Pattensen, dem aus der mittelalterlichen
Reichsverfassung hervorgegangenen Ge-
richtsbezirk, der im 12. Jh. in den Besitz der
Grafen von Hallermund und Mitte des 13.
Jh. an die Welfen überging. Im Lehnsregi-
ster des Bischofs von Minden aus den Jah-
ren 1304-1324 wird Luderus de Hanensee
als Lehnsträger des hiesigen Gutes Betten-
sen erwähnt. Beide Orte gehörten bis 1683
zum Amt Calenberg und anschließend zum
Amt Coldingen. Ihme wurde damals als
Vogtsitz bezeichnet. 1585 wurden für Ihme
6 Meier, 1 Halbmeier, 7 Kötner, 1 Zimmer-
mann und 1 Häusling, für Roloven 3 Meier,
5 Halbmeier und 8 Kötner erwähnt.
Zwischen den beiden Ortschaften liegt in
der HANNOVERSCHE STRASSE 45 die klei-
ne, bescheidene Bruchsteinkapelle auf
rechteckigem Grundriß mit mittigem Ein-
Benthe, Sieben-Trappen-Straße 31,
Wohnhaus, um 1900
Empelde, Breite Straße 12,
Wohnhaus, um 1900
Ihme-Roloven, Hannoversche Straße 45,
Kapelle, 1743
245