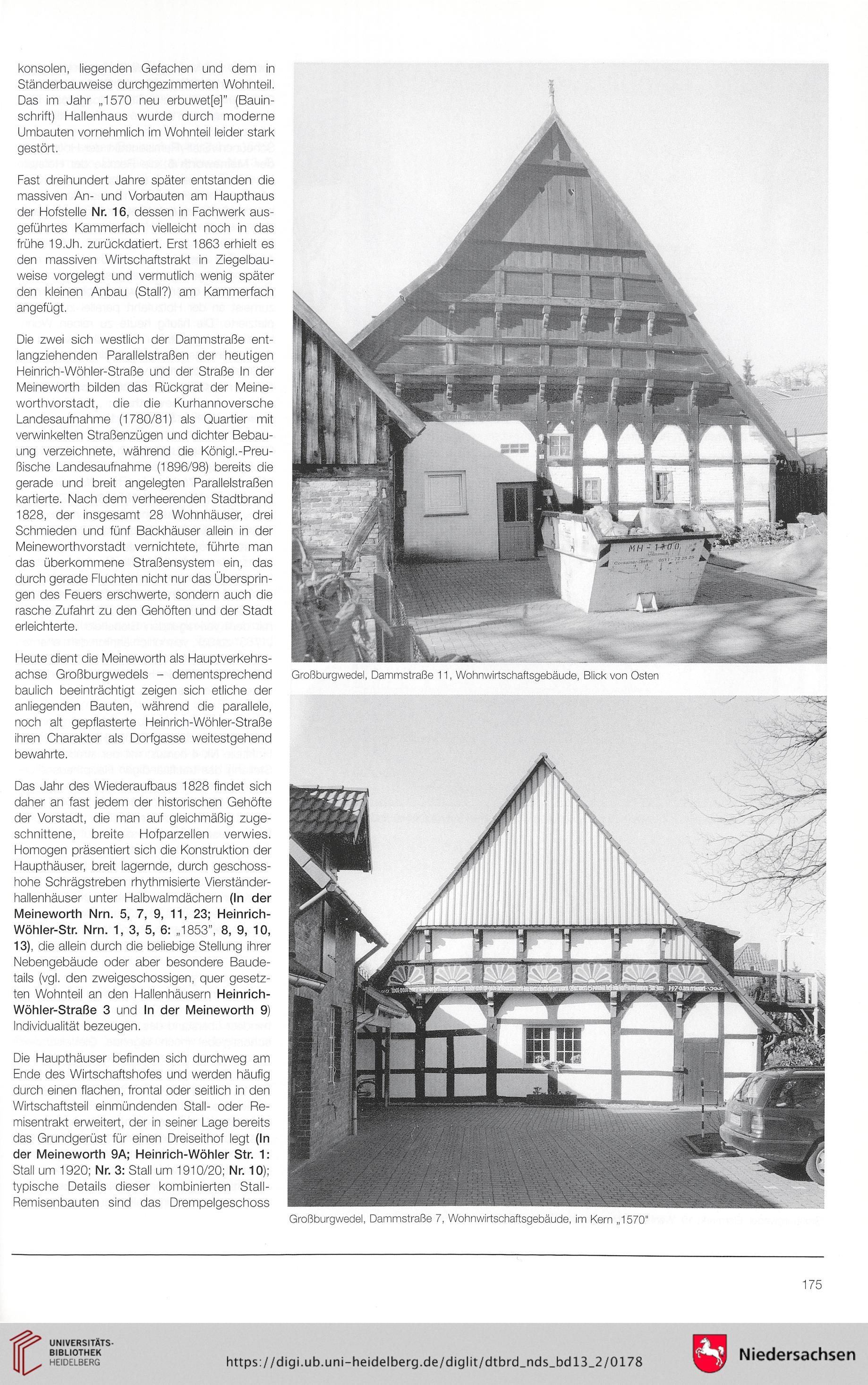konsolen, liegenden Gefachen und dem in
Ständerbauweise durchgezimmerten Wohnteil.
Das im Jahr „1570 neu erbuwet[e]” (Bauin-
schrift) Hallenhaus wurde durch moderne
Umbauten vornehmlich im Wohnteil leider stark
gestört.
Fast dreihundert Jahre später entstanden die
massiven An- und Vorbauten am Haupthaus
der Hofstelle Nr. 16, dessen in Fachwerk aus-
geführtes Kammerfach vielleicht noch in das
frühe 19.Jh. zurückdatiert. Erst 1863 erhielt es
den massiven Wirtschaftstrakt in Ziegelbau-
weise vorgelegt und vermutlich wenig später
den kleinen Anbau (Stall?) am Kammerfach
angefügt.
Die zwei sich westlich der Dammstraße ent-
langziehenden Parallelstraßen der heutigen
Heinrich-Wöhler-Straße und der Straße In der
Meineworth bilden das Rückgrat der Meine-
worthvorstadt, die die Kurhannoversche
Landesaufnahme (1780/81) als Quartier mit
verwinkelten Straßenzügen und dichter Bebau-
ung verzeichnete, während die Königl.-Preu-
ßische Landesaufnahme (1896/98) bereits die
gerade und breit angelegten Parallelstraßen
kartierte. Nach dem verheerenden Stadtbrand
1828, der insgesamt 28 Wohnhäuser, drei
Schmieden und fünf Backhäuser allein in der
Meineworthvorstadt vernichtete, führte man
das überkommene Straßensystem ein, das
durch gerade Fluchten nicht nur das Übersprin-
gen des Feuers erschwerte, sondern auch die
rasche Zufahrt zu den Gehöften und der Stadt
erleichterte.
Heute dient die Meineworth als Hauptverkehrs-
achse Großburgwedels - dementsprechend
baulich beeinträchtigt zeigen sich etliche der
anliegenden Bauten, während die parallele,
noch alt gepflasterte Heinrich-Wöhler-Straße
ihren Charakter als Dorfgasse weitestgehend
bewahrte.
Das Jahr des Wiederaufbaus 1828 findet sich
daher an fast jedem der historischen Gehöfte
der Vorstadt, die man auf gleichmäßig zuge-
schnittene, breite Hofparzellen verwies.
Homogen präsentiert sich die Konstruktion der
Haupthäuser, breit lagernde, durch geschoss-
hohe Schrägstreben rhythmisierte Vierständer-
hallenhäuser unter Halbwalmdächern (In der
Meineworth Nrn. 5, 7, 9, 11, 23; Heinrich-
Wöhler-Str. Nrn. 1, 3, 5, 6: „1853”, 8, 9, 10,
13), die allein durch die beliebige Stellung ihrer
Nebengebäude oder aber besondere Baude-
tails (vgl. den zweigeschossigen, quer gesetz-
ten Wohnteil an den Hallenhäusern Heinrich-
Wöhler-Straße 3 und In der Meineworth 9)
Individualität bezeugen.
Die Haupthäuser befinden sich durchweg am
Ende des Wirtschaftshofes und werden häufig
durch einen flachen, frontal oder seitlich in den
Wirtschaftsteil einmündenden Stall- oder Re-
misentrakt erweitert, der in seiner Lage bereits
das Grundgerüst für einen Dreiseithof legt (In
der Meineworth 9A; Heinrich-Wöhler Str. 1:
Stall um 1920; Nr. 3: Stall um 1910/20; Nr. 10);
typische Details dieser kombinierten Stall-
Remisenbauten sind das Drempelgeschoss
Großburgwedel, Dammstraße 11, Wohnwirtschaftsgebäude, Blick von Osten
Großburgwedel, Dammstraße 7, Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern „1570"
175
Ständerbauweise durchgezimmerten Wohnteil.
Das im Jahr „1570 neu erbuwet[e]” (Bauin-
schrift) Hallenhaus wurde durch moderne
Umbauten vornehmlich im Wohnteil leider stark
gestört.
Fast dreihundert Jahre später entstanden die
massiven An- und Vorbauten am Haupthaus
der Hofstelle Nr. 16, dessen in Fachwerk aus-
geführtes Kammerfach vielleicht noch in das
frühe 19.Jh. zurückdatiert. Erst 1863 erhielt es
den massiven Wirtschaftstrakt in Ziegelbau-
weise vorgelegt und vermutlich wenig später
den kleinen Anbau (Stall?) am Kammerfach
angefügt.
Die zwei sich westlich der Dammstraße ent-
langziehenden Parallelstraßen der heutigen
Heinrich-Wöhler-Straße und der Straße In der
Meineworth bilden das Rückgrat der Meine-
worthvorstadt, die die Kurhannoversche
Landesaufnahme (1780/81) als Quartier mit
verwinkelten Straßenzügen und dichter Bebau-
ung verzeichnete, während die Königl.-Preu-
ßische Landesaufnahme (1896/98) bereits die
gerade und breit angelegten Parallelstraßen
kartierte. Nach dem verheerenden Stadtbrand
1828, der insgesamt 28 Wohnhäuser, drei
Schmieden und fünf Backhäuser allein in der
Meineworthvorstadt vernichtete, führte man
das überkommene Straßensystem ein, das
durch gerade Fluchten nicht nur das Übersprin-
gen des Feuers erschwerte, sondern auch die
rasche Zufahrt zu den Gehöften und der Stadt
erleichterte.
Heute dient die Meineworth als Hauptverkehrs-
achse Großburgwedels - dementsprechend
baulich beeinträchtigt zeigen sich etliche der
anliegenden Bauten, während die parallele,
noch alt gepflasterte Heinrich-Wöhler-Straße
ihren Charakter als Dorfgasse weitestgehend
bewahrte.
Das Jahr des Wiederaufbaus 1828 findet sich
daher an fast jedem der historischen Gehöfte
der Vorstadt, die man auf gleichmäßig zuge-
schnittene, breite Hofparzellen verwies.
Homogen präsentiert sich die Konstruktion der
Haupthäuser, breit lagernde, durch geschoss-
hohe Schrägstreben rhythmisierte Vierständer-
hallenhäuser unter Halbwalmdächern (In der
Meineworth Nrn. 5, 7, 9, 11, 23; Heinrich-
Wöhler-Str. Nrn. 1, 3, 5, 6: „1853”, 8, 9, 10,
13), die allein durch die beliebige Stellung ihrer
Nebengebäude oder aber besondere Baude-
tails (vgl. den zweigeschossigen, quer gesetz-
ten Wohnteil an den Hallenhäusern Heinrich-
Wöhler-Straße 3 und In der Meineworth 9)
Individualität bezeugen.
Die Haupthäuser befinden sich durchweg am
Ende des Wirtschaftshofes und werden häufig
durch einen flachen, frontal oder seitlich in den
Wirtschaftsteil einmündenden Stall- oder Re-
misentrakt erweitert, der in seiner Lage bereits
das Grundgerüst für einen Dreiseithof legt (In
der Meineworth 9A; Heinrich-Wöhler Str. 1:
Stall um 1920; Nr. 3: Stall um 1910/20; Nr. 10);
typische Details dieser kombinierten Stall-
Remisenbauten sind das Drempelgeschoss
Großburgwedel, Dammstraße 11, Wohnwirtschaftsgebäude, Blick von Osten
Großburgwedel, Dammstraße 7, Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern „1570"
175