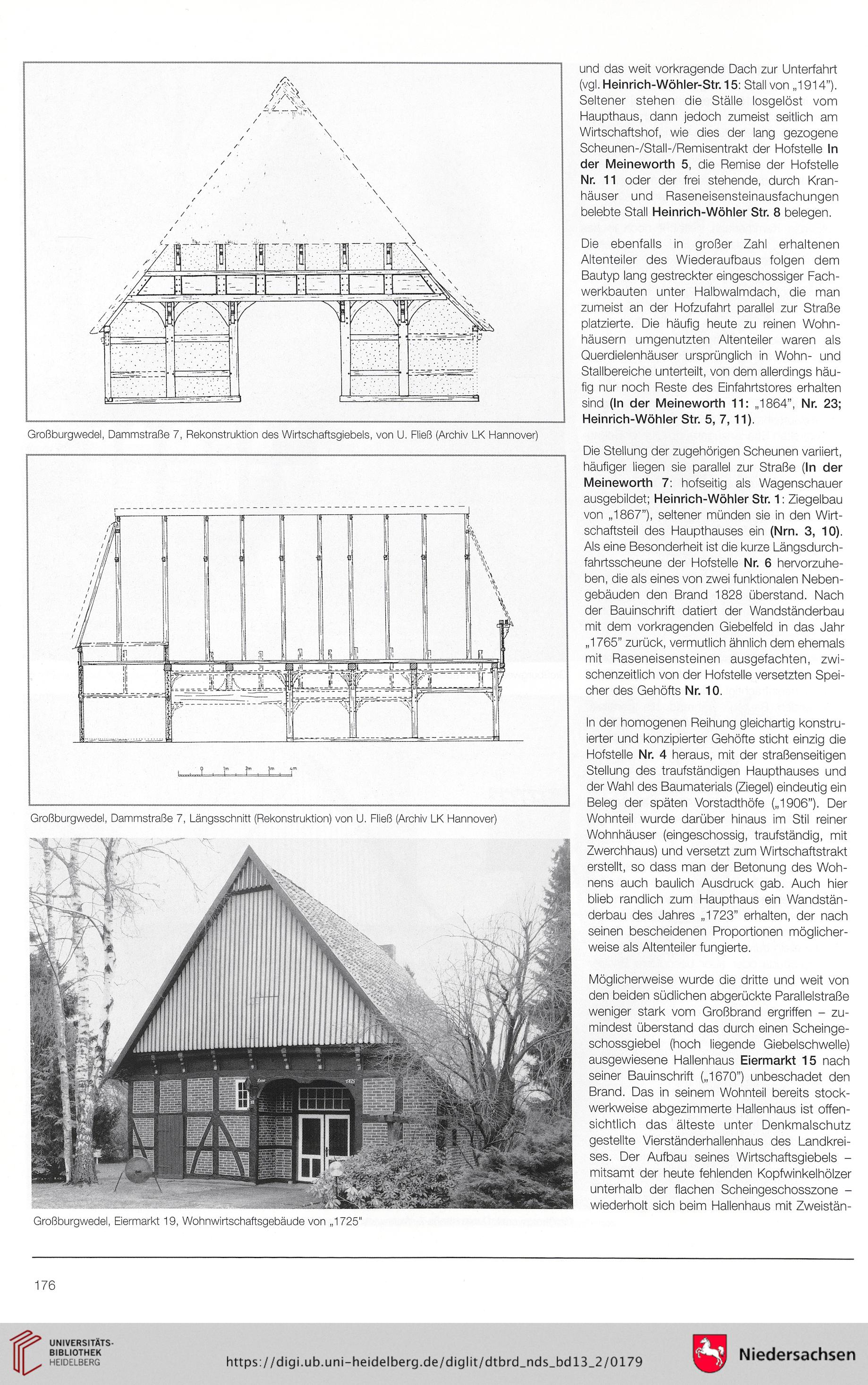Großburgwedel, Dammstraße 7, Rekonstruktion des Wirtschaftsgiebels, von U. Fließ (Archiv LK Hannover)
Großburgwedel, Dammstraße 7, Längsschnitt (Rekonstruktion) von U. Fließ (Archiv LK Hannover)
und das weit vorkragende Dach zur Unterfahrt
(vgl. Heinrich-Wöhler-Str. 15: Stall von „1914”).
Seltener stehen die Ställe losgelöst vom
Haupthaus, dann jedoch zumeist seitlich am
Wirtschaftshof, wie dies der lang gezogene
Scheunen-/Stall-/Remisentrakt der Hofstelle In
der Meineworth 5, die Remise der Hofstelle
Nr. 11 oder der frei stehende, durch Kran-
häuser und Raseneisensteinausfachungen
belebte Stall Heinrich-Wöhler Str. 8 belegen.
Die ebenfalls in großer Zahl erhaltenen
Altenteiler des Wiederaufbaus folgen dem
Bautyp lang gestreckter eingeschossiger Fach-
werkbauten unter Halbwalmdach, die man
zumeist an der Hofzufahrt parallel zur Straße
platzierte. Die häufig heute zu reinen Wohn-
häusern umgenutzten Altenteiler waren als
Querdielenhäuser ursprünglich in Wohn- und
Stallbereiche unterteilt, von dem allerdings häu-
fig nur noch Reste des Einfahrtstores erhalten
sind (In der Meineworth 11: „1864”, Nr. 23;
Heinrich-Wöhler Str. 5, 7,11).
Die Stellung der zugehörigen Scheunen variiert,
häufiger liegen sie parallel zur Straße (In der
Meineworth 7: hofseitig als Wagenschauer
ausgebildet; Heinrich-Wöhler Str. 1: Ziegelbau
von „1867”), seltener münden sie in den Wirt-
schaftsteil des Haupthauses ein (Nrn. 3, 10).
Als eine Besonderheit ist die kurze Längsdurch-
fahrtsscheune der Hofstelle Nr. 6 hervorzuhe-
ben, die als eines von zwei funktionalen Neben-
gebäuden den Brand 1828 Überstand. Nach
der Bauinschrift datiert der Wandständerbau
mit dem vorkragenden Giebelfeld in das Jahr
„1765” zurück, vermutlich ähnlich dem ehemals
mit Raseneisensteinen ausgefachten, zwi-
schenzeitlich von der Hofstelle versetzten Spei-
cher des Gehöfts Nr. 10.
In der homogenen Reihung gleichartig konstru-
ierter und konzipierter Gehöfte sticht einzig die
Hofstelle Nr. 4 heraus, mit der straßenseitigen
Stellung des traufständigen Haupthauses und
der Wahl des Baumaterials (Ziegel) eindeutig ein
Beleg der späten Vorstadthöfe („1906”). Der
Wohnteil wurde darüber hinaus im Stil reiner
Wohnhäuser (eingeschossig, traufständig, mit
Zwerchhaus) und versetzt zum Wirtschaftstrakt
erstellt, so dass man der Betonung des Woh-
nens auch baulich Ausdruck gab. Auch hier
blieb randlich zum Haupthaus ein Wandstän-
derbau des Jahres „1723” erhalten, der nach
seinen bescheidenen Proportionen möglicher-
weise als Altenteiler fungierte.
Möglicherweise wurde die dritte und weit von
den beiden südlichen abgerückte Parallelstraße
weniger stark vom Großbrand ergriffen - zu-
mindest überstand das durch einen Scheinge-
schossgiebel (hoch liegende Giebelschwelle)
ausgewiesene Hallenhaus Eiermarkt 15 nach
seiner Bauinschrift („1670") unbeschadet den
Brand. Das in seinem Wohnteil bereits stock-
werkweise abgezimmerte Hallenhaus ist offen-
sichtlich das älteste unter Denkmalschutz
gestellte Vierständerhallenhaus des Landkrei-
ses. Der Aufbau seines Wirtschaftsgiebels -
mitsamt der heute fehlenden Kopfwinkelhölzer
unterhalb der flachen Scheingeschosszone -
wiederholt sich beim Hallenhaus mit Zweistän-
Großburgwedel, Eiermarkt 19, Wohnwirtschaftsgebäude von „1725"
176