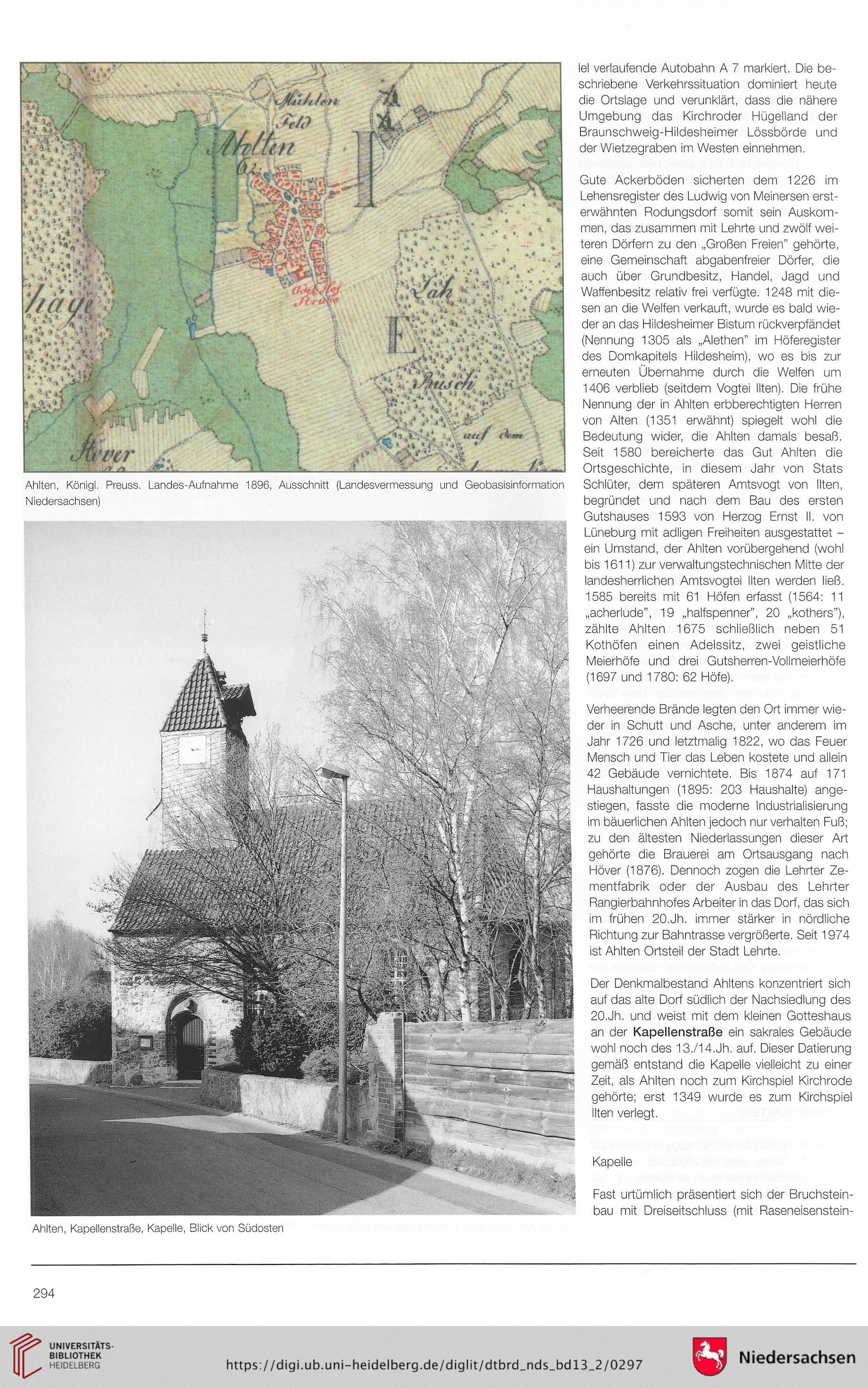Ahlten, Königl. Preuss. Landes-Aufnahme 1896, Ausschnitt (Landesvermessung und Geobasisinformation
lei verlaufende Autobahn A 7 markiert. Die be-
schriebene Verkehrssituation dominiert heute
die Ortslage und verunklärt, dass die nähere
Umgebung das Kirchroder Hügelland der
Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde und
der Wietzegraben im Westen einnehmen.
Gute Ackerböden sicherten dem 1226 im
Lehensregister des Ludwig von Meinersen erst-
erwähnten Rodungsdorf somit sein Auskom-
men, das zusammen mit Lehrte und zwölf wei-
teren Dörfern zu den „Großen Freien” gehörte,
eine Gemeinschaft abgabenfreier Dörfer, die
auch über Grundbesitz, Handel, Jagd und
Waffenbesitz relativ frei verfügte. 1248 mit die-
sen an die Welfen verkauft, wurde es bald wie-
der an das Hildesheimer Bistum rückverpfändet
(Nennung 1305 als „Alethen” im Höferegister
des Domkapitels Hildesheim), wo es bis zur
erneuten Übernahme durch die Welfen um
1406 verblieb (seitdem Vogtei Ilten). Die frühe
Nennung der in Ahlten erbberechtigten Herren
von Alten (1351 erwähnt) spiegelt wohl die
Bedeutung wider, die Ahlten damals besaß.
Seit 1580 bereicherte das Gut Ahlten die
Ortsgeschichte, in diesem Jahr von Stats
Schlüter, dem späteren Amtsvogt von Ilten,
Niedersachsen)
begründet und nach dem Bau des ersten
Gutshauses 1593 von Herzog Ernst II. von
Lüneburg mit adligen Freiheiten ausgestattet -
ein Umstand, der Ahlten vorübergehend (wohl
bis 1611) zur verwaltungstechnischen Mitte der
landesherrlichen Amtsvogtei Ilten werden ließ.
1585 bereits mit 61 Höfen erfasst (1564: 11
„acherlude”, 19 „halfspenner”, 20 „kothers”),
zählte Ahlten 1675 schließlich neben 51
Kothöfen einen Adelssitz, zwei geistliche
Meierhöfe und drei Gutsherren-Vollmeierhöfe
(1697 und 1780: 62 Höfe).
Verheerende Brände legten den Ort immer wie-
der in Schutt und Asche, unter anderem im
Jahr 1726 und letztmalig 1822, wo das Feuer
Mensch und Tier das Leben kostete und allein
42 Gebäude vernichtete. Bis 1874 auf 171
Haushaltungen (1895: 203 Haushalte) ange-
stiegen, fasste die moderne Industrialisierung
im bäuerlichen Ahlten jedoch nur verhalten Fuß;
zu den ältesten Niederlassungen dieser Art
gehörte die Brauerei am Ortsausgang nach
Höver (1876). Dennoch zogen die Lehrter Ze-
mentfabrik oder der Ausbau des Lehrter
Rangierbahnhofes Arbeiter in das Dorf, das sich
im frühen 20.Jh. immer stärker in nördliche
Richtung zur Bahntrasse vergrößerte. Seit 1974
ist Ahlten Ortsteil der Stadt Lehrte.
Der Denkmalbestand Ahltens konzentriert sich
auf das alte Dorf südlich der Nachsiedlung des
20.Jh. und weist mit dem kleinen Gotteshaus
an der Kapellenstraße ein sakrales Gebäude
wohl noch des 13./14.Jh. auf. Dieser Datierung
gemäß entstand die Kapelle vielleicht zu einer
Zeit, als Ahlten noch zum Kirchspiel Kirchrode
gehörte; erst 1349 wurde es zum Kirchspiel
Ilten verlegt.
Kapelle
Fast urtümlich präsentiert sich der Bruchstein-
bau mit Dreiseitschluss (mit Raseneisenstein-
Ahlten, Kapellenstraße, Kapelle, Blick von Südosten
294
lei verlaufende Autobahn A 7 markiert. Die be-
schriebene Verkehrssituation dominiert heute
die Ortslage und verunklärt, dass die nähere
Umgebung das Kirchroder Hügelland der
Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde und
der Wietzegraben im Westen einnehmen.
Gute Ackerböden sicherten dem 1226 im
Lehensregister des Ludwig von Meinersen erst-
erwähnten Rodungsdorf somit sein Auskom-
men, das zusammen mit Lehrte und zwölf wei-
teren Dörfern zu den „Großen Freien” gehörte,
eine Gemeinschaft abgabenfreier Dörfer, die
auch über Grundbesitz, Handel, Jagd und
Waffenbesitz relativ frei verfügte. 1248 mit die-
sen an die Welfen verkauft, wurde es bald wie-
der an das Hildesheimer Bistum rückverpfändet
(Nennung 1305 als „Alethen” im Höferegister
des Domkapitels Hildesheim), wo es bis zur
erneuten Übernahme durch die Welfen um
1406 verblieb (seitdem Vogtei Ilten). Die frühe
Nennung der in Ahlten erbberechtigten Herren
von Alten (1351 erwähnt) spiegelt wohl die
Bedeutung wider, die Ahlten damals besaß.
Seit 1580 bereicherte das Gut Ahlten die
Ortsgeschichte, in diesem Jahr von Stats
Schlüter, dem späteren Amtsvogt von Ilten,
Niedersachsen)
begründet und nach dem Bau des ersten
Gutshauses 1593 von Herzog Ernst II. von
Lüneburg mit adligen Freiheiten ausgestattet -
ein Umstand, der Ahlten vorübergehend (wohl
bis 1611) zur verwaltungstechnischen Mitte der
landesherrlichen Amtsvogtei Ilten werden ließ.
1585 bereits mit 61 Höfen erfasst (1564: 11
„acherlude”, 19 „halfspenner”, 20 „kothers”),
zählte Ahlten 1675 schließlich neben 51
Kothöfen einen Adelssitz, zwei geistliche
Meierhöfe und drei Gutsherren-Vollmeierhöfe
(1697 und 1780: 62 Höfe).
Verheerende Brände legten den Ort immer wie-
der in Schutt und Asche, unter anderem im
Jahr 1726 und letztmalig 1822, wo das Feuer
Mensch und Tier das Leben kostete und allein
42 Gebäude vernichtete. Bis 1874 auf 171
Haushaltungen (1895: 203 Haushalte) ange-
stiegen, fasste die moderne Industrialisierung
im bäuerlichen Ahlten jedoch nur verhalten Fuß;
zu den ältesten Niederlassungen dieser Art
gehörte die Brauerei am Ortsausgang nach
Höver (1876). Dennoch zogen die Lehrter Ze-
mentfabrik oder der Ausbau des Lehrter
Rangierbahnhofes Arbeiter in das Dorf, das sich
im frühen 20.Jh. immer stärker in nördliche
Richtung zur Bahntrasse vergrößerte. Seit 1974
ist Ahlten Ortsteil der Stadt Lehrte.
Der Denkmalbestand Ahltens konzentriert sich
auf das alte Dorf südlich der Nachsiedlung des
20.Jh. und weist mit dem kleinen Gotteshaus
an der Kapellenstraße ein sakrales Gebäude
wohl noch des 13./14.Jh. auf. Dieser Datierung
gemäß entstand die Kapelle vielleicht zu einer
Zeit, als Ahlten noch zum Kirchspiel Kirchrode
gehörte; erst 1349 wurde es zum Kirchspiel
Ilten verlegt.
Kapelle
Fast urtümlich präsentiert sich der Bruchstein-
bau mit Dreiseitschluss (mit Raseneisenstein-
Ahlten, Kapellenstraße, Kapelle, Blick von Südosten
294