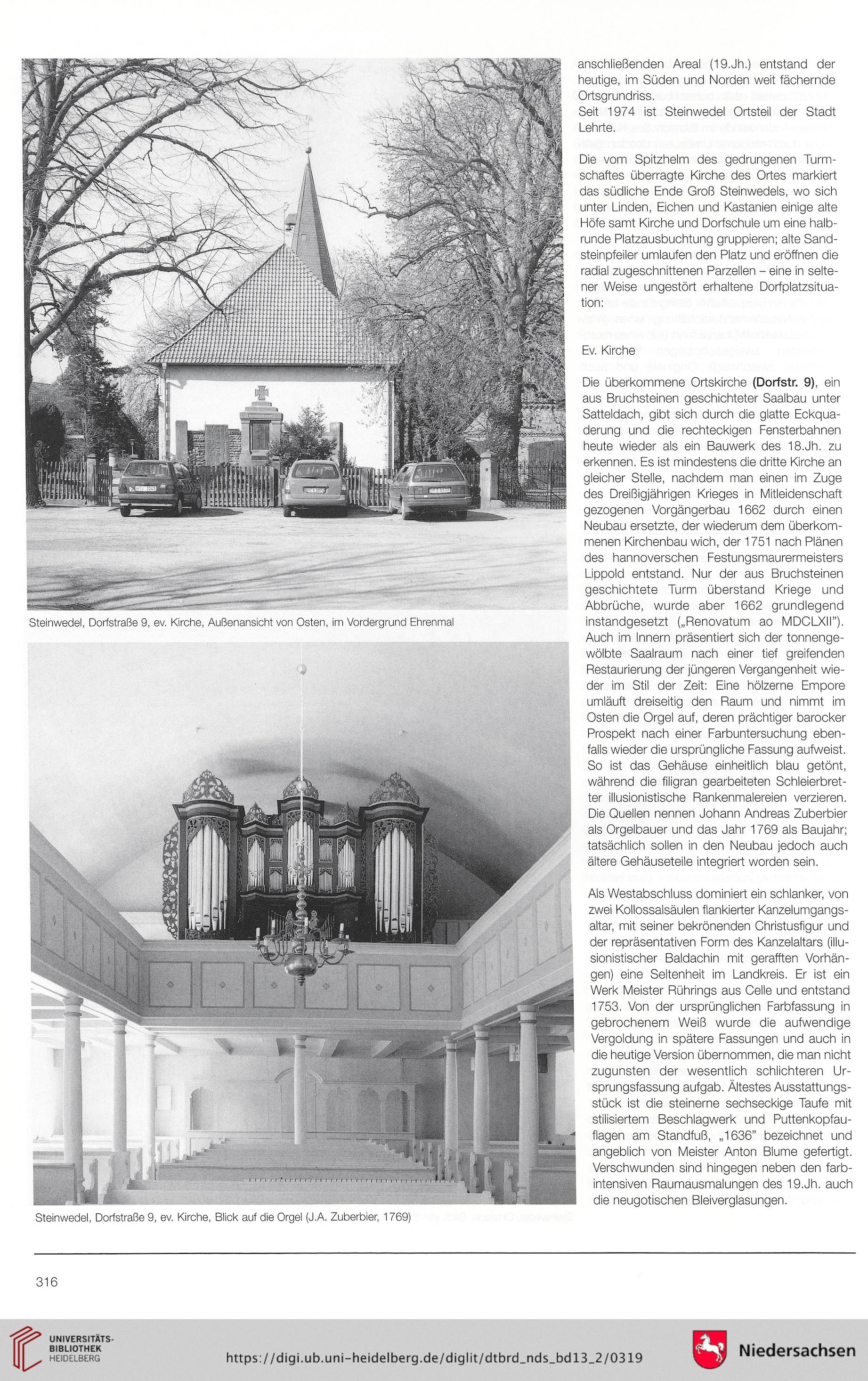Steinwedel, Dorfstraße 9, ev. Kirche, Außenansicht von Osten, im Vordergrund Ehrenmal
Steinwedel, Dorfstraße 9, ev. Kirche, Blick auf die Orgel (J.A. Zuberbier, 1769)
anschließenden Areal (19.Jh.) entstand der
heutige, im Süden und Norden weit fächernde
Ortsgrundriss.
Seit 1974 ist Steinwedel Ortsteil der Stadt
Lehrte.
Die vom Spitzhelm des gedrungenen Turm-
schaftes überragte Kirche des Ortes markiert
das südliche Ende Groß Steinwedels, wo sich
unter Linden, Eichen und Kastanien einige alte
Höfe samt Kirche und Dorfschule um eine halb-
runde Platzausbuchtung gruppieren; alte Sand-
steinpfeiler umlaufen den Platz und eröffnen die
radial zugeschnittenen Parzellen - eine in selte-
ner Weise ungestört erhaltene Dorfplatzsitua-
tion:
Ev. Kirche
Die überkommene Ortskirche (Dorfstr. 9), ein
aus Bruchsteinen geschichteter Saalbau unter
Satteldach, gibt sich durch die glatte Eckqua-
derung und die rechteckigen Fensterbahnen
heute wieder als ein Bauwerk des Iß.Jh. zu
erkennen. Es ist mindestens die dritte Kirche an
gleicher Stelle, nachdem man einen im Zuge
des Dreißigjährigen Krieges in Mitleidenschaft
gezogenen Vorgängerbau 1662 durch einen
Neubau ersetzte, der wiederum dem überkom-
menen Kirchenbau wich, der 1751 nach Plänen
des hannoverschen Festungsmaurermeisters
Lippold entstand. Nur der aus Bruchsteinen
geschichtete Turm Überstand Kriege und
Abbrüche, wurde aber 1662 grundlegend
instandgesetzt („Renovatum ao MDCLXII”).
Auch im Innern präsentiert sich der tonnenge-
wölbte Saalraum nach einer tief greifenden
Restaurierung der jüngeren Vergangenheit wie-
der im Stil der Zeit: Eine hölzerne Empore
umläuft dreiseitig den Raum und nimmt im
Osten die Orgel auf, deren prächtiger barocker
Prospekt nach einer Farbuntersuchung eben-
falls wieder die ursprüngliche Fassung aufweist.
So ist das Gehäuse einheitlich blau getönt,
während die filigran gearbeiteten Schleierbret-
ter illusionistische Rankenmalereien verzieren.
Die Quellen nennen Johann Andreas Zuberbier
als Orgelbauer und das Jahr 1769 als Baujahr;
tatsächlich sollen in den Neubau jedoch auch
ältere Gehäuseteile integriert worden sein.
Als Westabschluss dominiert ein schlanker, von
zwei Kollossalsäulen flankierter Kanzelumgangs-
altar, mit seiner bekrönenden Christusfigur und
der repräsentativen Form des Kanzelaltars (illu-
sionistischer Baldachin mit gerafften Vorhän-
gen) eine Seltenheit im Landkreis. Er ist ein
Werk Meister Rührings aus Celle und entstand
1753. Von der ursprünglichen Farbfassung in
gebrochenem Weiß wurde die aufwendige
Vergoldung in spätere Fassungen und auch in
die heutige Version übernommen, die man nicht
zugunsten der wesentlich schlichteren Ur-
sprungsfassung aufgab. Ältestes Ausstattungs-
stück ist die steinerne sechseckige Taufe mit
stilisiertem Beschlagwerk und Puttenkopfau-
flagen am Standfuß, „1636” bezeichnet und
angeblich von Meister Anton Blume gefertigt.
Verschwunden sind hingegen neben den farb-
intensiven Raumausmalungen des 19.Jh. auch
die neugotischen Bleiverglasungen.
316