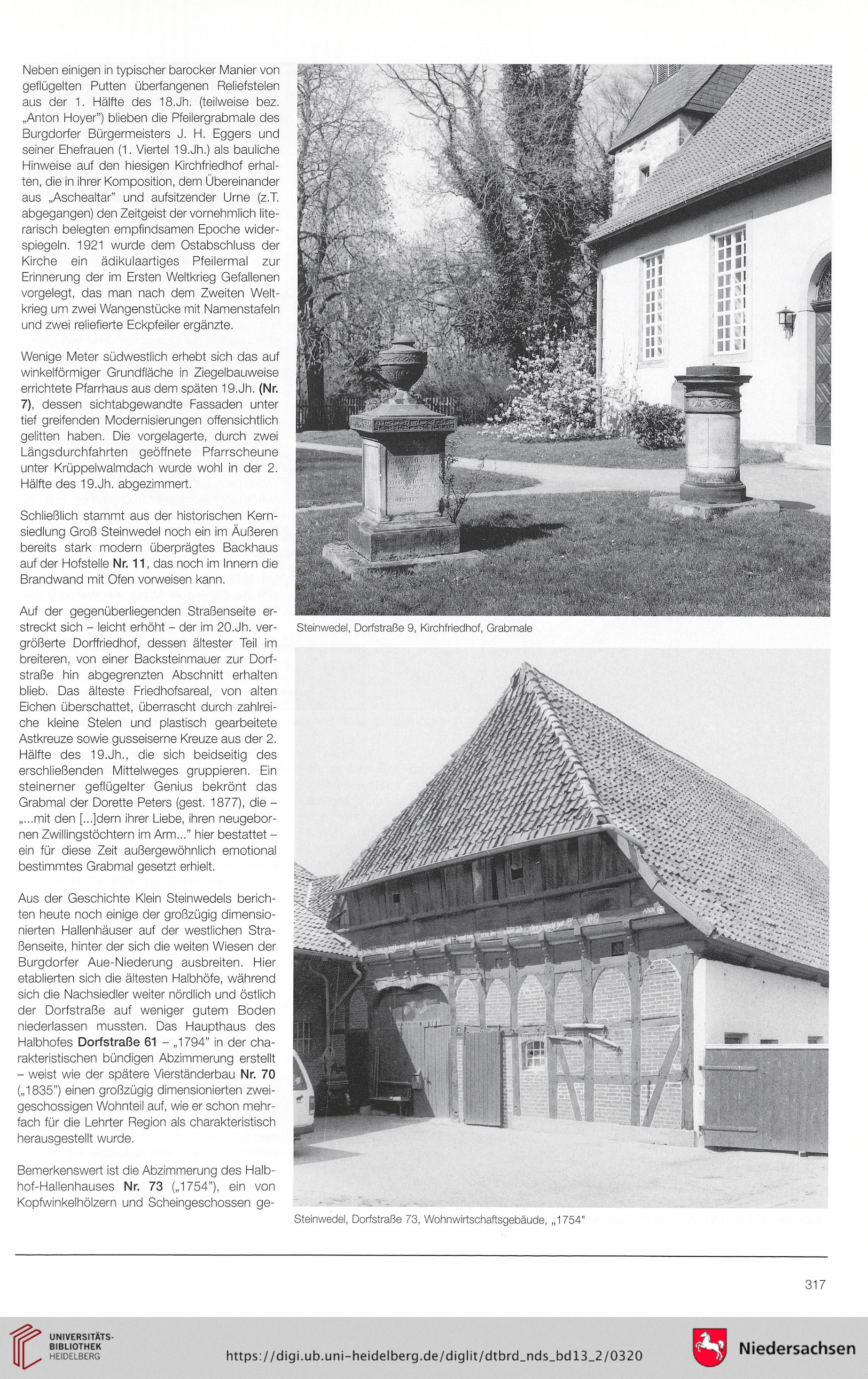Neben einigen in typischer barocker Manier von
geflügelten Putten überfangenen Reliefstelen
aus der 1. Hälfte des 18.Jh. (teilweise bez.
„Anton Hoyer”) blieben die Pfeilergrabmale des
Burgdorfer Bürgermeisters J. H. Eggers und
seiner Ehefrauen (1. Viertel 19.Jh.) als bauliche
Hinweise auf den hiesigen Kirchfriedhof erhal-
ten, die in ihrer Komposition, dem Übereinander
aus „Aschealtar” und aufsitzender Urne (z.T.
abgegangen) den Zeitgeist der vornehmlich lite-
rarisch belegten empfindsamen Epoche wider-
spiegeln. 1921 wurde dem Ostabschluss der
Kirche ein ädikulaartiges Pfeilermai zur
Erinnerung der im Ersten Weltkrieg Gefallenen
vorgelegt, das man nach dem Zweiten Welt-
krieg um zwei Wangenstücke mit Namenstafeln
und zwei reliefierte Eckpfeiler ergänzte.
Wenige Meter südwestlich erhebt sich das auf
winkelförmiger Grundfläche in Ziegelbauweise
errichtete Pfarrhaus aus dem späten 19.Jh. (Nr.
7), dessen sichtabgewandte Fassaden unter
tief greifenden Modernisierungen offensichtlich
gelitten haben. Die vorgelagerte, durch zwei
Längsdurchfahrten geöffnete Pfarrscheune
unter Krüppelwalmdach wurde wohl in der 2.
Hälfte des 19.Jh. abgezimmert.
Schließlich stammt aus der historischen Kern-
siedlung Groß Steinwedel noch ein im Äußeren
bereits stark modern überprägtes Backhaus
auf der Hofstelle Nr. 11, das noch im Innern die
Brandwand mit Ofen vorweisen kann.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite er-
streckt sich - leicht erhöht - der im 20.Jh. ver-
größerte Dorffriedhof, dessen ältester Teil im
breiteren, von einer Backsteinmauer zur Dorf-
straße hin abgegrenzten Abschnitt erhalten
blieb. Das älteste Friedhofsareal, von alten
Eichen überschattet, überrascht durch zahlrei-
che kleine Stelen und plastisch gearbeitete
Astkreuze sowie gusseiserne Kreuze aus der 2.
Hälfte des 19.Jh., die sich beidseitig des
erschließenden Mittelweges gruppieren. Ein
steinerner geflügelter Genius bekrönt das
Grabmal der Dorette Peters (gest. 1877), die -
mit den [,..]dern ihrer Liebe, ihren neugebor-
nen Zwillingstöchtern im Arm...” hier bestattet -
ein für diese Zeit außergewöhnlich emotional
bestimmtes Grabmal gesetzt erhielt.
Aus der Geschichte Klein Steinwedels berich-
ten heute noch einige der großzügig dimensio-
nierten Hallenhäuser auf der westlichen Stra-
ßenseite, hinter der sich die weiten Wiesen der
Burgdorfer Aue-Niederung ausbreiten. Hier
etablierten sich die ältesten Halbhöfe, während
sich die Nachsiedler weiter nördlich und östlich
der Dorfstraße auf weniger gutem Boden
niederlassen mussten. Das Haupthaus des
Halbhofes Dorfstraße 61 - „1794” in der cha-
rakteristischen bündigen Abzimmerung erstellt
- weist wie der spätere Vierständerbau Nr. 70
(„1835”) einen großzügig dimensionierten zwei-
geschossigen Wohnteil auf, wie er schon mehr-
fach für die Lehrter Region als charakteristisch
herausgestellt wurde.
Bemerkenswert ist die Abzimmerung des Halb-
hof-Hallenhauses Nr. 73 („1754”), ein von
Kopfwinkelhölzern und Scheingeschossen ge-
Steinwedel, Dorfstraße 9, Kirchfriedhof, Grabmale
Steinwedel, Dorfstraße 73, Wohnwirtschaftsgebäude, „1754"
317
geflügelten Putten überfangenen Reliefstelen
aus der 1. Hälfte des 18.Jh. (teilweise bez.
„Anton Hoyer”) blieben die Pfeilergrabmale des
Burgdorfer Bürgermeisters J. H. Eggers und
seiner Ehefrauen (1. Viertel 19.Jh.) als bauliche
Hinweise auf den hiesigen Kirchfriedhof erhal-
ten, die in ihrer Komposition, dem Übereinander
aus „Aschealtar” und aufsitzender Urne (z.T.
abgegangen) den Zeitgeist der vornehmlich lite-
rarisch belegten empfindsamen Epoche wider-
spiegeln. 1921 wurde dem Ostabschluss der
Kirche ein ädikulaartiges Pfeilermai zur
Erinnerung der im Ersten Weltkrieg Gefallenen
vorgelegt, das man nach dem Zweiten Welt-
krieg um zwei Wangenstücke mit Namenstafeln
und zwei reliefierte Eckpfeiler ergänzte.
Wenige Meter südwestlich erhebt sich das auf
winkelförmiger Grundfläche in Ziegelbauweise
errichtete Pfarrhaus aus dem späten 19.Jh. (Nr.
7), dessen sichtabgewandte Fassaden unter
tief greifenden Modernisierungen offensichtlich
gelitten haben. Die vorgelagerte, durch zwei
Längsdurchfahrten geöffnete Pfarrscheune
unter Krüppelwalmdach wurde wohl in der 2.
Hälfte des 19.Jh. abgezimmert.
Schließlich stammt aus der historischen Kern-
siedlung Groß Steinwedel noch ein im Äußeren
bereits stark modern überprägtes Backhaus
auf der Hofstelle Nr. 11, das noch im Innern die
Brandwand mit Ofen vorweisen kann.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite er-
streckt sich - leicht erhöht - der im 20.Jh. ver-
größerte Dorffriedhof, dessen ältester Teil im
breiteren, von einer Backsteinmauer zur Dorf-
straße hin abgegrenzten Abschnitt erhalten
blieb. Das älteste Friedhofsareal, von alten
Eichen überschattet, überrascht durch zahlrei-
che kleine Stelen und plastisch gearbeitete
Astkreuze sowie gusseiserne Kreuze aus der 2.
Hälfte des 19.Jh., die sich beidseitig des
erschließenden Mittelweges gruppieren. Ein
steinerner geflügelter Genius bekrönt das
Grabmal der Dorette Peters (gest. 1877), die -
mit den [,..]dern ihrer Liebe, ihren neugebor-
nen Zwillingstöchtern im Arm...” hier bestattet -
ein für diese Zeit außergewöhnlich emotional
bestimmtes Grabmal gesetzt erhielt.
Aus der Geschichte Klein Steinwedels berich-
ten heute noch einige der großzügig dimensio-
nierten Hallenhäuser auf der westlichen Stra-
ßenseite, hinter der sich die weiten Wiesen der
Burgdorfer Aue-Niederung ausbreiten. Hier
etablierten sich die ältesten Halbhöfe, während
sich die Nachsiedler weiter nördlich und östlich
der Dorfstraße auf weniger gutem Boden
niederlassen mussten. Das Haupthaus des
Halbhofes Dorfstraße 61 - „1794” in der cha-
rakteristischen bündigen Abzimmerung erstellt
- weist wie der spätere Vierständerbau Nr. 70
(„1835”) einen großzügig dimensionierten zwei-
geschossigen Wohnteil auf, wie er schon mehr-
fach für die Lehrter Region als charakteristisch
herausgestellt wurde.
Bemerkenswert ist die Abzimmerung des Halb-
hof-Hallenhauses Nr. 73 („1754”), ein von
Kopfwinkelhölzern und Scheingeschossen ge-
Steinwedel, Dorfstraße 9, Kirchfriedhof, Grabmale
Steinwedel, Dorfstraße 73, Wohnwirtschaftsgebäude, „1754"
317