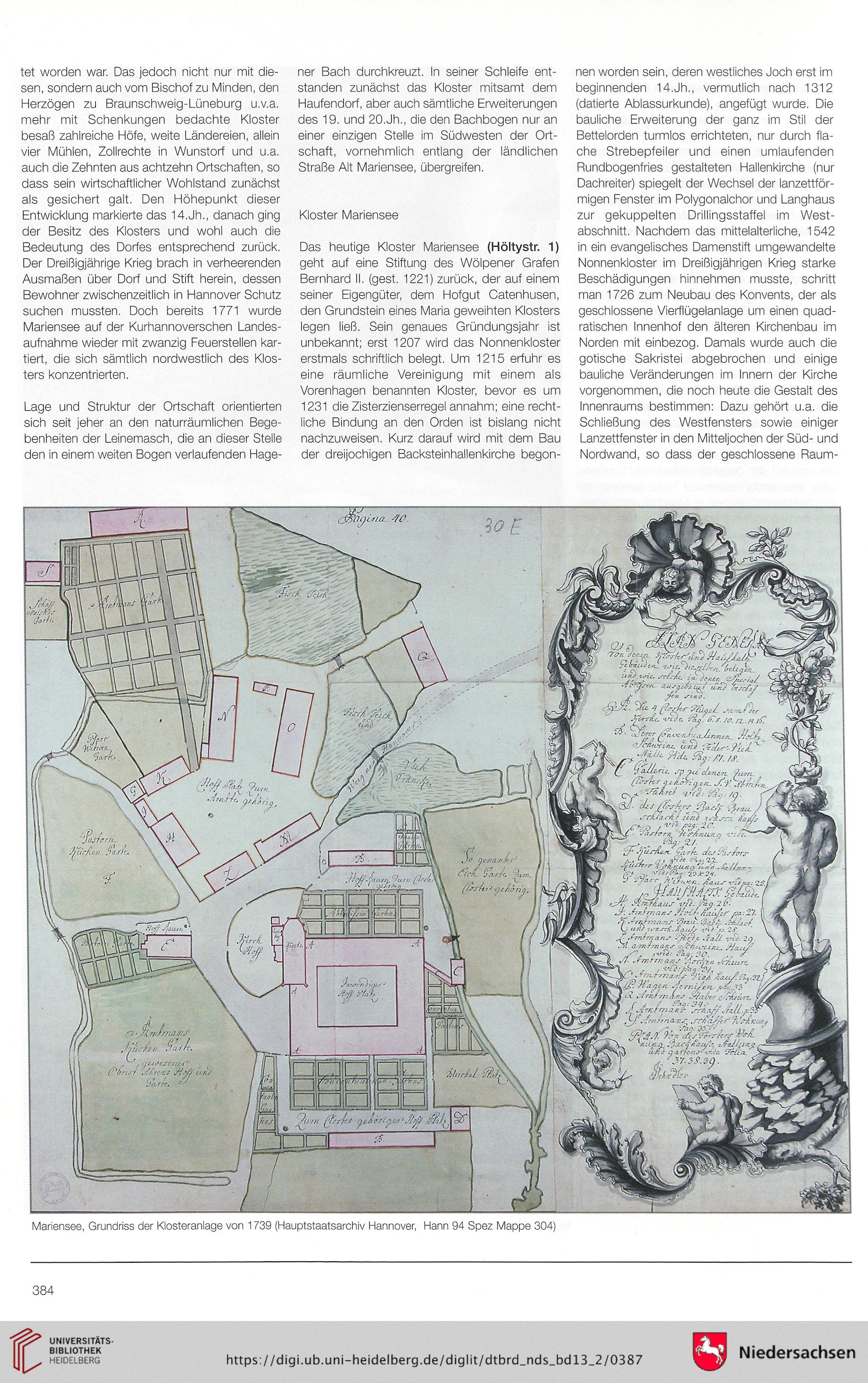tet worden war. Das jedoch nicht nur mit die-
sen, sondern auch vom Bischof zu Minden, den
Herzögen zu Braunschweig-Lüneburg u.v.a.
mehr mit Schenkungen bedachte Kloster
besaß zahlreiche Höfe, weite Ländereien, allein
vier Mühlen, Zollrechte in Wunstorf und u.a.
auch die Zehnten aus achtzehn Ortschaften, so
dass sein wirtschaftlicher Wohlstand zunächst
als gesichert galt. Den Höhepunkt dieser
Entwicklung markierte das 14.Jh., danach ging
der Besitz des Klosters und wohl auch die
Bedeutung des Dorfes entsprechend zurück.
Der Dreißigjährige Krieg brach in verheerenden
Ausmaßen über Dorf und Stift herein, dessen
Bewohner zwischenzeitlich in Hannover Schutz
suchen mussten. Doch bereits 1771 wurde
Mariensee auf der Kurhannoverschen Landes-
aufnahme wieder mit zwanzig Feuerstellen kar-
tiert, die sich sämtlich nordwestlich des Klos-
ters konzentrierten.
Lage und Struktur der Ortschaft orientierten
sich seit jeher an den naturräumlichen Bege-
benheiten der Leinemasch, die an dieser Stelle
den in einem weiten Bogen verlaufenden Hage-
ner Bach durchkreuzt. In seiner Schleife ent-
standen zunächst das Kloster mitsamt dem
Haufendorf, aber auch sämtliche Erweiterungen
des 19. und 20.Jh., die den Bachbogen nur an
einer einzigen Stelle im Südwesten der Ort-
schaft, vornehmlich entlang der ländlichen
Straße Alt Mariensee, übergreifen.
Kloster Mariensee
Das heutige Kloster Mariensee (Höltystr. 1)
geht auf eine Stiftung des Wölpener Grafen
Bernhard II. (gest. 1221) zurück, der auf einem
seiner Eigengüter, dem Hofgut Catenhusen,
den Grundstein eines Maria geweihten Klosters
legen ließ. Sein genaues Gründungsjahr ist
unbekannt; erst 1207 wird das Nonnenkloster
erstmals schriftlich belegt. Um 1215 erfuhr es
eine räumliche Vereinigung mit einem als
Vorenhagen benannten Kloster, bevor es um
1231 die Zisterzienserregel annahm; eine recht-
liche Bindung an den Orden ist bislang nicht
nachzuweisen. Kurz darauf wird mit dem Bau
der dreijochigen Backsteinhallenkirche begon-
nen worden sein, deren westliches Joch erst im
beginnenden 14.Jh., vermutlich nach 1312
(datierte Ablassurkunde), angefügt wurde. Die
bauliche Erweiterung der ganz im Stil der
Bettelorden turmlos errichteten, nur durch fla-
che Strebepfeiler und einen umlaufenden
Rundbogenfries gestalteten Hallenkirche (nur
Dachreiter) spiegelt der Wechsel der lanzettför-
migen Fenster im Polygonalchor und Langhaus
zur gekuppelten Drillingsstaffel im West-
abschnitt. Nachdem das mittelalterliche, 1542
in ein evangelisches Damenstift umgewandelte
Nonnenkloster im Dreißigjährigen Krieg starke
Beschädigungen hinnehmen musste, schritt
man 1726 zum Neubau des Konvents, der als
geschlossene Vierflügelanlage um einen quad-
ratischen Innenhof den älteren Kirchenbau im
Norden mit einbezog. Damals wurde auch die
gotische Sakristei abgebrochen und einige
bauliche Veränderungen im Innern der Kirche
vorgenommen, die noch heute die Gestalt des
Innenraums bestimmen: Dazu gehört u.a. die
Schließung des Westfensters sowie einiger
Lanzettfenster in den Mitteljochen der Süd- und
Nordwand, so dass der geschlossene Raum-
oo
i /ö 'L
!.
1 i
o
1—1
o
o
0)0
Mariensee, Grundriss der Klosteranlage von 1739 (Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann 94 Spez Mappe 304)
384
sen, sondern auch vom Bischof zu Minden, den
Herzögen zu Braunschweig-Lüneburg u.v.a.
mehr mit Schenkungen bedachte Kloster
besaß zahlreiche Höfe, weite Ländereien, allein
vier Mühlen, Zollrechte in Wunstorf und u.a.
auch die Zehnten aus achtzehn Ortschaften, so
dass sein wirtschaftlicher Wohlstand zunächst
als gesichert galt. Den Höhepunkt dieser
Entwicklung markierte das 14.Jh., danach ging
der Besitz des Klosters und wohl auch die
Bedeutung des Dorfes entsprechend zurück.
Der Dreißigjährige Krieg brach in verheerenden
Ausmaßen über Dorf und Stift herein, dessen
Bewohner zwischenzeitlich in Hannover Schutz
suchen mussten. Doch bereits 1771 wurde
Mariensee auf der Kurhannoverschen Landes-
aufnahme wieder mit zwanzig Feuerstellen kar-
tiert, die sich sämtlich nordwestlich des Klos-
ters konzentrierten.
Lage und Struktur der Ortschaft orientierten
sich seit jeher an den naturräumlichen Bege-
benheiten der Leinemasch, die an dieser Stelle
den in einem weiten Bogen verlaufenden Hage-
ner Bach durchkreuzt. In seiner Schleife ent-
standen zunächst das Kloster mitsamt dem
Haufendorf, aber auch sämtliche Erweiterungen
des 19. und 20.Jh., die den Bachbogen nur an
einer einzigen Stelle im Südwesten der Ort-
schaft, vornehmlich entlang der ländlichen
Straße Alt Mariensee, übergreifen.
Kloster Mariensee
Das heutige Kloster Mariensee (Höltystr. 1)
geht auf eine Stiftung des Wölpener Grafen
Bernhard II. (gest. 1221) zurück, der auf einem
seiner Eigengüter, dem Hofgut Catenhusen,
den Grundstein eines Maria geweihten Klosters
legen ließ. Sein genaues Gründungsjahr ist
unbekannt; erst 1207 wird das Nonnenkloster
erstmals schriftlich belegt. Um 1215 erfuhr es
eine räumliche Vereinigung mit einem als
Vorenhagen benannten Kloster, bevor es um
1231 die Zisterzienserregel annahm; eine recht-
liche Bindung an den Orden ist bislang nicht
nachzuweisen. Kurz darauf wird mit dem Bau
der dreijochigen Backsteinhallenkirche begon-
nen worden sein, deren westliches Joch erst im
beginnenden 14.Jh., vermutlich nach 1312
(datierte Ablassurkunde), angefügt wurde. Die
bauliche Erweiterung der ganz im Stil der
Bettelorden turmlos errichteten, nur durch fla-
che Strebepfeiler und einen umlaufenden
Rundbogenfries gestalteten Hallenkirche (nur
Dachreiter) spiegelt der Wechsel der lanzettför-
migen Fenster im Polygonalchor und Langhaus
zur gekuppelten Drillingsstaffel im West-
abschnitt. Nachdem das mittelalterliche, 1542
in ein evangelisches Damenstift umgewandelte
Nonnenkloster im Dreißigjährigen Krieg starke
Beschädigungen hinnehmen musste, schritt
man 1726 zum Neubau des Konvents, der als
geschlossene Vierflügelanlage um einen quad-
ratischen Innenhof den älteren Kirchenbau im
Norden mit einbezog. Damals wurde auch die
gotische Sakristei abgebrochen und einige
bauliche Veränderungen im Innern der Kirche
vorgenommen, die noch heute die Gestalt des
Innenraums bestimmen: Dazu gehört u.a. die
Schließung des Westfensters sowie einiger
Lanzettfenster in den Mitteljochen der Süd- und
Nordwand, so dass der geschlossene Raum-
oo
i /ö 'L
!.
1 i
o
1—1
o
o
0)0
Mariensee, Grundriss der Klosteranlage von 1739 (Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann 94 Spez Mappe 304)
384