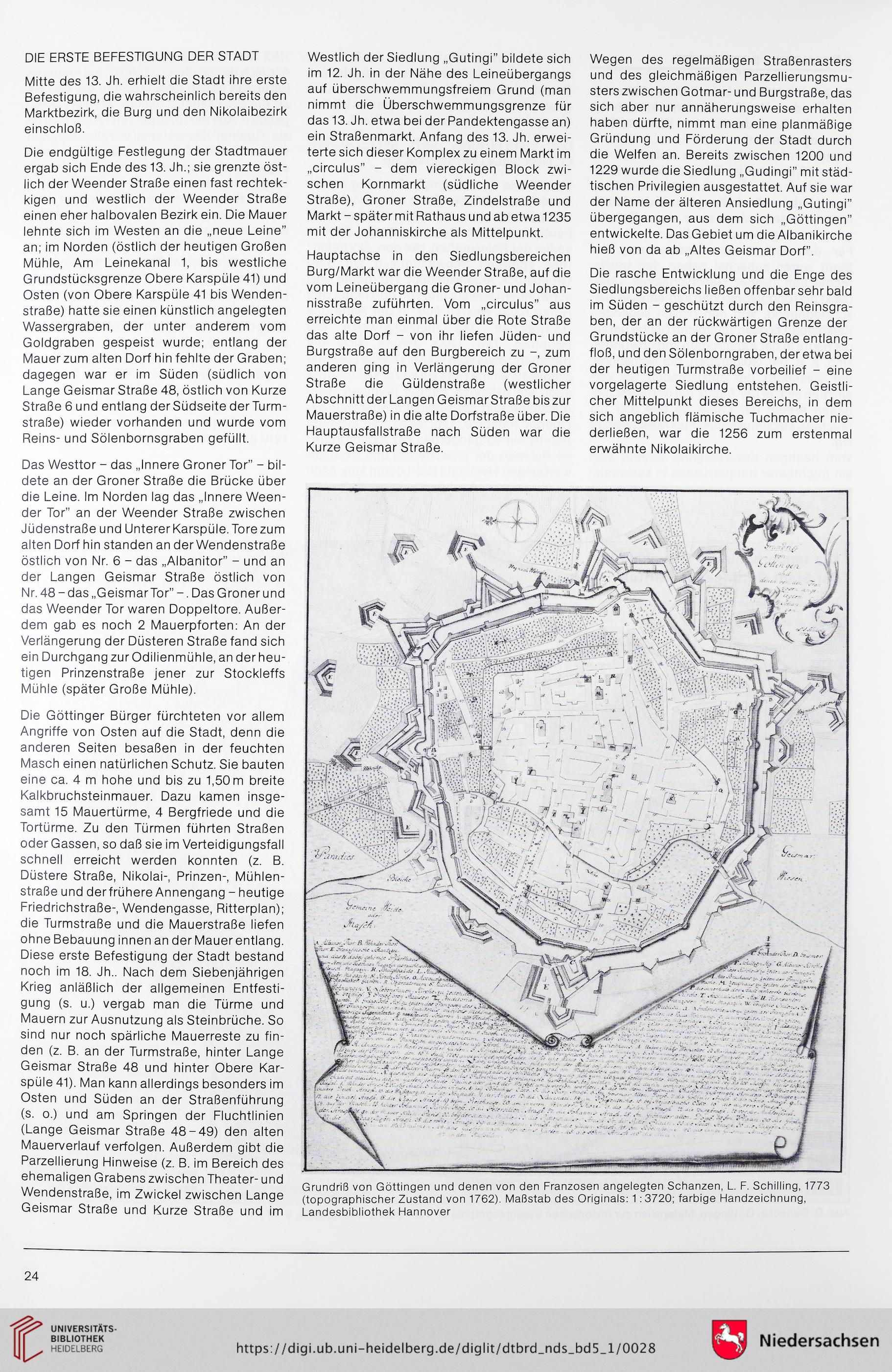DIE ERSTE BEFESTIGUNG DER STADT
Mitte des 13. Jh. erhielt die Stadt ihre erste
Befestigung, die wahrscheinlich bereits den
Marktbezirk, die Burg und den Nikolaibezirk
einschloß.
Die endgültige Festlegung der Stadtmauer
ergab sich Ende des 13. Jh.; sie grenzte öst-
lich der Weender Straße einen fast rechtek-
kigen und westlich der Weender Straße
einen eher halbovalen Bezirk ein. Die Mauer
lehnte sich im Westen an die „neue Leine”
an; im Norden (östlich der heutigen Großen
Mühle, Am Leinekanal 1, bis westliche
Grundstücksgrenze Obere Karspüle 41) und
Osten (von Obere Karspüle 41 bis Wenden-
straße) hatte sie einen künstlich angelegten
Wassergraben, der unter anderem vom
Goldgraben gespeist wurde; entlang der
Mauer zum alten Dorf hin fehlte der Graben;
dagegen war er im Süden (südlich von
Lange Geismar Straße 48, östlich von Kurze
Straße 6 und entlang derSüdseite der Turm-
straße) wieder vorhanden und wurde vom
Reins- und Sölenbornsgraben gefüllt.
Das Westtor - das „Innere Groner Tor” - bil-
dete an der Groner Straße die Brücke über
die Leine. Im Norden lag das „Innere Ween-
der Tor” an der Weender Straße zwischen
Jüdenstraße und Unterer Karspüle. Tore zum
alten Dorf hin standen an der Wendenstraße
östlich von Nr. 6 - das „Albanitor” - und an
der Langen Geismar Straße östlich von
Nr. 48 - das „Geismar Tor” -. Das Groner und
das Weender Tor waren Doppeltore. Außer-
dem gab es noch 2 Mauerpforten: An der
Verlängerung der Düsteren Straße fand sich
ein Durchgang zurOdilienmühle, an der heu-
tigen Prinzenstraße jener zur Stockleffs
Mühle (später Große Mühle).
Die Göttinger Bürger fürchteten vor allem
Angriffe von Osten auf die Stadt, denn die
anderen Seiten besaßen in der feuchten
Masch einen natürlichen Schutz. Sie bauten
eine ca. 4 m hohe und bis zu 1,50 m breite
Kalkbruchsteinmauer. Dazu kamen insge-
samt 15 Mauertürme, 4 Bergfriede und die
Tortürme. Zu den Türmen führten Straßen
oder Gassen, so daß sie im Verteidigungsfall
schnell erreicht werden konnten (z. B.
Düstere Straße, Nikolai-, Prinzen-, Mühlen-
straße und derfrühere Annengang - heutige
Friedrichstraße-, Wendengasse, Ritterplan);
die Turmstraße und die Mauerstraße liefen
ohne Bebauung innen an der Mauer entlang.
Diese erste Befestigung der Stadt bestand
noch im 18. Jh.. Nach dem Siebenjährigen
Krieg anläßlich der allgemeinen Entfesti-
gung (s. u.) vergab man die Türme und
Mauern zur Ausnutzung als Steinbrüche. So
sind nur noch spärliche Mauerreste zu fin-
den (z. B. an der Turmstraße, hinter Lange
Geismar Straße 48 und hinter Obere Kar-
spüle 41). Man kann allerdings besonders im
Osten und Süden an der Straßenführung
(s. o.) und am Springen der Fluchtlinien
(Lange Geismar Straße 48-49) den alten
Mauerverlauf verfolgen. Außerdem gibt die
Parzellierung Hinweise (z. B. im Bereich des
ehemaligen Grabens zwischen Theater- und
Wendenstraße, im Zwickel zwischen Lange
Geismar Straße und Kurze Straße und im
Westlich der Siedlung „Gutingi” bildete sich
im 12. Jh. in der Nähe des Leineübergangs
auf überschwemmungsfreiem Grund (man
nimmt die Überschwemmungsgrenze für
das 13. Jh. etwa bei der Pandektengasse an)
ein Straßenmarkt. Anfang des 13. Jh. erwei-
terte sich dieser Komplex zu einem Markt im
„circulus” - dem viereckigen Block zwi-
schen Kornmarkt (südliche Weender
Straße), Groner Straße, Zindelstraße und
Markt - später mit Rathaus und ab etwa 1235
mit der Johanniskirche als Mittelpunkt.
Hauptachse in den Siedlungsbereichen
Burg/Markt war die Weender Straße, auf die
vom Leineübergang die Groner- und Johan-
nisstraße zuführten. Vom „circulus” aus
erreichte man einmal über die Rote Straße
das alte Dorf - von ihr liefen Jüden- und
Burgstraße auf den Burgbereich zu -, zum
anderen ging in Verlängerung der Groner
Straße die Güldenstraße (westlicher
AbschnittderLangen GeismarStraße biszur
Mauerstraße) in die alte Dorfstraße über. Die
Hauptausfallstraße nach Süden war die
Kurze Geismar Straße.
Wegen des regelmäßigen Straßenrasters
und des gleichmäßigen Parzellierungsmu-
sters zwischen Gotmar- und Burgstraße, das
sich aber nur annäherungsweise erhalten
haben dürfte, nimmt man eine planmäßige
Gründung und Förderung der Stadt durch
die Welfen an. Bereits zwischen 1200 und
1229 wurde die Siedlung „Gudingi” mit städ-
tischen Privilegien ausgestattet. Auf sie war
der Name der älteren Ansiedlung „Gutingi”
übergegangen, aus dem sich „Göttingen”
entwickelte. Das Gebiet um die Albanikirche
hieß von da ab „Altes Geismar Dorf”.
Die rasche Entwicklung und die Enge des
Siedlungsbereichs ließen offenbarsehrbald
im Süden - geschützt durch den Reinsgra-
ben, der an der rückwärtigen Grenze der
Grundstücke an der Groner Straße entlang-
floß, und den Sölenborngraben, deretwa bei
der heutigen Turmstraße vorbeilief - eine
vorgelagerte Siedlung entstehen. Geistli-
cher Mittelpunkt dieses Bereichs, in dem
sich angeblich flämische Tuchmacher nie-
derließen, war die 1256 zum erstenmal
erwähnte Nikolaikirche.
Grundriß von Göttingen und denen von den Franzosen angelegten Schanzen, L. F. Schilling, 1773
(topographischer Zustand von 1762). Maßstab des Originals: 1:3720; farbige Handzeichnung,
Landesbibliothek Hannover
24
Mitte des 13. Jh. erhielt die Stadt ihre erste
Befestigung, die wahrscheinlich bereits den
Marktbezirk, die Burg und den Nikolaibezirk
einschloß.
Die endgültige Festlegung der Stadtmauer
ergab sich Ende des 13. Jh.; sie grenzte öst-
lich der Weender Straße einen fast rechtek-
kigen und westlich der Weender Straße
einen eher halbovalen Bezirk ein. Die Mauer
lehnte sich im Westen an die „neue Leine”
an; im Norden (östlich der heutigen Großen
Mühle, Am Leinekanal 1, bis westliche
Grundstücksgrenze Obere Karspüle 41) und
Osten (von Obere Karspüle 41 bis Wenden-
straße) hatte sie einen künstlich angelegten
Wassergraben, der unter anderem vom
Goldgraben gespeist wurde; entlang der
Mauer zum alten Dorf hin fehlte der Graben;
dagegen war er im Süden (südlich von
Lange Geismar Straße 48, östlich von Kurze
Straße 6 und entlang derSüdseite der Turm-
straße) wieder vorhanden und wurde vom
Reins- und Sölenbornsgraben gefüllt.
Das Westtor - das „Innere Groner Tor” - bil-
dete an der Groner Straße die Brücke über
die Leine. Im Norden lag das „Innere Ween-
der Tor” an der Weender Straße zwischen
Jüdenstraße und Unterer Karspüle. Tore zum
alten Dorf hin standen an der Wendenstraße
östlich von Nr. 6 - das „Albanitor” - und an
der Langen Geismar Straße östlich von
Nr. 48 - das „Geismar Tor” -. Das Groner und
das Weender Tor waren Doppeltore. Außer-
dem gab es noch 2 Mauerpforten: An der
Verlängerung der Düsteren Straße fand sich
ein Durchgang zurOdilienmühle, an der heu-
tigen Prinzenstraße jener zur Stockleffs
Mühle (später Große Mühle).
Die Göttinger Bürger fürchteten vor allem
Angriffe von Osten auf die Stadt, denn die
anderen Seiten besaßen in der feuchten
Masch einen natürlichen Schutz. Sie bauten
eine ca. 4 m hohe und bis zu 1,50 m breite
Kalkbruchsteinmauer. Dazu kamen insge-
samt 15 Mauertürme, 4 Bergfriede und die
Tortürme. Zu den Türmen führten Straßen
oder Gassen, so daß sie im Verteidigungsfall
schnell erreicht werden konnten (z. B.
Düstere Straße, Nikolai-, Prinzen-, Mühlen-
straße und derfrühere Annengang - heutige
Friedrichstraße-, Wendengasse, Ritterplan);
die Turmstraße und die Mauerstraße liefen
ohne Bebauung innen an der Mauer entlang.
Diese erste Befestigung der Stadt bestand
noch im 18. Jh.. Nach dem Siebenjährigen
Krieg anläßlich der allgemeinen Entfesti-
gung (s. u.) vergab man die Türme und
Mauern zur Ausnutzung als Steinbrüche. So
sind nur noch spärliche Mauerreste zu fin-
den (z. B. an der Turmstraße, hinter Lange
Geismar Straße 48 und hinter Obere Kar-
spüle 41). Man kann allerdings besonders im
Osten und Süden an der Straßenführung
(s. o.) und am Springen der Fluchtlinien
(Lange Geismar Straße 48-49) den alten
Mauerverlauf verfolgen. Außerdem gibt die
Parzellierung Hinweise (z. B. im Bereich des
ehemaligen Grabens zwischen Theater- und
Wendenstraße, im Zwickel zwischen Lange
Geismar Straße und Kurze Straße und im
Westlich der Siedlung „Gutingi” bildete sich
im 12. Jh. in der Nähe des Leineübergangs
auf überschwemmungsfreiem Grund (man
nimmt die Überschwemmungsgrenze für
das 13. Jh. etwa bei der Pandektengasse an)
ein Straßenmarkt. Anfang des 13. Jh. erwei-
terte sich dieser Komplex zu einem Markt im
„circulus” - dem viereckigen Block zwi-
schen Kornmarkt (südliche Weender
Straße), Groner Straße, Zindelstraße und
Markt - später mit Rathaus und ab etwa 1235
mit der Johanniskirche als Mittelpunkt.
Hauptachse in den Siedlungsbereichen
Burg/Markt war die Weender Straße, auf die
vom Leineübergang die Groner- und Johan-
nisstraße zuführten. Vom „circulus” aus
erreichte man einmal über die Rote Straße
das alte Dorf - von ihr liefen Jüden- und
Burgstraße auf den Burgbereich zu -, zum
anderen ging in Verlängerung der Groner
Straße die Güldenstraße (westlicher
AbschnittderLangen GeismarStraße biszur
Mauerstraße) in die alte Dorfstraße über. Die
Hauptausfallstraße nach Süden war die
Kurze Geismar Straße.
Wegen des regelmäßigen Straßenrasters
und des gleichmäßigen Parzellierungsmu-
sters zwischen Gotmar- und Burgstraße, das
sich aber nur annäherungsweise erhalten
haben dürfte, nimmt man eine planmäßige
Gründung und Förderung der Stadt durch
die Welfen an. Bereits zwischen 1200 und
1229 wurde die Siedlung „Gudingi” mit städ-
tischen Privilegien ausgestattet. Auf sie war
der Name der älteren Ansiedlung „Gutingi”
übergegangen, aus dem sich „Göttingen”
entwickelte. Das Gebiet um die Albanikirche
hieß von da ab „Altes Geismar Dorf”.
Die rasche Entwicklung und die Enge des
Siedlungsbereichs ließen offenbarsehrbald
im Süden - geschützt durch den Reinsgra-
ben, der an der rückwärtigen Grenze der
Grundstücke an der Groner Straße entlang-
floß, und den Sölenborngraben, deretwa bei
der heutigen Turmstraße vorbeilief - eine
vorgelagerte Siedlung entstehen. Geistli-
cher Mittelpunkt dieses Bereichs, in dem
sich angeblich flämische Tuchmacher nie-
derließen, war die 1256 zum erstenmal
erwähnte Nikolaikirche.
Grundriß von Göttingen und denen von den Franzosen angelegten Schanzen, L. F. Schilling, 1773
(topographischer Zustand von 1762). Maßstab des Originals: 1:3720; farbige Handzeichnung,
Landesbibliothek Hannover
24