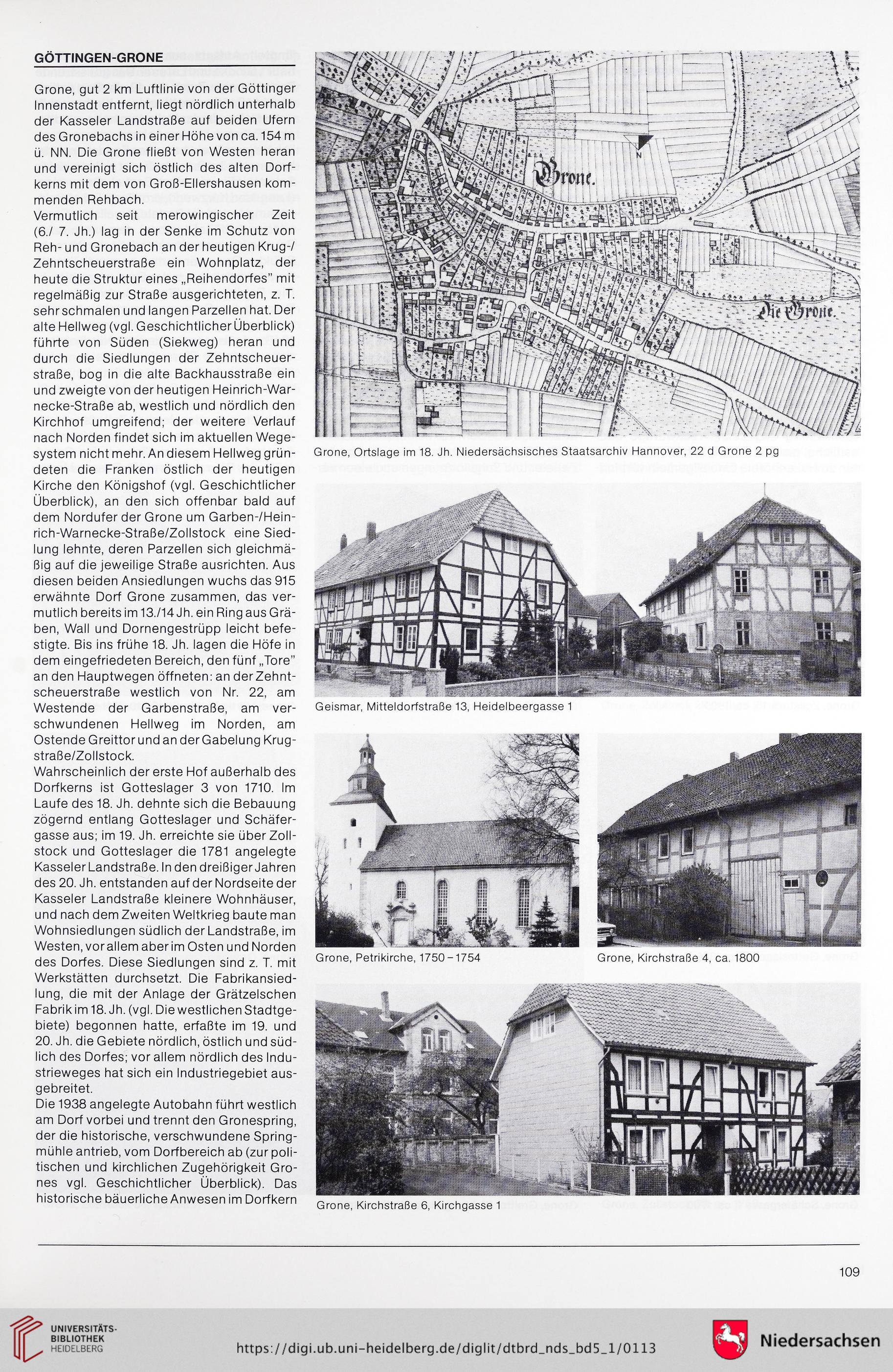GÖTTINGEN-GRONE
Grone, gut 2 km Luftlinie von der Göttinger
Innenstadt entfernt, liegt nördlich unterhalb
der Kasseler Landstraße auf beiden Ufern
des Gronebachs in einerHöhe von ca. 154 m
ü. NN. Die Grone fließt von Westen heran
und vereinigt sich östlich des alten Dorf-
kerns mit dem von Groß-Ellershausen kom-
menden Rehbach.
Vermutlich seit merowingischer Zeit
(6./ 7. Jh.) lag in der Senke im Schutz von
Reh- und Gronebach an der heutigen Krug-/
Zehntscheuerstraße ein Wohnplatz, der
heute die Struktur eines „Reihendorfes” mit
regelmäßig zur Straße ausgerichteten, z. T.
sehr schmalen und langen Parzellen hat. Der
alte Hellweg (vgl. Geschichtlicher überblick)
führte von Süden (Siekweg) heran und
durch die Siedlungen der Zehntscheuer-
straße, bog in die alte Backhausstraße ein
und zweigte von der heutigen Heinrich-War-
necke-Straße ab, westlich und nördlich den
Kirchhof umgreifend; der weitere Verlauf
nach Norden findet sich im aktuellen Wege-
system nicht mehr. An diesem Hellweg grün-
deten die Franken östlich der heutigen
Kirche den Königshof (vgl. Geschichtlicher
Überblick), an den sich offenbar bald auf
dem Nordufer der Grone um Garben-/Hein-
rich-Warnecke-Straße/Zollstock eine Sied-
lung lehnte, deren Parzellen sich gleichmä-
ßig auf die jeweilige Straße ausrichten. Aus
diesen beiden Ansiedlungen wuchs das 915
erwähnte Dorf Grone zusammen, das ver-
mutlich bereits im 13./14 Jh. ein Ring aus Grä-
ben, Wall und Dornengestrüpp leicht befe-
stigte. Bis ins frühe 18. Jh. lagen die Höfe in
dem eingefriedeten Bereich, den fünf „Tore”
an den Hauptwegen öffneten: an derZehnt-
scheuerstraße westlich von Nr. 22, am
Westende der Garbenstraße, am ver-
schwundenen Hellweg im Norden, am
Ostende Greittorund an derGabelung Krug-
straße/Zollstock.
Wahrscheinlich der erste Hof außerhalb des
Dorfkerns ist Gotteslager 3 von 1710. Im
Laufe des 18. Jh. dehnte sich die Bebauung
zögernd entlang Gotteslager und Schäfer-
gasse aus; im 19. Jh. erreichte sie über Zoll-
stock und Gotteslager die 1781 angelegte
Kasseler Landstraße. In den dreißiger Jahren
des 20. Jh. entstanden auf der Nordseite der
Kasseler Landstraße kleinere Wohnhäuser,
und nach dem Zweiten Weltkrieg baute man
Wohnsiedlungen südlich der Landstraße, im
Westen, vorallem aberim Osten und Norden
des Dorfes. Diese Siedlungen sind z. T. mit
Werkstätten durchsetzt. Die Fabrikansied-
lung, die mit der Anlage der Grätzeischen
Fabrik im 18. Jh. (vgl. Die westlichen Stadtge-
biete) begonnen hatte, erfaßte im 19. und
20. Jh. die Gebiete nördlich, östlich und süd-
lich des Dorfes; vor allem nördlich des Indu-
strieweges hat sich ein Industriegebiet aus-
gebreitet.
Die 1938 angelegte Autobahn führt westlich
am Dorf vorbei und trennt den Gronespring,
der die historische, verschwundene Spring-
mühle antrieb, vom Dorfbereich ab (zur poli-
tischen und kirchlichen Zugehörigkeit Gro-
nes vgl. Geschichtlicher Überblick). Das
historische bäuerliche Anwesen im Dorfkern
Grone, Ortslage im 18. Jh. Niedersächsisches Staatsarchiv Hannover, 22 d Grone 2 pg
Geismar, Mitteldorfstraße 13, Heidelbeergasse 1
Grone, Petrikirche, 1750-1754 Grone, Kirchstraße 4, ca. 1800
Grone, Kirchstraße 6, Kirchgasse 1
109
Grone, gut 2 km Luftlinie von der Göttinger
Innenstadt entfernt, liegt nördlich unterhalb
der Kasseler Landstraße auf beiden Ufern
des Gronebachs in einerHöhe von ca. 154 m
ü. NN. Die Grone fließt von Westen heran
und vereinigt sich östlich des alten Dorf-
kerns mit dem von Groß-Ellershausen kom-
menden Rehbach.
Vermutlich seit merowingischer Zeit
(6./ 7. Jh.) lag in der Senke im Schutz von
Reh- und Gronebach an der heutigen Krug-/
Zehntscheuerstraße ein Wohnplatz, der
heute die Struktur eines „Reihendorfes” mit
regelmäßig zur Straße ausgerichteten, z. T.
sehr schmalen und langen Parzellen hat. Der
alte Hellweg (vgl. Geschichtlicher überblick)
führte von Süden (Siekweg) heran und
durch die Siedlungen der Zehntscheuer-
straße, bog in die alte Backhausstraße ein
und zweigte von der heutigen Heinrich-War-
necke-Straße ab, westlich und nördlich den
Kirchhof umgreifend; der weitere Verlauf
nach Norden findet sich im aktuellen Wege-
system nicht mehr. An diesem Hellweg grün-
deten die Franken östlich der heutigen
Kirche den Königshof (vgl. Geschichtlicher
Überblick), an den sich offenbar bald auf
dem Nordufer der Grone um Garben-/Hein-
rich-Warnecke-Straße/Zollstock eine Sied-
lung lehnte, deren Parzellen sich gleichmä-
ßig auf die jeweilige Straße ausrichten. Aus
diesen beiden Ansiedlungen wuchs das 915
erwähnte Dorf Grone zusammen, das ver-
mutlich bereits im 13./14 Jh. ein Ring aus Grä-
ben, Wall und Dornengestrüpp leicht befe-
stigte. Bis ins frühe 18. Jh. lagen die Höfe in
dem eingefriedeten Bereich, den fünf „Tore”
an den Hauptwegen öffneten: an derZehnt-
scheuerstraße westlich von Nr. 22, am
Westende der Garbenstraße, am ver-
schwundenen Hellweg im Norden, am
Ostende Greittorund an derGabelung Krug-
straße/Zollstock.
Wahrscheinlich der erste Hof außerhalb des
Dorfkerns ist Gotteslager 3 von 1710. Im
Laufe des 18. Jh. dehnte sich die Bebauung
zögernd entlang Gotteslager und Schäfer-
gasse aus; im 19. Jh. erreichte sie über Zoll-
stock und Gotteslager die 1781 angelegte
Kasseler Landstraße. In den dreißiger Jahren
des 20. Jh. entstanden auf der Nordseite der
Kasseler Landstraße kleinere Wohnhäuser,
und nach dem Zweiten Weltkrieg baute man
Wohnsiedlungen südlich der Landstraße, im
Westen, vorallem aberim Osten und Norden
des Dorfes. Diese Siedlungen sind z. T. mit
Werkstätten durchsetzt. Die Fabrikansied-
lung, die mit der Anlage der Grätzeischen
Fabrik im 18. Jh. (vgl. Die westlichen Stadtge-
biete) begonnen hatte, erfaßte im 19. und
20. Jh. die Gebiete nördlich, östlich und süd-
lich des Dorfes; vor allem nördlich des Indu-
strieweges hat sich ein Industriegebiet aus-
gebreitet.
Die 1938 angelegte Autobahn führt westlich
am Dorf vorbei und trennt den Gronespring,
der die historische, verschwundene Spring-
mühle antrieb, vom Dorfbereich ab (zur poli-
tischen und kirchlichen Zugehörigkeit Gro-
nes vgl. Geschichtlicher Überblick). Das
historische bäuerliche Anwesen im Dorfkern
Grone, Ortslage im 18. Jh. Niedersächsisches Staatsarchiv Hannover, 22 d Grone 2 pg
Geismar, Mitteldorfstraße 13, Heidelbeergasse 1
Grone, Petrikirche, 1750-1754 Grone, Kirchstraße 4, ca. 1800
Grone, Kirchstraße 6, Kirchgasse 1
109