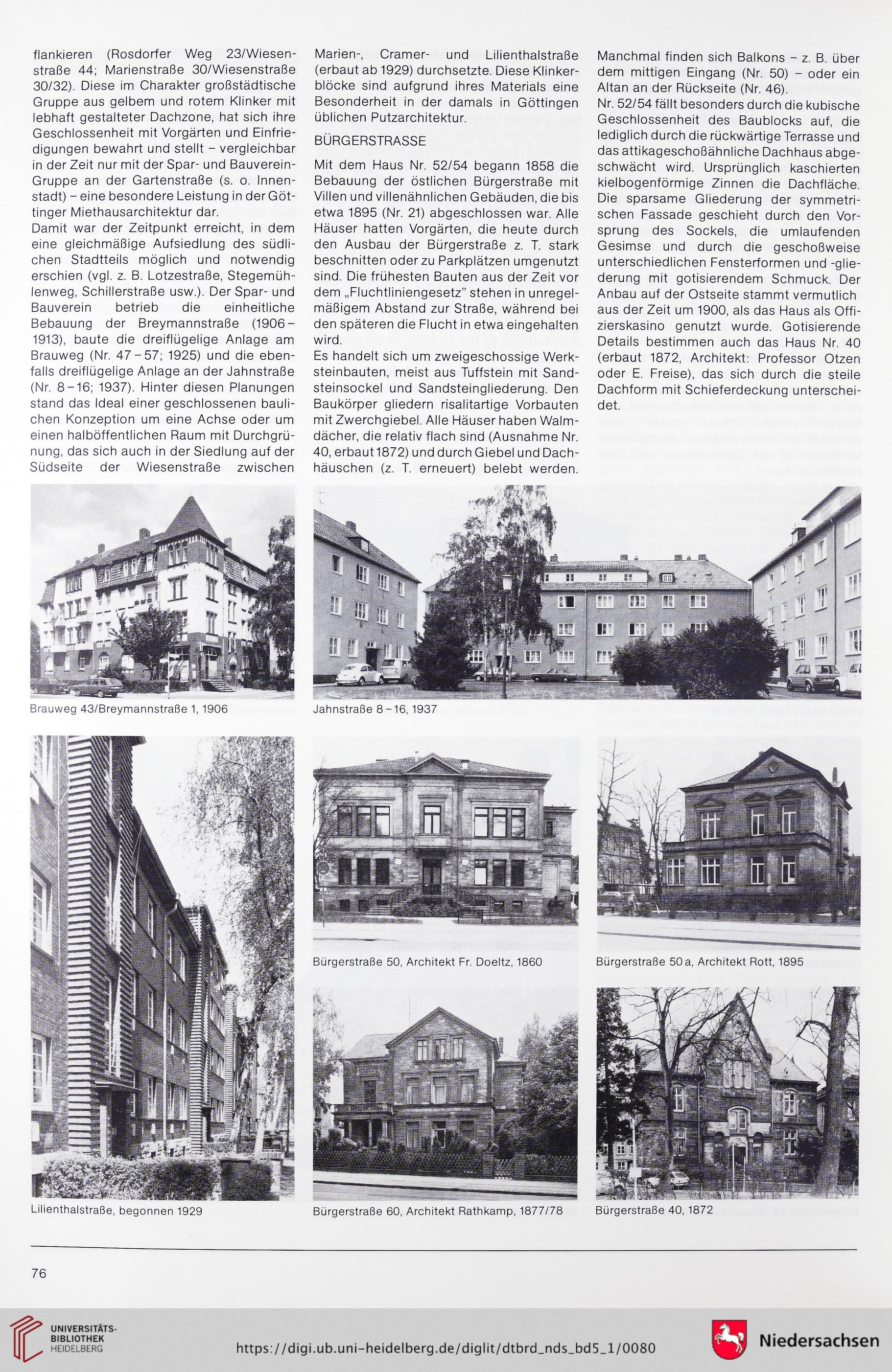flankieren (Rosdorfer Weg 23/Wiesen-
straße 44; Marienstraße 30/Wiesenstraße
30/32). Diese im Charakter großstädtische
Gruppe aus gelbem und rotem Klinker mit
lebhaft gestalteter Dachzone, hat sich ihre
Geschlossenheit mit Vorgärten und Einfrie-
digungen bewahrt und stellt - vergleichbar
in der Zeit nur mit der Spar- und Bauverein-
Gruppe an der Gartenstraße (s. o. Innen-
stadt) - eine besondere Leistung in derGöt-
tinger Miethausarchitektur dar.
Damit war der Zeitpunkt erreicht, in dem
eine gleichmäßige Aufsiedlung des südli-
chen Stadtteils möglich und notwendig
erschien (vgl. z. B. Lotzestraße, Stegemüh-
lenweg, Schillerstraße usw.). Der Spar- und
Bauverein betrieb die einheitliche
Bebauung der Breymannstraße (1906-
1913), baute die dreiflügelige Anlage am
Brauweg (Nr. 47-57; 1925) und die eben-
falls dreiflügelige Anlage an der Jahnstraße
(Nr. 8-16; 1937). Hinter diesen Planungen
stand das Ideal einer geschlossenen bauli-
chen Konzeption um eine Achse oder um
einen halböffentlichen Raum mit Durchgrü-
nung, das sich auch in der Siedlung auf der
Südseite der Wiesenstraße zwischen
Brauweg 43/Breymannstraße 1,1906
Lilienthalstraße, begonnen 1929
Marien-, Cramer- und Lilienthalstraße
(erbaut ab 1929) durchsetzte. Diese Klinker-
blöcke sind aufgrund ihres Materials eine
Besonderheit in der damals in Göttingen
üblichen Putzarchitektur.
BÜRGERSTRASSE
Mit dem Haus Nr. 52/54 begann 1858 die
Bebauung der östlichen Bürgerstraße mit
Villen und villenähnlichen Gebäuden, die bis
etwa 1895 (Nr. 21) abgeschlossen war. Alle
Häuser hatten Vorgärten, die heute durch
den Ausbau der Bürgerstraße z. T. stark
beschnitten oder zu Parkplätzen umgenutzt
sind. Die frühesten Bauten aus der Zeit vor
dem „Fluchtliniengesetz” stehen in unregel-
mäßigem Abstand zur Straße, während bei
den späteren die Flucht in etwa eingehalten
wird.
Es handelt sich um zweigeschossige Werk-
steinbauten, meist aus Tuffstein mit Sand-
steinsockel und Sandsteingliederung. Den
Baukörper gliedern risalitartige Vorbauten
mit Zwerchgiebel. Alle Häuser haben Walm-
dächer, die relativ flach sind (Ausnahme Nr.
40, erbaut1872) und durch Giebel und Dach-
häuschen (z. T. erneuert) belebt werden.
Manchmal finden sich Balkons - z. B. über
dem mittigen Eingang (Nr. 50) - oder ein
Altan an der Rückseite (Nr. 46).
Nr. 52/54 fällt besonders durch die kubische
Geschlossenheit des Baublocks auf, die
lediglich durch die rückwärtige Terrasse und
das attikageschoßähnliche Dachhaus abge-
schwächt wird. Ursprünglich kaschierten
kielbogenförmige Zinnen die Dachfläche.
Die sparsame Gliederung der symmetri-
schen Fassade geschieht durch den Vor-
sprung des Sockels, die umlaufenden
Gesimse und durch die geschoßweise
unterschiedlichen Fensterformen und -glie-
derung mit gotisierendem Schmuck. Der
Anbau auf der Ostseite stammt vermutlich
aus der Zeit um 1900, als das Haus als Offi-
zierskasino genutzt wurde. Gotisierende
Details bestimmen auch das Haus Nr. 40
(erbaut 1872, Architekt: Professor Otzen
oder E. Freise), das sich durch die steile
Dachform mit Schieferdeckung unterschei-
det.
is II
Jahnstraße 8-16,1937
Bürgerstraße 50. Architekt Fr. Doeltz, 1860
Bürgerstraße 50a, Architekt Rott, 1895
Bürgerstraße 60, Architekt Rathkamp, 1877/78
Bürgerstraße 40. 1872
76
straße 44; Marienstraße 30/Wiesenstraße
30/32). Diese im Charakter großstädtische
Gruppe aus gelbem und rotem Klinker mit
lebhaft gestalteter Dachzone, hat sich ihre
Geschlossenheit mit Vorgärten und Einfrie-
digungen bewahrt und stellt - vergleichbar
in der Zeit nur mit der Spar- und Bauverein-
Gruppe an der Gartenstraße (s. o. Innen-
stadt) - eine besondere Leistung in derGöt-
tinger Miethausarchitektur dar.
Damit war der Zeitpunkt erreicht, in dem
eine gleichmäßige Aufsiedlung des südli-
chen Stadtteils möglich und notwendig
erschien (vgl. z. B. Lotzestraße, Stegemüh-
lenweg, Schillerstraße usw.). Der Spar- und
Bauverein betrieb die einheitliche
Bebauung der Breymannstraße (1906-
1913), baute die dreiflügelige Anlage am
Brauweg (Nr. 47-57; 1925) und die eben-
falls dreiflügelige Anlage an der Jahnstraße
(Nr. 8-16; 1937). Hinter diesen Planungen
stand das Ideal einer geschlossenen bauli-
chen Konzeption um eine Achse oder um
einen halböffentlichen Raum mit Durchgrü-
nung, das sich auch in der Siedlung auf der
Südseite der Wiesenstraße zwischen
Brauweg 43/Breymannstraße 1,1906
Lilienthalstraße, begonnen 1929
Marien-, Cramer- und Lilienthalstraße
(erbaut ab 1929) durchsetzte. Diese Klinker-
blöcke sind aufgrund ihres Materials eine
Besonderheit in der damals in Göttingen
üblichen Putzarchitektur.
BÜRGERSTRASSE
Mit dem Haus Nr. 52/54 begann 1858 die
Bebauung der östlichen Bürgerstraße mit
Villen und villenähnlichen Gebäuden, die bis
etwa 1895 (Nr. 21) abgeschlossen war. Alle
Häuser hatten Vorgärten, die heute durch
den Ausbau der Bürgerstraße z. T. stark
beschnitten oder zu Parkplätzen umgenutzt
sind. Die frühesten Bauten aus der Zeit vor
dem „Fluchtliniengesetz” stehen in unregel-
mäßigem Abstand zur Straße, während bei
den späteren die Flucht in etwa eingehalten
wird.
Es handelt sich um zweigeschossige Werk-
steinbauten, meist aus Tuffstein mit Sand-
steinsockel und Sandsteingliederung. Den
Baukörper gliedern risalitartige Vorbauten
mit Zwerchgiebel. Alle Häuser haben Walm-
dächer, die relativ flach sind (Ausnahme Nr.
40, erbaut1872) und durch Giebel und Dach-
häuschen (z. T. erneuert) belebt werden.
Manchmal finden sich Balkons - z. B. über
dem mittigen Eingang (Nr. 50) - oder ein
Altan an der Rückseite (Nr. 46).
Nr. 52/54 fällt besonders durch die kubische
Geschlossenheit des Baublocks auf, die
lediglich durch die rückwärtige Terrasse und
das attikageschoßähnliche Dachhaus abge-
schwächt wird. Ursprünglich kaschierten
kielbogenförmige Zinnen die Dachfläche.
Die sparsame Gliederung der symmetri-
schen Fassade geschieht durch den Vor-
sprung des Sockels, die umlaufenden
Gesimse und durch die geschoßweise
unterschiedlichen Fensterformen und -glie-
derung mit gotisierendem Schmuck. Der
Anbau auf der Ostseite stammt vermutlich
aus der Zeit um 1900, als das Haus als Offi-
zierskasino genutzt wurde. Gotisierende
Details bestimmen auch das Haus Nr. 40
(erbaut 1872, Architekt: Professor Otzen
oder E. Freise), das sich durch die steile
Dachform mit Schieferdeckung unterschei-
det.
is II
Jahnstraße 8-16,1937
Bürgerstraße 50. Architekt Fr. Doeltz, 1860
Bürgerstraße 50a, Architekt Rott, 1895
Bürgerstraße 60, Architekt Rathkamp, 1877/78
Bürgerstraße 40. 1872
76