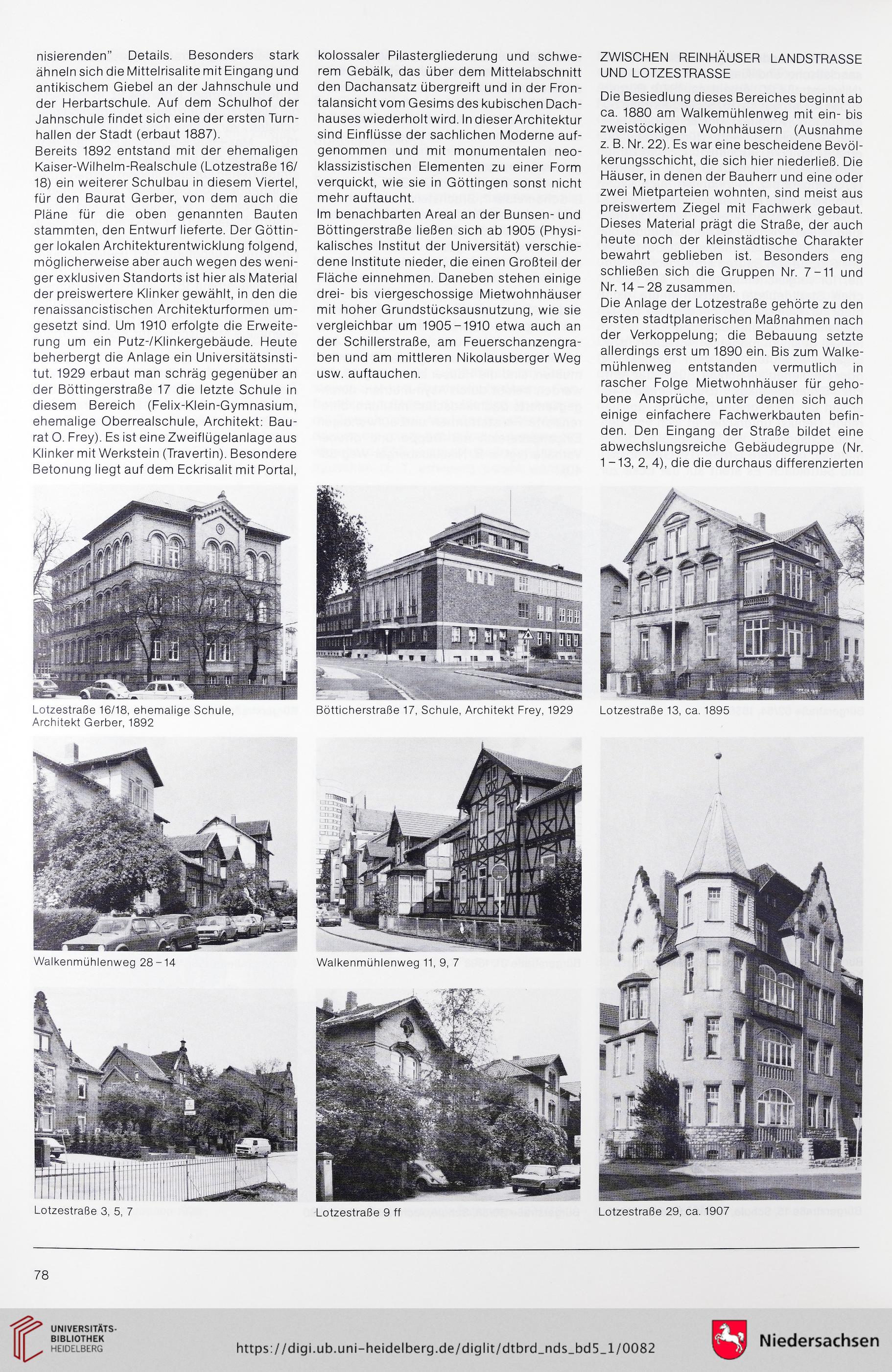nisierenden” Details. Besonders stark
ähneln sich die Mittelrisalite mit Eingang und
antikischem Giebel an der Jahnschule und
der Herbartschule. Auf dem Schulhof der
Jahnschule findet sich eine der ersten Turn-
hallen der Stadt (erbaut 1887).
Bereits 1892 entstand mit der ehemaligen
Kaiser-Wilhelm-Realschule (Lotzestraße 16/
18) ein weiterer Schulbau in diesem Viertel,
für den Baurat Gerber, von dem auch die
Pläne für die oben genannten Bauten
stammten, den Entwurf lieferte. Der Göttin-
ger lokalen Architekturentwicklung folgend,
möglicherweise aber auch wegen des weni-
ger exklusiven Standorts ist hier als Material
der preiswertere Klinker gewählt, in den die
renaissancistischen Architekturformen um-
gesetzt sind. Um 1910 erfolgte die Erweite-
rung um ein Putz-/Klinkergebäude. Heute
beherbergt die Anlage ein Universitätsinsti-
tut. 1929 erbaut man schräg gegenüber an
der Böttingerstraße 17 die letzte Schule in
diesem Bereich (Felix-Klein-Gymnasium,
ehemalige Oberrealschule, Architekt: Bau-
rat O. Frey). Es ist eine Zweiflügelanlage aus
Klinker mit Werkstein (Travertin). Besondere
Betonung liegt auf dem Eckrisalit mit Portal,
kolossaler Pilastergliederung und schwe-
rem Gebälk, das über dem Mittelabschnitt
den Dachansatz übergreift und in der Fron-
talansicht vom Gesims des kubischen Dach-
hauses wiederholt wird. In dieser Architektur
sind Einflüsse der sachlichen Moderne auf-
genommen und mit monumentalen neo-
klassizistischen Elementen zu einer Form
verquickt, wie sie in Göttingen sonst nicht
mehr auftaucht.
Im benachbarten Areal an der Bunsen- und
Böttingerstraße ließen sich ab 1905 (Physi-
kalisches Institut der Universität) verschie-
dene Institute nieder, die einen Großteil der
Fläche einnehmen. Daneben stehen einige
drei- bis viergeschossige Mietwohnhäuser
mit hoher Grundstücksausnutzung, wie sie
vergleichbar um 1905-1910 etwa auch an
der Schillerstraße, am Feuerschanzengra-
ben und am mittleren Nikolausberger Weg
usw. auftauchen.
Lotzestraße 16/18. ehemalige Schule,
Architekt Gerber, 1892
Bötticherstraße 17, Schule, Architekt Frey, 1929
Walkenmühlenweg 28-14
Lotzestraße 3, 5, 7
Walkenmühlenweg 11, 9, 7
Lotzestraße 9 ff
ZWISCHEN REINHÄUSER LANDSTRASSE
UND LOTZESTRASSE
Die Besiedlung dieses Bereiches beginnt ab
ca. 1880 am Walkemühlenweg mit ein- bis
zweistöckigen Wohnhäusern (Ausnahme
z. B. Nr. 22). Es war eine bescheidene Bevöl-
kerungsschicht, die sich hier niederließ. Die
Häuser, in denen der Bauherr und eine oder
zwei Mietparteien wohnten, sind meist aus
preiswertem Ziegel mit Fachwerk gebaut.
Dieses Material prägt die Straße, der auch
heute noch der kleinstädtische Charakter
bewahrt geblieben ist. Besonders eng
schließen sich die Gruppen Nr. 7-11 und
Nr. 14 - 28 zusammen.
Die Anlage der Lotzestraße gehörte zu den
ersten stadtplanerischen Maßnahmen nach
der Verkoppelung; die Bebauung setzte
allerdings erst um 1890 ein. Bis zum Walke-
mühlenweg entstanden vermutlich in
rascher Folge Mietwohnhäuser für geho-
bene Ansprüche, unter denen sich auch
einige einfachere Fachwerkbauten befin-
den. Den Eingang der Straße bildet eine
abwechslungsreiche Gebäudegruppe (Nr.
1 -13, 2, 4), die die durchaus differenzierten
Lotzestraße 13, ca. 1895
9
Lotzestraße 29, ca. 1907
78
ähneln sich die Mittelrisalite mit Eingang und
antikischem Giebel an der Jahnschule und
der Herbartschule. Auf dem Schulhof der
Jahnschule findet sich eine der ersten Turn-
hallen der Stadt (erbaut 1887).
Bereits 1892 entstand mit der ehemaligen
Kaiser-Wilhelm-Realschule (Lotzestraße 16/
18) ein weiterer Schulbau in diesem Viertel,
für den Baurat Gerber, von dem auch die
Pläne für die oben genannten Bauten
stammten, den Entwurf lieferte. Der Göttin-
ger lokalen Architekturentwicklung folgend,
möglicherweise aber auch wegen des weni-
ger exklusiven Standorts ist hier als Material
der preiswertere Klinker gewählt, in den die
renaissancistischen Architekturformen um-
gesetzt sind. Um 1910 erfolgte die Erweite-
rung um ein Putz-/Klinkergebäude. Heute
beherbergt die Anlage ein Universitätsinsti-
tut. 1929 erbaut man schräg gegenüber an
der Böttingerstraße 17 die letzte Schule in
diesem Bereich (Felix-Klein-Gymnasium,
ehemalige Oberrealschule, Architekt: Bau-
rat O. Frey). Es ist eine Zweiflügelanlage aus
Klinker mit Werkstein (Travertin). Besondere
Betonung liegt auf dem Eckrisalit mit Portal,
kolossaler Pilastergliederung und schwe-
rem Gebälk, das über dem Mittelabschnitt
den Dachansatz übergreift und in der Fron-
talansicht vom Gesims des kubischen Dach-
hauses wiederholt wird. In dieser Architektur
sind Einflüsse der sachlichen Moderne auf-
genommen und mit monumentalen neo-
klassizistischen Elementen zu einer Form
verquickt, wie sie in Göttingen sonst nicht
mehr auftaucht.
Im benachbarten Areal an der Bunsen- und
Böttingerstraße ließen sich ab 1905 (Physi-
kalisches Institut der Universität) verschie-
dene Institute nieder, die einen Großteil der
Fläche einnehmen. Daneben stehen einige
drei- bis viergeschossige Mietwohnhäuser
mit hoher Grundstücksausnutzung, wie sie
vergleichbar um 1905-1910 etwa auch an
der Schillerstraße, am Feuerschanzengra-
ben und am mittleren Nikolausberger Weg
usw. auftauchen.
Lotzestraße 16/18. ehemalige Schule,
Architekt Gerber, 1892
Bötticherstraße 17, Schule, Architekt Frey, 1929
Walkenmühlenweg 28-14
Lotzestraße 3, 5, 7
Walkenmühlenweg 11, 9, 7
Lotzestraße 9 ff
ZWISCHEN REINHÄUSER LANDSTRASSE
UND LOTZESTRASSE
Die Besiedlung dieses Bereiches beginnt ab
ca. 1880 am Walkemühlenweg mit ein- bis
zweistöckigen Wohnhäusern (Ausnahme
z. B. Nr. 22). Es war eine bescheidene Bevöl-
kerungsschicht, die sich hier niederließ. Die
Häuser, in denen der Bauherr und eine oder
zwei Mietparteien wohnten, sind meist aus
preiswertem Ziegel mit Fachwerk gebaut.
Dieses Material prägt die Straße, der auch
heute noch der kleinstädtische Charakter
bewahrt geblieben ist. Besonders eng
schließen sich die Gruppen Nr. 7-11 und
Nr. 14 - 28 zusammen.
Die Anlage der Lotzestraße gehörte zu den
ersten stadtplanerischen Maßnahmen nach
der Verkoppelung; die Bebauung setzte
allerdings erst um 1890 ein. Bis zum Walke-
mühlenweg entstanden vermutlich in
rascher Folge Mietwohnhäuser für geho-
bene Ansprüche, unter denen sich auch
einige einfachere Fachwerkbauten befin-
den. Den Eingang der Straße bildet eine
abwechslungsreiche Gebäudegruppe (Nr.
1 -13, 2, 4), die die durchaus differenzierten
Lotzestraße 13, ca. 1895
9
Lotzestraße 29, ca. 1907
78