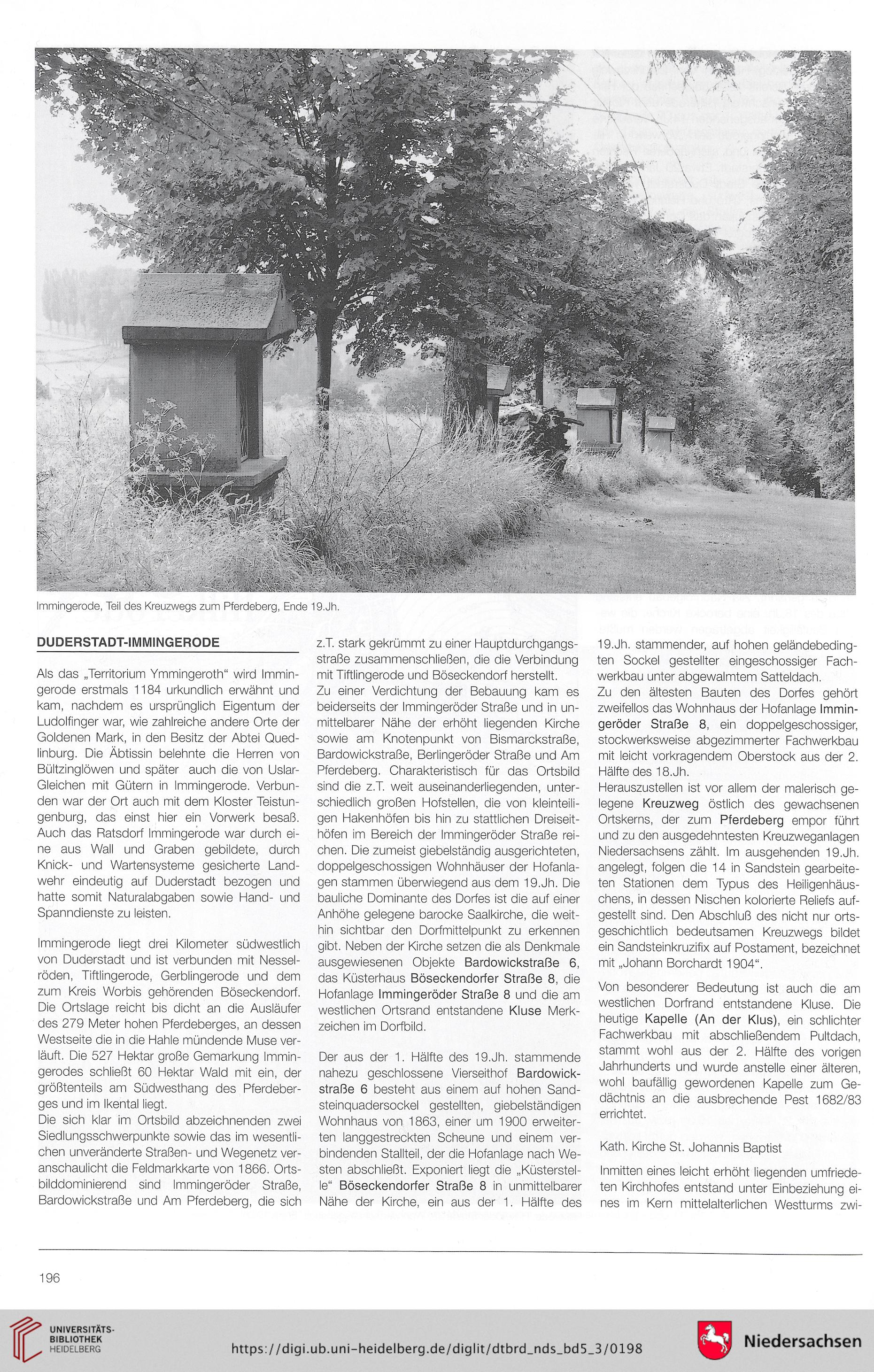Immingerode, Teil des Kreuzwegs zum Pferdeberg, Ende 19.Jh.
DUDERSTADT-IMMINGERODE
Als das „Territorium Ymmingeroth“ wird Immin-
gerode erstmals 1184 urkundlich erwähnt und
kam, nachdem es ursprünglich Eigentum der
Ludolfinger war, wie zahlreiche andere Orte der
Goldenen Mark, in den Besitz der Abtei Qued-
linburg. Die Äbtissin belehnte die Herren von
Bültzinglöwen und später auch die von Uslar-
Gleichen mit Gütern in Immingerode. Verbun-
den war der Ort auch mit dem Kloster Teistun-
genburg, das einst hier ein Vorwerk besaß.
Auch das Ratsdorf Immingerode war durch ei-
ne aus Wall und Graben gebildete, durch
Knick- und Wartensysteme gesicherte Land-
wehr eindeutig auf Duderstadt bezogen und
hatte somit Naturalabgaben sowie Hand- und
Spanndienste zu leisten.
Immingerode liegt drei Kilometer südwestlich
von Duderstadt und ist verbunden mit Nessel-
röden, Tiftlingerode, Gerblingerode und dem
zum Kreis Worbis gehörenden Böseckendorf.
Die Ortslage reicht bis dicht an die Ausläufer
des 279 Meter hohen Pferdeberges, an dessen
Westseite die in die Hahle mündende Muse ver-
läuft. Die 527 Hektar große Gemarkung Immin-
gerodes schließt 60 Hektar Wald mit ein, der
größtenteils am Südwesthang des Pferdeber-
ges und im Ikental liegt.
Die sich klar im Ortsbild abzeichnenden zwei
Siedlungsschwerpunkte sowie das im wesentli-
chen unveränderte Straßen- und Wegenetz ver-
anschaulicht die Feldmarkkarte von 1866. Orts-
bilddominierend sind Immingeröder Straße,
Bardowickstraße und Am Pferdeberg, die sich
z.T. stark gekrümmt zu einer Hauptdurchgangs-
straße zusammenschließen, die die Verbindung
mit Tiftlingerode und Böseckendorf herstellt.
Zu einer Verdichtung der Bebauung kam es
beiderseits der Immingeröder Straße und in un-
mittelbarer Nähe der erhöht liegenden Kirche
sowie am Knotenpunkt von Bismarckstraße,
Bardowickstraße, Berlingeröder Straße und Am
Pferdeberg. Charakteristisch für das Ortsbild
sind die z.T. weit auseinanderliegenden, unter-
schiedlich großen Hofstellen, die von kleinteili-
gen Hakenhöfen bis hin zu stattlichen Dreiseit-
höfen im Bereich der Immingeröder Straße rei-
chen. Die zumeist giebelständig ausgerichteten,
doppelgeschossigen Wohnhäuser der Hofanla-
gen stammen überwiegend aus dem 19.Jh. Die
bauliche Dominante des Dorfes ist die auf einer
Anhöhe gelegene barocke Saalkirche, die weit-
hin sichtbar den Dorfmittelpunkt zu erkennen
gibt. Neben der Kirche setzen die als Denkmale
ausgewiesenen Objekte Bardowickstraße 6,
das Küsterhaus Böseckendorfer Straße 8, die
Hofanlage Immingeröder Straße 8 und die am
westlichen Ortsrand entstandene Kluse Merk-
zeichen im Dorfbild.
Der aus der 1. Hälfte des 19.Jh. stammende
nahezu geschlossene Vierseithof Bardowick-
straße 6 besteht aus einem auf hohen Sand-
steinquadersockel gestellten, giebelständigen
Wohnhaus von 1863, einer um 1900 erweiter-
ten langgestreckten Scheune und einem ver-
bindenden Stallteil, der die Hofanlage nach We-
sten abschließt. Exponiert liegt die „Küsterstel-
le" Böseckendorfer Straße 8 in unmittelbarer
Nähe der Kirche, ein aus der 1. Hälfte des
19.Jh. stammender, auf hohen geländebeding-
ten Sockel gestellter eingeschossiger Fach-
werkbau unter abgewalmtem Satteldach.
Zu den ältesten Bauten des Dorfes gehört
zweifellos das Wohnhaus der Hofanlage Immin-
geröder Straße 8, ein doppelgeschossiger,
stockwerksweise abgezimmerter Fachwerkbau
mit leicht vorkragendem Oberstock aus der 2.
Hälfte des 18.Jh.
Herauszustellen ist vor allem der malerisch ge-
legene Kreuzweg östlich des gewachsenen
Ortskerns, der zum Pferdeberg empor führt
und zu den ausgedehntesten Kreuzweganlagen
Niedersachsens zählt. Im ausgehenden 19.Jh.
angelegt, folgen die 14 in Sandstein gearbeite-
ten Stationen dem Typus des Heiligenhäus-
chens, in dessen Nischen kolorierte Reliefs auf-
gestellt sind. Den Abschluß des nicht nur orts-
geschichtlich bedeutsamen Kreuzwegs bildet
ein Sandsteinkruzifix auf Postament, bezeichnet
mit „Johann Borchardt 1904“.
Von besonderer Bedeutung ist auch die am
westlichen Dorfrand entstandene Kluse. Die
heutige Kapelle (An der Klus), ein schlichter
Fachwerkbau mit abschließendem Pultdach,
stammt wohl aus der 2. Hälfte des vorigen
Jahrhunderts und wurde anstelle einer älteren,
wohl baufällig gewordenen Kapelle zum Ge-
dächtnis an die ausbrechende Pest 1682/83
errichtet.
Kath. Kirche St. Johannis Baptist
Inmitten eines leicht erhöht liegenden umfriede-
ten Kirchhofes entstand unter Einbeziehung ei-
nes im Kern mittelalterlichen Westturms zwi-
196
DUDERSTADT-IMMINGERODE
Als das „Territorium Ymmingeroth“ wird Immin-
gerode erstmals 1184 urkundlich erwähnt und
kam, nachdem es ursprünglich Eigentum der
Ludolfinger war, wie zahlreiche andere Orte der
Goldenen Mark, in den Besitz der Abtei Qued-
linburg. Die Äbtissin belehnte die Herren von
Bültzinglöwen und später auch die von Uslar-
Gleichen mit Gütern in Immingerode. Verbun-
den war der Ort auch mit dem Kloster Teistun-
genburg, das einst hier ein Vorwerk besaß.
Auch das Ratsdorf Immingerode war durch ei-
ne aus Wall und Graben gebildete, durch
Knick- und Wartensysteme gesicherte Land-
wehr eindeutig auf Duderstadt bezogen und
hatte somit Naturalabgaben sowie Hand- und
Spanndienste zu leisten.
Immingerode liegt drei Kilometer südwestlich
von Duderstadt und ist verbunden mit Nessel-
röden, Tiftlingerode, Gerblingerode und dem
zum Kreis Worbis gehörenden Böseckendorf.
Die Ortslage reicht bis dicht an die Ausläufer
des 279 Meter hohen Pferdeberges, an dessen
Westseite die in die Hahle mündende Muse ver-
läuft. Die 527 Hektar große Gemarkung Immin-
gerodes schließt 60 Hektar Wald mit ein, der
größtenteils am Südwesthang des Pferdeber-
ges und im Ikental liegt.
Die sich klar im Ortsbild abzeichnenden zwei
Siedlungsschwerpunkte sowie das im wesentli-
chen unveränderte Straßen- und Wegenetz ver-
anschaulicht die Feldmarkkarte von 1866. Orts-
bilddominierend sind Immingeröder Straße,
Bardowickstraße und Am Pferdeberg, die sich
z.T. stark gekrümmt zu einer Hauptdurchgangs-
straße zusammenschließen, die die Verbindung
mit Tiftlingerode und Böseckendorf herstellt.
Zu einer Verdichtung der Bebauung kam es
beiderseits der Immingeröder Straße und in un-
mittelbarer Nähe der erhöht liegenden Kirche
sowie am Knotenpunkt von Bismarckstraße,
Bardowickstraße, Berlingeröder Straße und Am
Pferdeberg. Charakteristisch für das Ortsbild
sind die z.T. weit auseinanderliegenden, unter-
schiedlich großen Hofstellen, die von kleinteili-
gen Hakenhöfen bis hin zu stattlichen Dreiseit-
höfen im Bereich der Immingeröder Straße rei-
chen. Die zumeist giebelständig ausgerichteten,
doppelgeschossigen Wohnhäuser der Hofanla-
gen stammen überwiegend aus dem 19.Jh. Die
bauliche Dominante des Dorfes ist die auf einer
Anhöhe gelegene barocke Saalkirche, die weit-
hin sichtbar den Dorfmittelpunkt zu erkennen
gibt. Neben der Kirche setzen die als Denkmale
ausgewiesenen Objekte Bardowickstraße 6,
das Küsterhaus Böseckendorfer Straße 8, die
Hofanlage Immingeröder Straße 8 und die am
westlichen Ortsrand entstandene Kluse Merk-
zeichen im Dorfbild.
Der aus der 1. Hälfte des 19.Jh. stammende
nahezu geschlossene Vierseithof Bardowick-
straße 6 besteht aus einem auf hohen Sand-
steinquadersockel gestellten, giebelständigen
Wohnhaus von 1863, einer um 1900 erweiter-
ten langgestreckten Scheune und einem ver-
bindenden Stallteil, der die Hofanlage nach We-
sten abschließt. Exponiert liegt die „Küsterstel-
le" Böseckendorfer Straße 8 in unmittelbarer
Nähe der Kirche, ein aus der 1. Hälfte des
19.Jh. stammender, auf hohen geländebeding-
ten Sockel gestellter eingeschossiger Fach-
werkbau unter abgewalmtem Satteldach.
Zu den ältesten Bauten des Dorfes gehört
zweifellos das Wohnhaus der Hofanlage Immin-
geröder Straße 8, ein doppelgeschossiger,
stockwerksweise abgezimmerter Fachwerkbau
mit leicht vorkragendem Oberstock aus der 2.
Hälfte des 18.Jh.
Herauszustellen ist vor allem der malerisch ge-
legene Kreuzweg östlich des gewachsenen
Ortskerns, der zum Pferdeberg empor führt
und zu den ausgedehntesten Kreuzweganlagen
Niedersachsens zählt. Im ausgehenden 19.Jh.
angelegt, folgen die 14 in Sandstein gearbeite-
ten Stationen dem Typus des Heiligenhäus-
chens, in dessen Nischen kolorierte Reliefs auf-
gestellt sind. Den Abschluß des nicht nur orts-
geschichtlich bedeutsamen Kreuzwegs bildet
ein Sandsteinkruzifix auf Postament, bezeichnet
mit „Johann Borchardt 1904“.
Von besonderer Bedeutung ist auch die am
westlichen Dorfrand entstandene Kluse. Die
heutige Kapelle (An der Klus), ein schlichter
Fachwerkbau mit abschließendem Pultdach,
stammt wohl aus der 2. Hälfte des vorigen
Jahrhunderts und wurde anstelle einer älteren,
wohl baufällig gewordenen Kapelle zum Ge-
dächtnis an die ausbrechende Pest 1682/83
errichtet.
Kath. Kirche St. Johannis Baptist
Inmitten eines leicht erhöht liegenden umfriede-
ten Kirchhofes entstand unter Einbeziehung ei-
nes im Kern mittelalterlichen Westturms zwi-
196