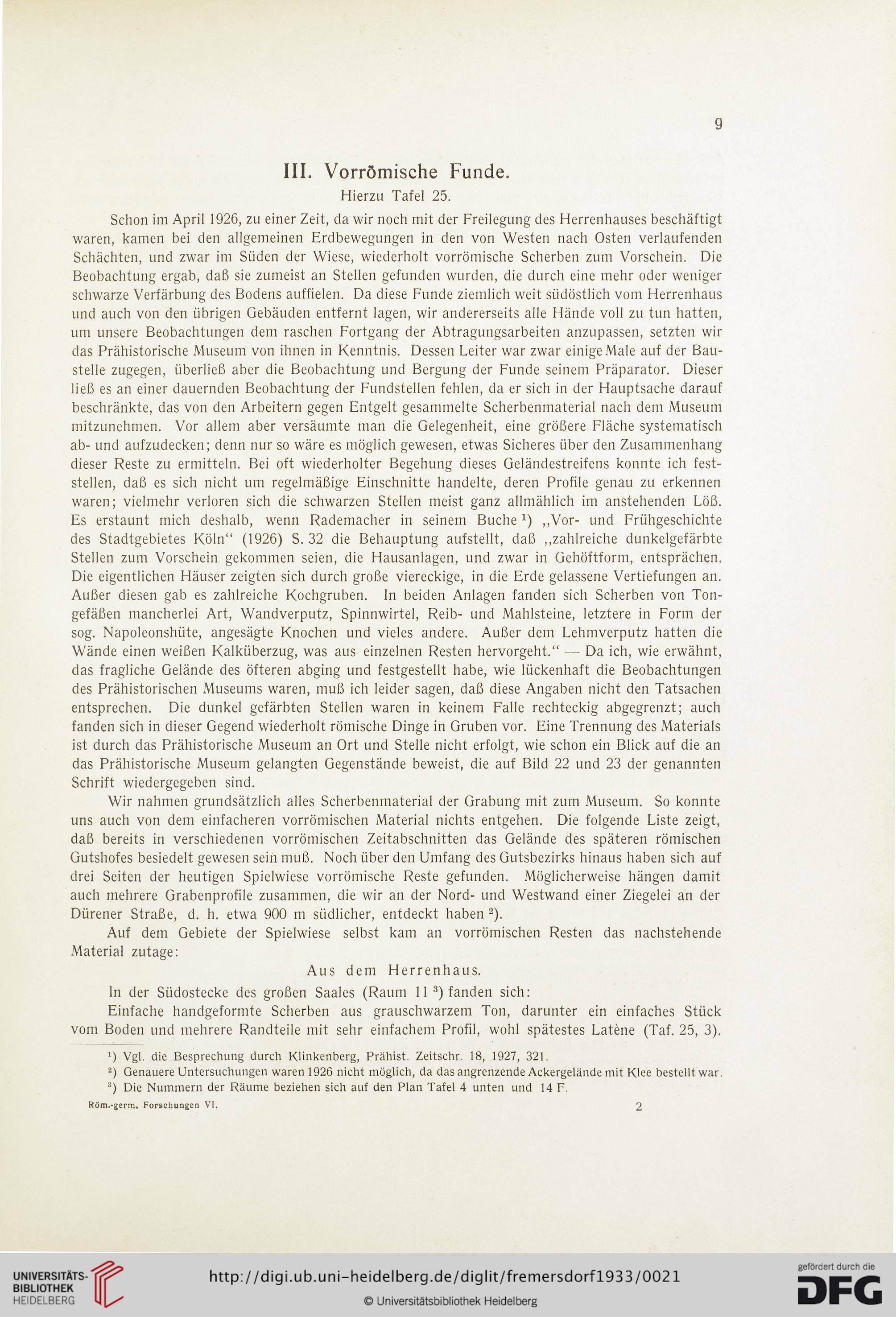9
III. Vorrömische Funde.
Hierzu Tafel 25.
Schon im April 1926, zu einer Zeit, da wir noch mit der Freilegung des Herrenhauses beschäftigt
waren, kamen bei den allgemeinen Erdbewegungen in den von Westen nach Osten verlaufenden
Schächten, und zwar im Süden der Wiese, wiederholt vorrömische Scherben zum Vorschein. Die
Beobachtung ergab, daß sie zumeist an Stellen gefunden wurden, die durch eine mehr oder weniger
schwarze Verfärbung des Bodens auffielen. Da diese Funde ziemlich weit südöstlich vom Herrenhaus
und auch von den übrigen Gebäuden entfernt lagen, wir andererseits alle Hände voll zu tun hatten,
um unsere Beobachtungen dem raschen Fortgang der Abtragungsarbeiten anzupassen, setzten wir
das Prähistorische Museum von ihnen in Kenntnis. Dessen Leiter war zwar einige Male auf der Bau-
stelle zugegen, überließ aber die Beobachtung und Bergung der Funde seinem Präparator. Dieser
ließ es an einer dauernden Beobachtung der Fundstellen fehlen, da er sich in der Hauptsache darauf
beschränkte, das von den Arbeitern gegen Entgelt gesammelte Scherbenmaterial nach dem Museum
mitzunehmen. Vor allem aber versäumte man die Gelegenheit, eine größere Fläche systematisch
ab- und aufzudecken; denn nur so wäre es möglich gewesen, etwas Sicheres über den Zusammenhang
dieser Reste zu ermitteln. Bei oft wiederholter Begehung dieses Geländestreifens konnte ich fest-
stellen, daß es sich nicht um regelmäßige Einschnitte handelte, deren Profile genau zu erkennen
waren; vielmehr verloren sich die schwarzen Stellen meist ganz allmählich im anstehenden Löß.
Es erstaunt mich deshalb, wenn Rademacher in seinem Buchex) ,,Vor- und Frühgeschichte
des Stadtgebietes Köln“ (1926) S. 32 die Behauptung aufstellt, daß „zahlreiche dunkelgefärbte
Stellen zum Vorschein gekommen seien, die Hausanlagen, und zwar in Gehöftform, entsprächen.
Die eigentlichen Häuser zeigten sich durch große viereckige, in die Erde gelassene Vertiefungen an.
Außer diesen gab es zahlreiche Kochgruben. In beiden Anlagen fanden sich Scherben von Ton-
gefäßen mancherlei Art, Wandverputz, Spinnwirtel, Reib- und Mahlsteine, letztere in Form der
sog. Napoleonshüte, angesägte Knochen und vieles andere. Außer dem Lehmverputz hatten die
Wände einen weißen Kalküberzug, was aus einzelnen Resten hervorgeht.“ — Da ich, wie erwähnt,
das fragliche Gelände des öfteren abging und festgestellt habe, wie lückenhaft die Beobachtungen
des Prähistorischen Museums waren, muß ich leider sagen, daß diese Angaben nicht den Tatsachen
entsprechen. Die dunkel gefärbten Stellen waren in keinem Falle rechteckig abgegrenzt; auch
fanden sich in dieser Gegend wiederholt römische Dinge in Gruben vor. Eine Trennung des Materials
ist durch das Prähistorische Museum an Ort und Stelle nicht erfolgt, wie schon ein Blick auf die an
das Prähistorische Museum gelangten Gegenstände beweist, die auf Bild 22 und 23 der genannten
Schrift wiedergegeben sind.
Wir nahmen grundsätzlich alles Scherbenmaterial der Grabung mit zum Museum. So konnte
uns auch von dem einfacheren vorrömischen Material nichts entgehen. Die folgende Liste zeigt,
daß bereits in verschiedenen vorrömischen Zeitabschnitten das Gelände des späteren römischen
Gutshofes besiedelt gewesen sein muß. Noch über den Umfang des Gutsbezirks hinaus haben sich auf
drei Seiten der heutigen Spielwiese vorrömische Reste gefunden. Möglicherweise hängen damit
auch mehrere Grabenprofile zusammen, die wir an der Nord- und Westwand einer Ziegelei an der
Dürener Straße, d. h. etwa 900 m südlicher, entdeckt haben * 2).
Auf dem Gebiete der Spielwiese selbst kam an vorrömischen Resten das nachstehende
Material zutage:
Aus dem Herrenhaus.
In der Südostecke des großen Saales (Raum 11 3) fanden sich:
Einfache handgeformte Scherben aus grauschwarzem Ton, darunter ein einfaches Stück
vom Boden und mehrere Randteile mit sehr einfachem Profil, wohl spätestes Latene (Taf. 25, 3).
0 Vgl. die Besprechung durch Klinkenberg, Prähist. Zeitschr. 18, 1927, 321.
2) Genauere Untersuchungen waren 1926 nicht möglich, da das angrenzende Ackergelände mit Klee bestellt war.
3) Die Nummern der Räume beziehen sich auf den Plan Tafel 4 unten und 14 F.
Röm.-germ. Forschungen VI.
2
III. Vorrömische Funde.
Hierzu Tafel 25.
Schon im April 1926, zu einer Zeit, da wir noch mit der Freilegung des Herrenhauses beschäftigt
waren, kamen bei den allgemeinen Erdbewegungen in den von Westen nach Osten verlaufenden
Schächten, und zwar im Süden der Wiese, wiederholt vorrömische Scherben zum Vorschein. Die
Beobachtung ergab, daß sie zumeist an Stellen gefunden wurden, die durch eine mehr oder weniger
schwarze Verfärbung des Bodens auffielen. Da diese Funde ziemlich weit südöstlich vom Herrenhaus
und auch von den übrigen Gebäuden entfernt lagen, wir andererseits alle Hände voll zu tun hatten,
um unsere Beobachtungen dem raschen Fortgang der Abtragungsarbeiten anzupassen, setzten wir
das Prähistorische Museum von ihnen in Kenntnis. Dessen Leiter war zwar einige Male auf der Bau-
stelle zugegen, überließ aber die Beobachtung und Bergung der Funde seinem Präparator. Dieser
ließ es an einer dauernden Beobachtung der Fundstellen fehlen, da er sich in der Hauptsache darauf
beschränkte, das von den Arbeitern gegen Entgelt gesammelte Scherbenmaterial nach dem Museum
mitzunehmen. Vor allem aber versäumte man die Gelegenheit, eine größere Fläche systematisch
ab- und aufzudecken; denn nur so wäre es möglich gewesen, etwas Sicheres über den Zusammenhang
dieser Reste zu ermitteln. Bei oft wiederholter Begehung dieses Geländestreifens konnte ich fest-
stellen, daß es sich nicht um regelmäßige Einschnitte handelte, deren Profile genau zu erkennen
waren; vielmehr verloren sich die schwarzen Stellen meist ganz allmählich im anstehenden Löß.
Es erstaunt mich deshalb, wenn Rademacher in seinem Buchex) ,,Vor- und Frühgeschichte
des Stadtgebietes Köln“ (1926) S. 32 die Behauptung aufstellt, daß „zahlreiche dunkelgefärbte
Stellen zum Vorschein gekommen seien, die Hausanlagen, und zwar in Gehöftform, entsprächen.
Die eigentlichen Häuser zeigten sich durch große viereckige, in die Erde gelassene Vertiefungen an.
Außer diesen gab es zahlreiche Kochgruben. In beiden Anlagen fanden sich Scherben von Ton-
gefäßen mancherlei Art, Wandverputz, Spinnwirtel, Reib- und Mahlsteine, letztere in Form der
sog. Napoleonshüte, angesägte Knochen und vieles andere. Außer dem Lehmverputz hatten die
Wände einen weißen Kalküberzug, was aus einzelnen Resten hervorgeht.“ — Da ich, wie erwähnt,
das fragliche Gelände des öfteren abging und festgestellt habe, wie lückenhaft die Beobachtungen
des Prähistorischen Museums waren, muß ich leider sagen, daß diese Angaben nicht den Tatsachen
entsprechen. Die dunkel gefärbten Stellen waren in keinem Falle rechteckig abgegrenzt; auch
fanden sich in dieser Gegend wiederholt römische Dinge in Gruben vor. Eine Trennung des Materials
ist durch das Prähistorische Museum an Ort und Stelle nicht erfolgt, wie schon ein Blick auf die an
das Prähistorische Museum gelangten Gegenstände beweist, die auf Bild 22 und 23 der genannten
Schrift wiedergegeben sind.
Wir nahmen grundsätzlich alles Scherbenmaterial der Grabung mit zum Museum. So konnte
uns auch von dem einfacheren vorrömischen Material nichts entgehen. Die folgende Liste zeigt,
daß bereits in verschiedenen vorrömischen Zeitabschnitten das Gelände des späteren römischen
Gutshofes besiedelt gewesen sein muß. Noch über den Umfang des Gutsbezirks hinaus haben sich auf
drei Seiten der heutigen Spielwiese vorrömische Reste gefunden. Möglicherweise hängen damit
auch mehrere Grabenprofile zusammen, die wir an der Nord- und Westwand einer Ziegelei an der
Dürener Straße, d. h. etwa 900 m südlicher, entdeckt haben * 2).
Auf dem Gebiete der Spielwiese selbst kam an vorrömischen Resten das nachstehende
Material zutage:
Aus dem Herrenhaus.
In der Südostecke des großen Saales (Raum 11 3) fanden sich:
Einfache handgeformte Scherben aus grauschwarzem Ton, darunter ein einfaches Stück
vom Boden und mehrere Randteile mit sehr einfachem Profil, wohl spätestes Latene (Taf. 25, 3).
0 Vgl. die Besprechung durch Klinkenberg, Prähist. Zeitschr. 18, 1927, 321.
2) Genauere Untersuchungen waren 1926 nicht möglich, da das angrenzende Ackergelände mit Klee bestellt war.
3) Die Nummern der Räume beziehen sich auf den Plan Tafel 4 unten und 14 F.
Röm.-germ. Forschungen VI.
2