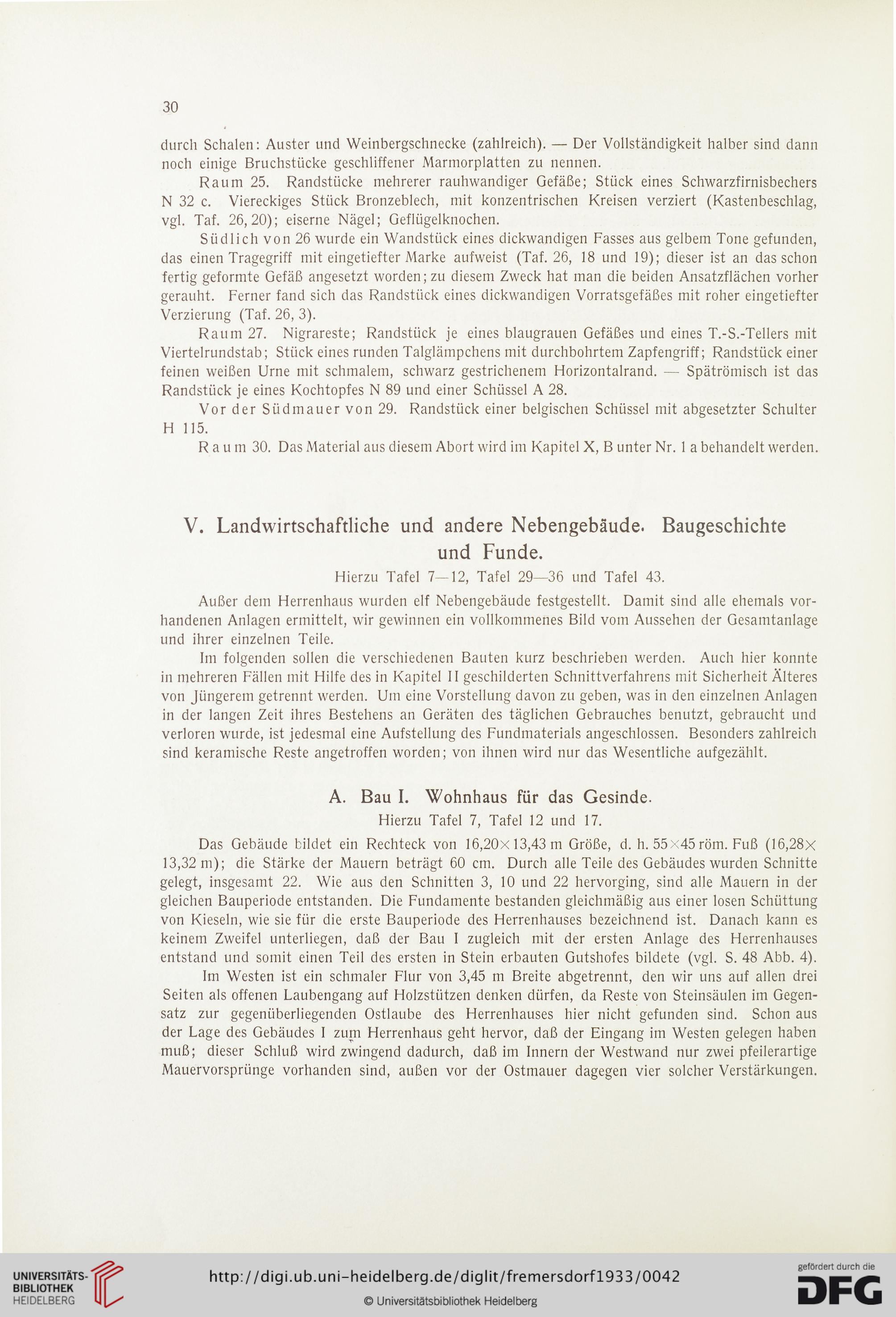30
durch Schalen: Auster und Weinbergschnecke (zahlreich). — Der Vollständigkeit halber sind dann
noch einige Bruchstücke geschliffener Marmorplatten zu nennen.
Raum 25. Randstücke mehrerer rauhwandiger Gefäße; Stück eines Schwarzfirnisbechers
N 32 c. Viereckiges Stück Bronzeblech, mit konzentrischen Kreisen verziert (Kastenbeschlag,
vgl. Taf. 26,20); eiserne Nägel; Geflügelknochen.
Südlich von 26 wurde ein Wandstück eines dickwandigen Fasses aus gelbem Tone gefunden,
das einen Tragegriff mit eingetiefter Marke aufweist (Taf. 26, 18 und 19); dieser ist an das schon
fertig geformte Gefäß angesetzt worden; zu diesem Zweck hat man die beiden Ansatzflächen vorher
gerauht. Ferner fand sich das Randstück eines dickwandigen Vorratsgefäßes mit roher eingetiefter
Verzierung (Taf. 26, 3).
Raum 27. Nigrareste; Randstück je eines blaugrauen Gefäßes und eines T.-S.-Tellers mit
Viertelrundstab; Stück eines runden Talglämpchens mit durchbohrtem Zapfengriff; Randstück einer
feinen weißen Urne mit schmalem, schwarz gestrichenem Horizontalrand. — Spätrömisch ist das
Randstück je eines Kochtopfes N 89 und einer Schüssel A 28.
Vor der Südmauer von 29. Randstück einer belgischen Schüssel mit abgesetzter Schulter
H 115.
Rau m 30. Das Material aus diesem Abort wird im Kapitel X, B unter Nr. 1 a behandelt werden.
V. Landwirtschaftliche und andere Nebengebäude. Baugeschichte
und Funde.
Hierzu Tafel 7-12, Tafel 29—36 und Tafel 43.
Außer dem Herrenhaus wurden elf Nebengebäude festgestellt. Damit sind alle ehemals vor-
handenen Anlagen ermittelt, wir gewinnen ein vollkommenes Bild vom Aussehen der Gesamtanlage
und ihrer einzelnen Teile.
Im folgenden sollen die verschiedenen Bauten kurz beschrieben werden. Auch hier konnte
in mehreren Fällen mit Hilfe des in Kapitel II geschilderten Schnittverfahrens mit Sicherheit Älteres
von Jüngerem getrennt werden. Um eine Vorstellung davon zu geben, was in den einzelnen Anlagen
in der langen Zeit ihres Bestehens an Geräten des täglichen Gebrauches benutzt, gebraucht und
verloren wurde, ist jedesmal eine Aufstellung des Fundmaterials angeschlossen. Besonders zahlreich
sind keramische Reste angetroffen worden; von ihnen wird nur das Wesentliche aufgezählt.
A. Bau I. Wohnhaus für das Gesinde.
Hierzu Tafel 7, Tafel 12 und 17.
Das Gebäude bildet ein Rechteck von 16,20x 13,43 m Größe, d. h. 55x45 röm. Fuß (16,28x
13,32 m); die Stärke der Mauern beträgt 60 cm. Durch alle Teile des Gebäudes wurden Schnitte
gelegt, insgesamt 22. Wie aus den Schnitten 3, 10 und 22 hervorging, sind alle Mauern in der
gleichen Bauperiode entstanden. Die Fundamente bestanden gleichmäßig aus einer losen Schüttung
von Kieseln, wie sie für die erste Bauperiode des Herrenhauses bezeichnend ist. Danach kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß der Bau I zugleich mit der ersten Anlage des Herrenhauses
entstand und somit einen Teil des ersten in Stein erbauten Gutshofes bildete (vgl. S. 48 Abb. 4).
Im Westen ist ein schmaler Flur von 3,45 m Breite abgetrennt, den wir uns auf allen drei
Seiten als offenen Laubengang auf Holzstützen denken dürfen, da Reste von Steinsäulen im Gegen-
satz zur gegenüberliegenden Ostlaube des Herrenhauses hier nicht gefunden sind. Schon aus
der Lage des Gebäudes I zun: Herrenhaus geht hervor, daß der Eingang im Westen gelegen haben
muß; dieser Schluß wird zwingend dadurch, daß im Innern der Westwand nur zwei pfeilerartige
Mauervorsprünge vorhanden sind, außen vor der Ostmauer dagegen vier solcher Verstärkungen.
durch Schalen: Auster und Weinbergschnecke (zahlreich). — Der Vollständigkeit halber sind dann
noch einige Bruchstücke geschliffener Marmorplatten zu nennen.
Raum 25. Randstücke mehrerer rauhwandiger Gefäße; Stück eines Schwarzfirnisbechers
N 32 c. Viereckiges Stück Bronzeblech, mit konzentrischen Kreisen verziert (Kastenbeschlag,
vgl. Taf. 26,20); eiserne Nägel; Geflügelknochen.
Südlich von 26 wurde ein Wandstück eines dickwandigen Fasses aus gelbem Tone gefunden,
das einen Tragegriff mit eingetiefter Marke aufweist (Taf. 26, 18 und 19); dieser ist an das schon
fertig geformte Gefäß angesetzt worden; zu diesem Zweck hat man die beiden Ansatzflächen vorher
gerauht. Ferner fand sich das Randstück eines dickwandigen Vorratsgefäßes mit roher eingetiefter
Verzierung (Taf. 26, 3).
Raum 27. Nigrareste; Randstück je eines blaugrauen Gefäßes und eines T.-S.-Tellers mit
Viertelrundstab; Stück eines runden Talglämpchens mit durchbohrtem Zapfengriff; Randstück einer
feinen weißen Urne mit schmalem, schwarz gestrichenem Horizontalrand. — Spätrömisch ist das
Randstück je eines Kochtopfes N 89 und einer Schüssel A 28.
Vor der Südmauer von 29. Randstück einer belgischen Schüssel mit abgesetzter Schulter
H 115.
Rau m 30. Das Material aus diesem Abort wird im Kapitel X, B unter Nr. 1 a behandelt werden.
V. Landwirtschaftliche und andere Nebengebäude. Baugeschichte
und Funde.
Hierzu Tafel 7-12, Tafel 29—36 und Tafel 43.
Außer dem Herrenhaus wurden elf Nebengebäude festgestellt. Damit sind alle ehemals vor-
handenen Anlagen ermittelt, wir gewinnen ein vollkommenes Bild vom Aussehen der Gesamtanlage
und ihrer einzelnen Teile.
Im folgenden sollen die verschiedenen Bauten kurz beschrieben werden. Auch hier konnte
in mehreren Fällen mit Hilfe des in Kapitel II geschilderten Schnittverfahrens mit Sicherheit Älteres
von Jüngerem getrennt werden. Um eine Vorstellung davon zu geben, was in den einzelnen Anlagen
in der langen Zeit ihres Bestehens an Geräten des täglichen Gebrauches benutzt, gebraucht und
verloren wurde, ist jedesmal eine Aufstellung des Fundmaterials angeschlossen. Besonders zahlreich
sind keramische Reste angetroffen worden; von ihnen wird nur das Wesentliche aufgezählt.
A. Bau I. Wohnhaus für das Gesinde.
Hierzu Tafel 7, Tafel 12 und 17.
Das Gebäude bildet ein Rechteck von 16,20x 13,43 m Größe, d. h. 55x45 röm. Fuß (16,28x
13,32 m); die Stärke der Mauern beträgt 60 cm. Durch alle Teile des Gebäudes wurden Schnitte
gelegt, insgesamt 22. Wie aus den Schnitten 3, 10 und 22 hervorging, sind alle Mauern in der
gleichen Bauperiode entstanden. Die Fundamente bestanden gleichmäßig aus einer losen Schüttung
von Kieseln, wie sie für die erste Bauperiode des Herrenhauses bezeichnend ist. Danach kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß der Bau I zugleich mit der ersten Anlage des Herrenhauses
entstand und somit einen Teil des ersten in Stein erbauten Gutshofes bildete (vgl. S. 48 Abb. 4).
Im Westen ist ein schmaler Flur von 3,45 m Breite abgetrennt, den wir uns auf allen drei
Seiten als offenen Laubengang auf Holzstützen denken dürfen, da Reste von Steinsäulen im Gegen-
satz zur gegenüberliegenden Ostlaube des Herrenhauses hier nicht gefunden sind. Schon aus
der Lage des Gebäudes I zun: Herrenhaus geht hervor, daß der Eingang im Westen gelegen haben
muß; dieser Schluß wird zwingend dadurch, daß im Innern der Westwand nur zwei pfeilerartige
Mauervorsprünge vorhanden sind, außen vor der Ostmauer dagegen vier solcher Verstärkungen.