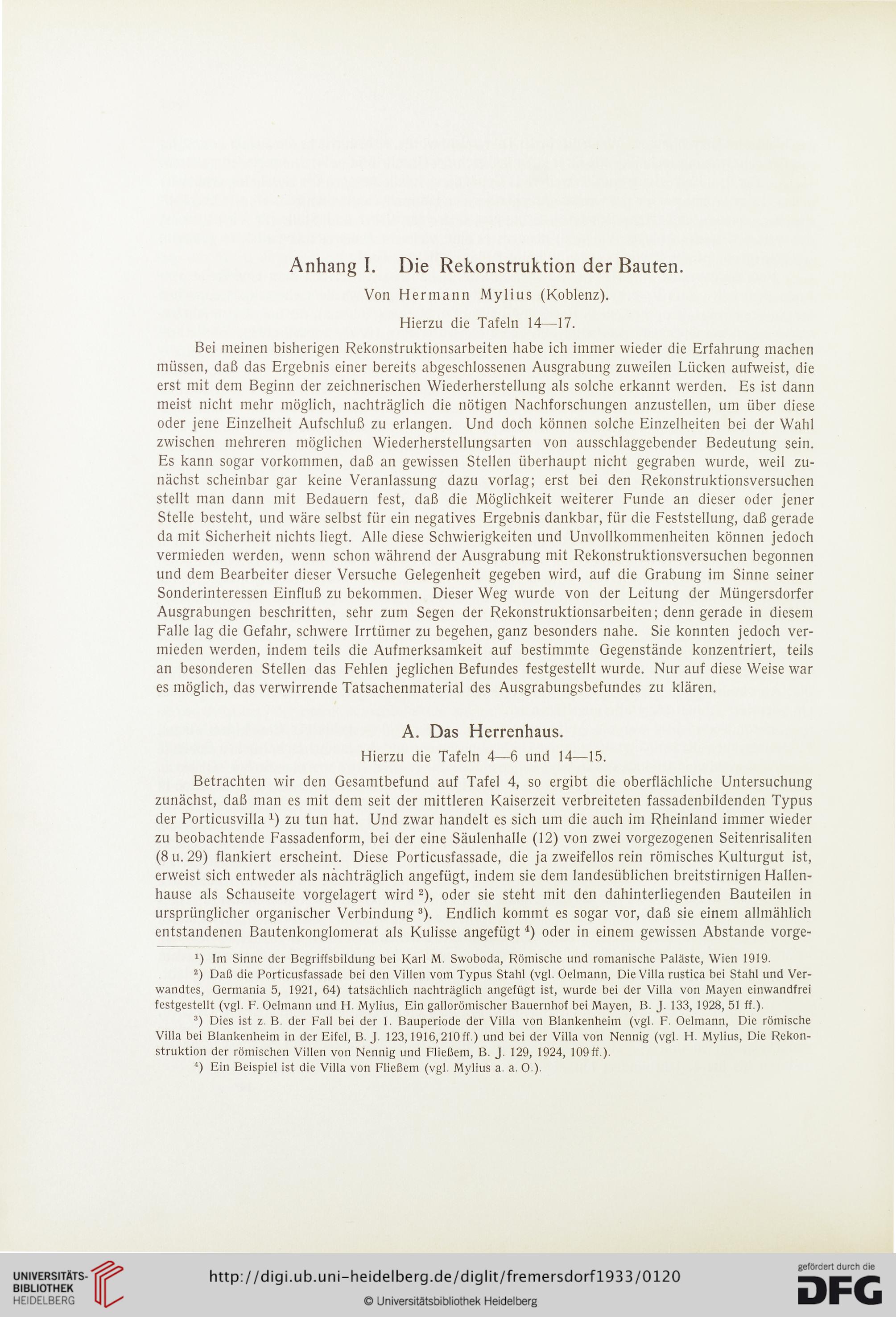Anhang I. Die Rekonstruktion der Bauten.
Von Hermann Mylius (Koblenz).
Hierzu die Tafeln 14—17.
Bei meinen bisherigen Rekonstruktionsarbeiten habe ich immer wieder die Erfahrung machen
müssen, daß das Ergebnis einer bereits abgeschlossenen Ausgrabung zuweilen Lücken aufweist, die
erst mit dem Beginn der zeichnerischen Wiederherstellung als solche erkannt werden. Es ist dann
meist nicht mehr möglich, nachträglich die nötigen Nachforschungen anzustellen, um über diese
oder jene Einzelheit Aufschluß zu erlangen. Und doch können solche Einzelheiten bei der Wahl
zwischen mehreren möglichen Wiederherstellungsarten von ausschlaggebender Bedeutung sein.
Es kann sogar Vorkommen, daß an gewissen Stellen überhaupt nicht gegraben wurde, weil zu-
nächst scheinbar gar keine Veranlassung dazu vorlag; erst bei den Rekonstruktionsversuchen
stellt man dann mit Bedauern fest, daß die Möglichkeit weiterer Funde an dieser oder jener
Stelle besteht, und wäre selbst für ein negatives Ergebnis dankbar, für die Feststellung, daß gerade
da mit Sicherheit nichts liegt. Alle diese Schwierigkeiten und Unvollkommenheiten können jedoch
vermieden werden, wenn schon während der Ausgrabung mit Rekonstruktionsversuchen begonnen
und dem Bearbeiter dieser Versuche Gelegenheit gegeben wird, auf die Grabung im Sinne seiner
Sonderinteressen Einfluß zu bekommen. Dieser Weg wurde von der Leitung der Müngersdorfer
Ausgrabungen beschritten, sehr zum Segen der Rekonstruktionsarbeiten; denn gerade in diesem
Falle lag die Gefahr, schwere Irrtümer zu begehen, ganz besonders nahe. Sie konnten jedoch ver-
mieden werden, indem teils die Aufmerksamkeit auf bestimmte Gegenstände konzentriert, teils
an besonderen Stellen das Fehlen jeglichen Befundes festgestellt wurde. Nur auf diese Weise war
es möglich, das verwirrende Tatsachenmaterial des Ausgrabungsbefundes zu klären.
A. Das Herrenhaus.
Hierzu die Tafeln 4—6 und 14—15.
Betrachten wir den Gesamtbefund auf Tafel 4, so ergibt die oberflächliche Untersuchung
zunächst, daß man es mit dem seit der mittleren Kaiserzeit verbreiteten fassadenbildenden Typus
der Porticusvilla 1) zu tun hat. Und zwar handelt es sich um die auch im Rheinland immer wieder
zu beobachtende Fassadenform, bei der eine Säulenhalle (12) von zwei vorgezogenen Seitenrisaliten
(8 u. 29) flankiert erscheint. Diese Porticusfassade, die ja zweifellos rein römisches Kulturgut ist,
erweist sich entweder als nachträglich angefügt, indem sie dem landesüblichen breitstirnigen Hallen-
hause als Schauseite vorgelagert wird 2), oder sie steht mit den dahinterliegenden Bauteilen in
ursprünglicher organischer Verbindung 3). Endlich kommt es sogar vor, daß sie einem allmählich
entstandenen Bautenkonglomerat als Kulisse angefügt4) oder in einem gewissen Abstande vorge-
1) Im Sinne der Begriffsbildung bei Karl M. Swoboda, Römische und romanische Paläste, Wien 1919.
2) Daß die Porticusfassade bei den Villen vom Typus Stahl (vgl. Oelmann, Die Villa rustica bei Stahl und Ver-
wandtes, Germania 5, 1921, 64) tatsächlich nachträglich angefügt ist, wurde bei der Villa von Mayen einwandfrei
festgestellt (vgl. F. Oelmann und H. Mylius, Ein gallorömischer Bauernhof bei Mayen, B. J. 133, 1928, 51 ff.).
3) Dies ist z. B. der Fall bei der 1. Bauperiode der Villa von Blankenheim (vgl. F. Oelmann, Die römische
Villa bei Blankenheim in der Eifel, B. J. 123,1916,210ff.) und bei der Villa von Nennig (vgl. H. Mylius, Die Rekon-
struktion der römischen Villen von Nennig und Fließem, B. J. 129, 1924, 109ff.).
4) Ein Beispiel ist die Villa von Fließem (vgl. Mylius a. a. 0.).
Von Hermann Mylius (Koblenz).
Hierzu die Tafeln 14—17.
Bei meinen bisherigen Rekonstruktionsarbeiten habe ich immer wieder die Erfahrung machen
müssen, daß das Ergebnis einer bereits abgeschlossenen Ausgrabung zuweilen Lücken aufweist, die
erst mit dem Beginn der zeichnerischen Wiederherstellung als solche erkannt werden. Es ist dann
meist nicht mehr möglich, nachträglich die nötigen Nachforschungen anzustellen, um über diese
oder jene Einzelheit Aufschluß zu erlangen. Und doch können solche Einzelheiten bei der Wahl
zwischen mehreren möglichen Wiederherstellungsarten von ausschlaggebender Bedeutung sein.
Es kann sogar Vorkommen, daß an gewissen Stellen überhaupt nicht gegraben wurde, weil zu-
nächst scheinbar gar keine Veranlassung dazu vorlag; erst bei den Rekonstruktionsversuchen
stellt man dann mit Bedauern fest, daß die Möglichkeit weiterer Funde an dieser oder jener
Stelle besteht, und wäre selbst für ein negatives Ergebnis dankbar, für die Feststellung, daß gerade
da mit Sicherheit nichts liegt. Alle diese Schwierigkeiten und Unvollkommenheiten können jedoch
vermieden werden, wenn schon während der Ausgrabung mit Rekonstruktionsversuchen begonnen
und dem Bearbeiter dieser Versuche Gelegenheit gegeben wird, auf die Grabung im Sinne seiner
Sonderinteressen Einfluß zu bekommen. Dieser Weg wurde von der Leitung der Müngersdorfer
Ausgrabungen beschritten, sehr zum Segen der Rekonstruktionsarbeiten; denn gerade in diesem
Falle lag die Gefahr, schwere Irrtümer zu begehen, ganz besonders nahe. Sie konnten jedoch ver-
mieden werden, indem teils die Aufmerksamkeit auf bestimmte Gegenstände konzentriert, teils
an besonderen Stellen das Fehlen jeglichen Befundes festgestellt wurde. Nur auf diese Weise war
es möglich, das verwirrende Tatsachenmaterial des Ausgrabungsbefundes zu klären.
A. Das Herrenhaus.
Hierzu die Tafeln 4—6 und 14—15.
Betrachten wir den Gesamtbefund auf Tafel 4, so ergibt die oberflächliche Untersuchung
zunächst, daß man es mit dem seit der mittleren Kaiserzeit verbreiteten fassadenbildenden Typus
der Porticusvilla 1) zu tun hat. Und zwar handelt es sich um die auch im Rheinland immer wieder
zu beobachtende Fassadenform, bei der eine Säulenhalle (12) von zwei vorgezogenen Seitenrisaliten
(8 u. 29) flankiert erscheint. Diese Porticusfassade, die ja zweifellos rein römisches Kulturgut ist,
erweist sich entweder als nachträglich angefügt, indem sie dem landesüblichen breitstirnigen Hallen-
hause als Schauseite vorgelagert wird 2), oder sie steht mit den dahinterliegenden Bauteilen in
ursprünglicher organischer Verbindung 3). Endlich kommt es sogar vor, daß sie einem allmählich
entstandenen Bautenkonglomerat als Kulisse angefügt4) oder in einem gewissen Abstande vorge-
1) Im Sinne der Begriffsbildung bei Karl M. Swoboda, Römische und romanische Paläste, Wien 1919.
2) Daß die Porticusfassade bei den Villen vom Typus Stahl (vgl. Oelmann, Die Villa rustica bei Stahl und Ver-
wandtes, Germania 5, 1921, 64) tatsächlich nachträglich angefügt ist, wurde bei der Villa von Mayen einwandfrei
festgestellt (vgl. F. Oelmann und H. Mylius, Ein gallorömischer Bauernhof bei Mayen, B. J. 133, 1928, 51 ff.).
3) Dies ist z. B. der Fall bei der 1. Bauperiode der Villa von Blankenheim (vgl. F. Oelmann, Die römische
Villa bei Blankenheim in der Eifel, B. J. 123,1916,210ff.) und bei der Villa von Nennig (vgl. H. Mylius, Die Rekon-
struktion der römischen Villen von Nennig und Fließem, B. J. 129, 1924, 109ff.).
4) Ein Beispiel ist die Villa von Fließem (vgl. Mylius a. a. 0.).