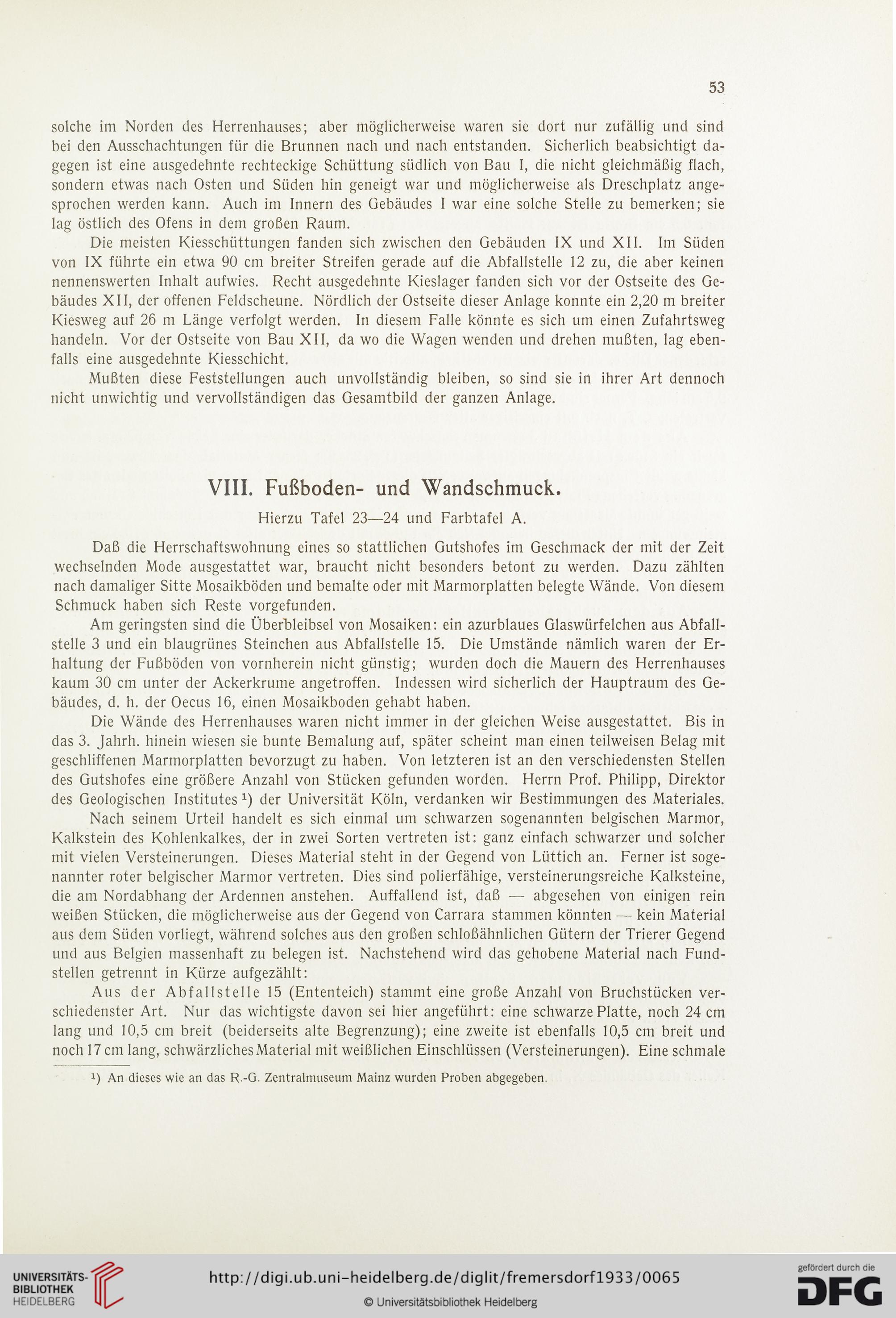53
solche im Norden des Herrenhauses; aber möglicherweise waren sie dort nur zufällig und sind
bei den Ausschachtungen für die Brunnen nach und nach entstanden. Sicherlich beabsichtigt da-
gegen ist eine ausgedehnte rechteckige Schüttung südlich von Bau I, die nicht gleichmäßig flach,
sondern etwas nach Osten und Süden hin geneigt war und möglicherweise als Dreschplatz ange-
sprochen werden kann. Auch im Innern des Gebäudes I war eine solche Stelle zu bemerken; sie
lag östlich des Ofens in dem großen Raum.
Die meisten Kiesschüttungen fanden sich zwischen den Gebäuden IX und XII. Im Süden
von IX führte ein etwa 90 cm breiter Streifen gerade auf die Abfallstelle 12 zu, die aber keinen
nennenswerten Inhalt aufwies. Recht ausgedehnte Kieslager fanden sich vor der Ostseite des Ge-
bäudes XII, der offenen Feldscheune. Nördlich der Ostseite dieser Anlage konnte ein 2,20 m breiter
Kiesweg auf 26 m Länge verfolgt werden. In diesem Falle könnte es sich um einen Zufahrtsweg
handeln. Vor der Ostseite von Bau XII, da wo die Wagen wenden und drehen mußten, lag eben-
falls eine ausgedehnte Kiesschicht.
Mußten diese Feststellungen auch unvollständig bleiben, so sind sie in ihrer Art dennoch
nicht unwichtig und vervollständigen das Gesamtbild der ganzen Anlage.
VIII. Fußboden- und Wandschmuck.
Hierzu Tafel 23—24 und Farbtafel A.
Daß die Herrschaftswohnung eines so stattlichen Gutshofes im Geschmack der mit der Zeit
wechselnden Mode ausgestattet war, braucht nicht besonders betont zu werden. Dazu zählten
nach damaliger Sitte Mosaikböden und bemalte oder mit Marmorplatten belegte Wände. Von diesem
Schmuck haben sich Reste vorgefunden.
Am geringsten sind die Überbleibsel von Mosaiken: ein azurblaues Glaswürfelchen aus Abfall-
stelle 3 und ein blaugrünes Steinchen aus Abfallstelle 15. Die Umstände nämlich waren der Er-
haltung der Fußböden von vornherein nicht günstig; wurden doch die Mauern des Herrenhauses
kaum 30 cm unter der Ackerkrume angetroffen. Indessen wird sicherlich der Hauptraum des Ge-
bäudes, d. h. der Oecus 16, einen Mosaikboden gehabt haben.
Die Wände des Herrenhauses waren nicht immer in der gleichen Weise ausgestattet. Bis in
das 3. Jahrh. hinein wiesen sie bunte Bemalung auf, später scheint man einen teilweisen Belag mit
geschliffenen Marmorplatten bevorzugt zu haben. Von letzteren ist an den verschiedensten Stellen
des Gutshofes eine größere Anzahl von Stücken gefunden worden. Herrn Prof. Philipp, Direktor
des Geologischen Institutes *) der Universität Köln, verdanken wir Bestimmungen des Materiales.
Nach seinem Urteil handelt es sich einmal um schwarzen sogenannten belgischen Marmor,
Kalkstein des Kohlenkalkes, der in zwei Sorten vertreten ist: ganz einfach schwarzer und solcher
mit vielen Versteinerungen. Dieses Material steht in der Gegend von Lüttich an. Ferner ist soge-
nannter roter belgischer Marmor vertreten. Dies sind polierfähige, versteinerungsreiche Kalksteine,
die am Nordabhang der Ardennen anstehen. Auffallend ist, daß — abgesehen von einigen rein
weißen Stücken, die möglicherweise aus der Gegend von Carrara stammen könnten — kein Material
aus dem Süden vorliegt, während solches aus den großen schloßähnlichen Gütern der Trierer Gegend
und aus Belgien massenhaft zu belegen ist. Nachstehend wird das gehobene Material nach Fund-
stellen getrennt in Kürze aufgezählt:
Aus der Abfallstelle 15 (Ententeich) stammt eine große Anzahl von Bruchstücken ver-
schiedenster Art. Nur das wichtigste davon sei hier angeführt: eine schwarze Platte, noch 24 cm
lang und 10,5 cm breit (beiderseits alte Begrenzung); eine zweite ist ebenfalls 10,5 cm breit und
noch 17 cm lang, schwärzliches Material mit weißlichen Einschlüssen (Versteinerungen). Eine schmale
x) An dieses wie an das R.-G. Zentralmuseum Mainz wurden Proben abgegeben.
solche im Norden des Herrenhauses; aber möglicherweise waren sie dort nur zufällig und sind
bei den Ausschachtungen für die Brunnen nach und nach entstanden. Sicherlich beabsichtigt da-
gegen ist eine ausgedehnte rechteckige Schüttung südlich von Bau I, die nicht gleichmäßig flach,
sondern etwas nach Osten und Süden hin geneigt war und möglicherweise als Dreschplatz ange-
sprochen werden kann. Auch im Innern des Gebäudes I war eine solche Stelle zu bemerken; sie
lag östlich des Ofens in dem großen Raum.
Die meisten Kiesschüttungen fanden sich zwischen den Gebäuden IX und XII. Im Süden
von IX führte ein etwa 90 cm breiter Streifen gerade auf die Abfallstelle 12 zu, die aber keinen
nennenswerten Inhalt aufwies. Recht ausgedehnte Kieslager fanden sich vor der Ostseite des Ge-
bäudes XII, der offenen Feldscheune. Nördlich der Ostseite dieser Anlage konnte ein 2,20 m breiter
Kiesweg auf 26 m Länge verfolgt werden. In diesem Falle könnte es sich um einen Zufahrtsweg
handeln. Vor der Ostseite von Bau XII, da wo die Wagen wenden und drehen mußten, lag eben-
falls eine ausgedehnte Kiesschicht.
Mußten diese Feststellungen auch unvollständig bleiben, so sind sie in ihrer Art dennoch
nicht unwichtig und vervollständigen das Gesamtbild der ganzen Anlage.
VIII. Fußboden- und Wandschmuck.
Hierzu Tafel 23—24 und Farbtafel A.
Daß die Herrschaftswohnung eines so stattlichen Gutshofes im Geschmack der mit der Zeit
wechselnden Mode ausgestattet war, braucht nicht besonders betont zu werden. Dazu zählten
nach damaliger Sitte Mosaikböden und bemalte oder mit Marmorplatten belegte Wände. Von diesem
Schmuck haben sich Reste vorgefunden.
Am geringsten sind die Überbleibsel von Mosaiken: ein azurblaues Glaswürfelchen aus Abfall-
stelle 3 und ein blaugrünes Steinchen aus Abfallstelle 15. Die Umstände nämlich waren der Er-
haltung der Fußböden von vornherein nicht günstig; wurden doch die Mauern des Herrenhauses
kaum 30 cm unter der Ackerkrume angetroffen. Indessen wird sicherlich der Hauptraum des Ge-
bäudes, d. h. der Oecus 16, einen Mosaikboden gehabt haben.
Die Wände des Herrenhauses waren nicht immer in der gleichen Weise ausgestattet. Bis in
das 3. Jahrh. hinein wiesen sie bunte Bemalung auf, später scheint man einen teilweisen Belag mit
geschliffenen Marmorplatten bevorzugt zu haben. Von letzteren ist an den verschiedensten Stellen
des Gutshofes eine größere Anzahl von Stücken gefunden worden. Herrn Prof. Philipp, Direktor
des Geologischen Institutes *) der Universität Köln, verdanken wir Bestimmungen des Materiales.
Nach seinem Urteil handelt es sich einmal um schwarzen sogenannten belgischen Marmor,
Kalkstein des Kohlenkalkes, der in zwei Sorten vertreten ist: ganz einfach schwarzer und solcher
mit vielen Versteinerungen. Dieses Material steht in der Gegend von Lüttich an. Ferner ist soge-
nannter roter belgischer Marmor vertreten. Dies sind polierfähige, versteinerungsreiche Kalksteine,
die am Nordabhang der Ardennen anstehen. Auffallend ist, daß — abgesehen von einigen rein
weißen Stücken, die möglicherweise aus der Gegend von Carrara stammen könnten — kein Material
aus dem Süden vorliegt, während solches aus den großen schloßähnlichen Gütern der Trierer Gegend
und aus Belgien massenhaft zu belegen ist. Nachstehend wird das gehobene Material nach Fund-
stellen getrennt in Kürze aufgezählt:
Aus der Abfallstelle 15 (Ententeich) stammt eine große Anzahl von Bruchstücken ver-
schiedenster Art. Nur das wichtigste davon sei hier angeführt: eine schwarze Platte, noch 24 cm
lang und 10,5 cm breit (beiderseits alte Begrenzung); eine zweite ist ebenfalls 10,5 cm breit und
noch 17 cm lang, schwärzliches Material mit weißlichen Einschlüssen (Versteinerungen). Eine schmale
x) An dieses wie an das R.-G. Zentralmuseum Mainz wurden Proben abgegeben.